Hans Friesen Bücher



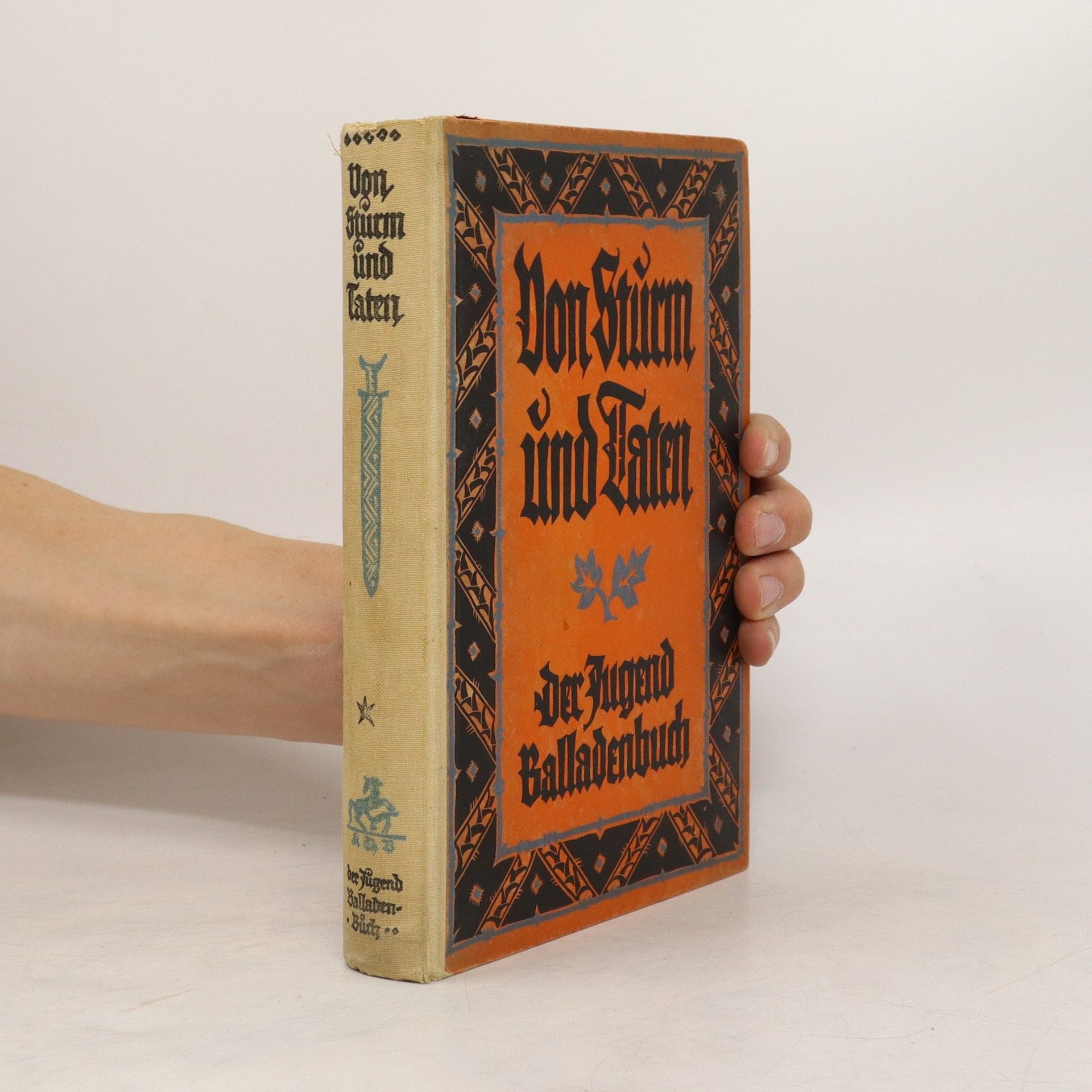
Im globalen Spannungsfeld der Korruption
Analysen eines Phänomens aus interdisziplinären Perspektiven
- 260 Seiten
- 10 Lesestunden
In diesem Sammelband erklaren ausgewiesene Experten aus Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft und Philosophie das weltweit beklagte Phanomen der Korruption. Welche gesellschaftlichen bzw. kulturellen Folgen hat es? Dabei kommen Korruption und der Kampf gegen Korruption nicht nur in unterentwickelten und kollektivistisch gepragten Staaten vor. Auch im individualistisch gepragten Deutschland kann man selbst in der jungeren Vergangenheit spektakulare Korruptionsfalle aufzahlen, die beweisen, dass es ebenfalls bei vermeintlichen Vorzeigeunternehmen wie Siemens und VW zu Schmiergeldzahlungen in Millionenhohe gekommen ist.
Kultur und Ästhetik in der kulturellen Moderne
- 276 Seiten
- 10 Lesestunden
Die zentrale Thematik dieses Werkes ist einerseits der „Zerfall der Einheit“ und andererseits die „Entfaltung der Vielheit“. Die kulturelle Moderne wollte das gesamte menschliche Wissen mit Hilfe von ‚großen Erzählungen‘ legitimieren und zu einer Einheit zusammenfügen. Dazu hat sie drei Meta-Erzählungen hervorgebracht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts haben Künstler, Literaten, und Philosophen jedoch begonnen, an der ‚Einheit des Wissens‘ zu zweifeln und sie zu bestreiten. Ihre Einschätzungen haben schließlich dazu geführt, dass wir heute nicht mehr ernsthaft an die Maßgeblichkeit von Begriffen wie ‚Totalität‘ glauben können. Heute versuchen wir daher, Einheit und Vielheit in ein Verhältnis der kulturellen Vermittlung zu bringen.
Geschichtsphilosophie
Gibt es einen Fortschritt in der Philosophiegeschichte?