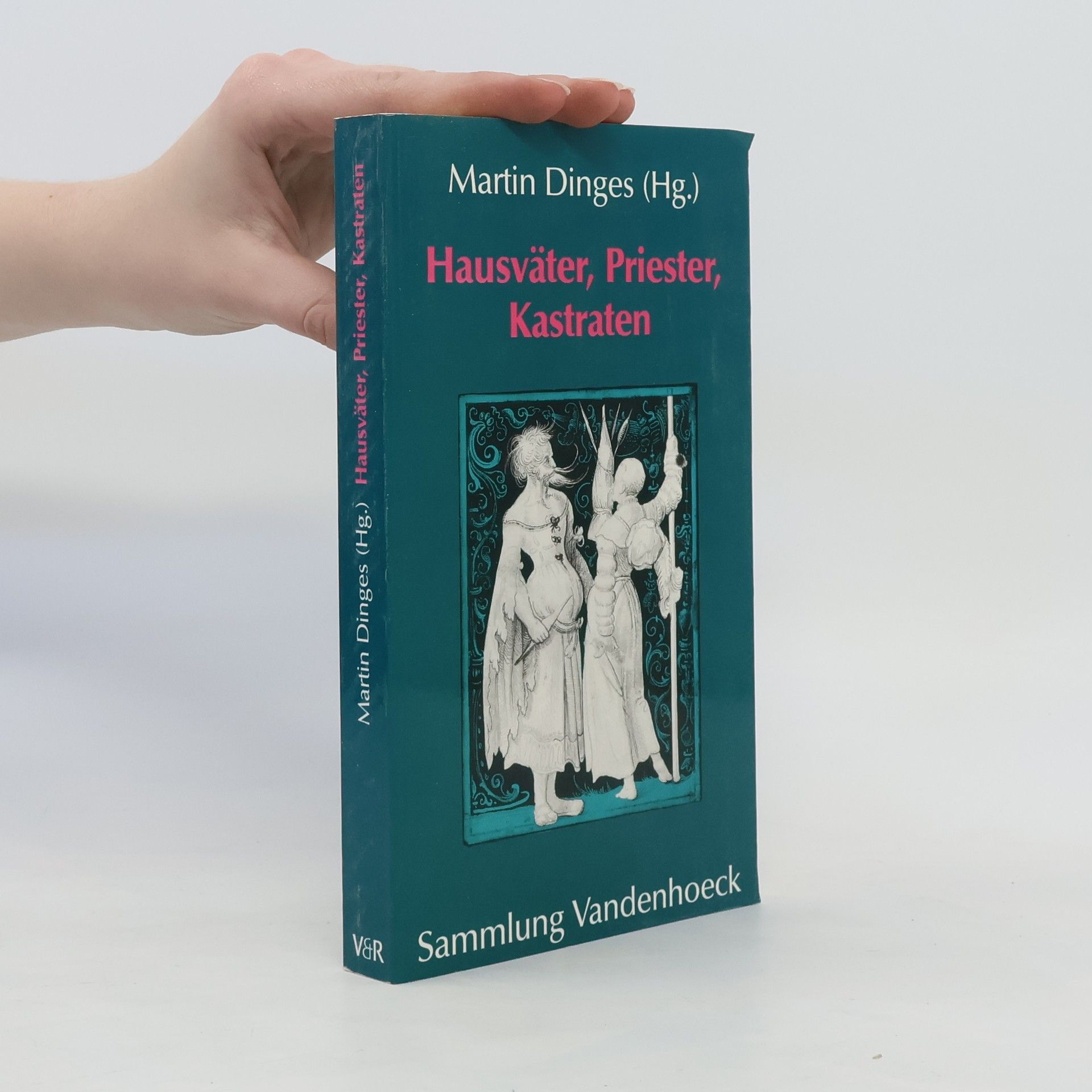Männlichkeiten und Care
Selbstsorge, Familiensorge, Gesellschaftssorge
Die Debatte um Care wirft grundlegende Fragen zur Neuverteilung gesellschaftlicher Arbeit auf, die weit über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinausgehen. Daraus ergeben sich bisher zu wenig beachtete Veränderungen für den Alltag von Männern und die Leitbilder von Männlichkeit. Der Band bietet Analysen zum Verhältnis von Männlichkeit und Sorgearbeit sowie zum aktuellen Wandel in Familien und Firmen, Politik und Kultur. Diskussionen um Konzepte von Vaterschaft seit der Aufklärung und die verdrängte Tradition von Männern in Pflegeberufen eröffnen historische Perspektiven für die Gegenwart. (Quelle: buchhandel.de)