„Warum bin ich hier? fragt die Krawattenrechnung. Ordne mich ein! fordern einige Zeilen, die ein Gedichtanfang sein könnten. Deute mich! ruft ein nicht abgeschickter Briefentwurf, ergänze mich! krächzt ein zerrissener Zettel.“ (Sandro Huber: Das Apollo-Department) Studierende des Instituts für Sprachkunst in Wien haben sich ein Jahr lang mit dem literarischen Erbe Konrad Bayers und dem späten Nachhall der Wiener Gruppe befasst. Sie trafen sich in jener Wohnung im dritten Wiener Bezirk, in der Konrad Bayer und die ihn um viele Jahre überlebende Traudl Bayer-Steiger einige Zeit gemeinsam gelebt haben. Dort ist der verbliebene Teilnachlass Konrad Bayers in säurelosen Archivkartons in einem sicheren Manuskriptschrank verwahrt. Der Band versammelt Beiträge zum eisigen Solipsismus Konrad Bayers, zum Überdauern der Dinge, zum Durchrauschen der Gespenster oder zu Bayers vertracktem Verhältnis zu den unterschiedlichsten Ordnungsstrukturen. Neben studentischen Arbeiten findet sich in dieser Auswahl auch der Festvortrag für Traudl Bayer, den die Autorin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin Theresia Prammer anlässlich des 100. Geburtstags in Wien gehalten hat, in dem sie sich ausgehend von der Liebesbeziehung zwischen Traudl Bayer-Steiger und Konrad Bayer mit dem Leben dieser klugen, humorvollen, reichen, lebenslustigen und „mental weitgereisten“ Frau befasst.
Hans Edwin Friedrich Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



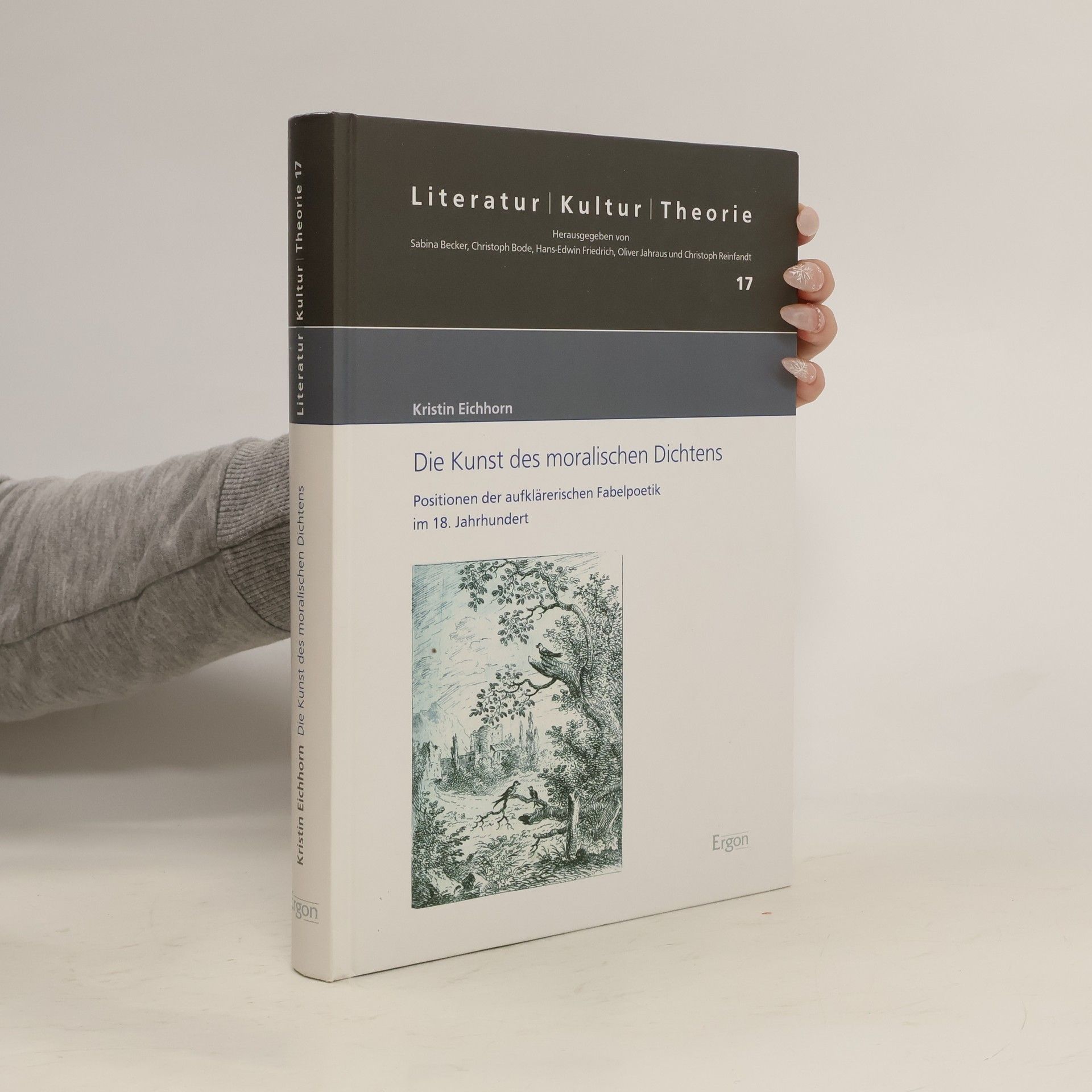
„Du hast keine Chance, aber nutze sie“ – diese populär gewordene sprichwörtliche Paradoxie hat bei Herbert Achternbusch auch eine werkpolitisch programmatische Funktion. So motiviert das unlösbare, ästhetisch produktive Dilemma seine Poetik der Verhüllung und Enthüllung und damit sein Gesamtwerk. Die Beiträge berühren die medienästhetischen Konsequenzen der Poetik und Werkpolitik von 'Verhüllung' und 'Offenbarung' auf vielfältige Weise und beleuchten aus verschiedenen werkspezifischen Perspektiven insbesondere auch ihre filmischen Realisationen in vier Bereichen: politischen und mythologischen, in Diskursen über Religion, Theologie und Kirche, in Diskursen über 'Fremdheit' und 'Heimat', im selbstreflexiven Diskurs über Kunst, also über Sprache, Bilder und Filme, über Autorschaft, Werkstiftung und den Literatur- und Theaterbetrieb sowie die Filmwirtschaft selbst.
Literatur | Kultur | Theorie - 17: Die Kunst des moralischen Dichtens
Positionen der aufklärerischen Fabelpoetik im 18. Jahrhundert
- 261 Seiten
- 10 Lesestunden
Obwohl die Fabel unbestritten eine der wichtigsten Gattungen der Aufklarungsliteratur darstellt, ist sie von der literaturwissenschaftlichen Forschung bislang kaum untersucht worden. Zu oft hat man ihr in der Vergangenheit Trivialitat unterstellt und sie als blosse Gebrauchliteratur verstanden. Dagegen wurde der dichtungstheoretische Diskussionszusammenhang ignoriert, in dem sie im 18. Jahrhundert steht. Dieser Diskussionszusammenhang wird in der vorliegenden Studie erstmals umfassend rekonstruiert. Dabei werden neben den Fabeltexten endlich auch die theoretischen Fabelabhandlungen systematisch auf Basis der Erstausgaben ausgewertet. Die chronologische Darstellung zeigt, wie sich die Fabeldiskussion der Aufklarung in drei Phasen um die zentrale Frage dreht, wie die Moralwirkung von Dichtung gesichert werden kann, vermag so die Bedingungen der aussergewohnlichen Karriere der Fabel zwischen 1730/40 bis 1770 im Detail zu kontextualisieren. Dabei gelingen wichtige Umakzentuierungen und eine Fulle von Neudeutungen: Nicht nur zeigt sich, wie das heutige Fabelbild sich in der aufklarerischen Diskussion erst langsam herausbildet. Indem der zentrale Einfluss von Autoren wie Daniel Wilhelm Triller, Johann Jacob Bodmer und Johann Jacob Breitinger hervorgehoben wird, ist auch eine Neubewertung von Lessings Fabelkonzept moglich, dessen Verankerung im Gattungskontext hier zum ersten Mal im Einzelnen dargelegt wird.
Der historische Roman zählt zu den Erfolgsgattungen der letzten 20 Jahre, doch erst jetzt beginnt die Literaturwissenschaft, sich intensiv mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen. Der Sammelband widmet erfolgreichen Leseklassikern des Genres ausführliche Fallstudien. Er geht der Rehabilitierung des Geschichtsromans in der Postmoderne nach und beschäftigt sich besonders mit den parahistorischen und metafiktionalen Romanformen, die das Verhältnis von factum und fictum verhandeln und fachliche Trends der Geschichtswissenschaft aufgreifen. Der Band bietet darüber hinaus detaillierte Untersuchungen zu aktuellen Bestsellern und deren Tendenz, sich vom traditionellen Modell der nationalen Erfolgsgeschichte ab- und der «Abweichlergeschichte» zuzuwenden. Den Abschluss bildet eine Primärbibliographie des historischen Romans seit 1985.