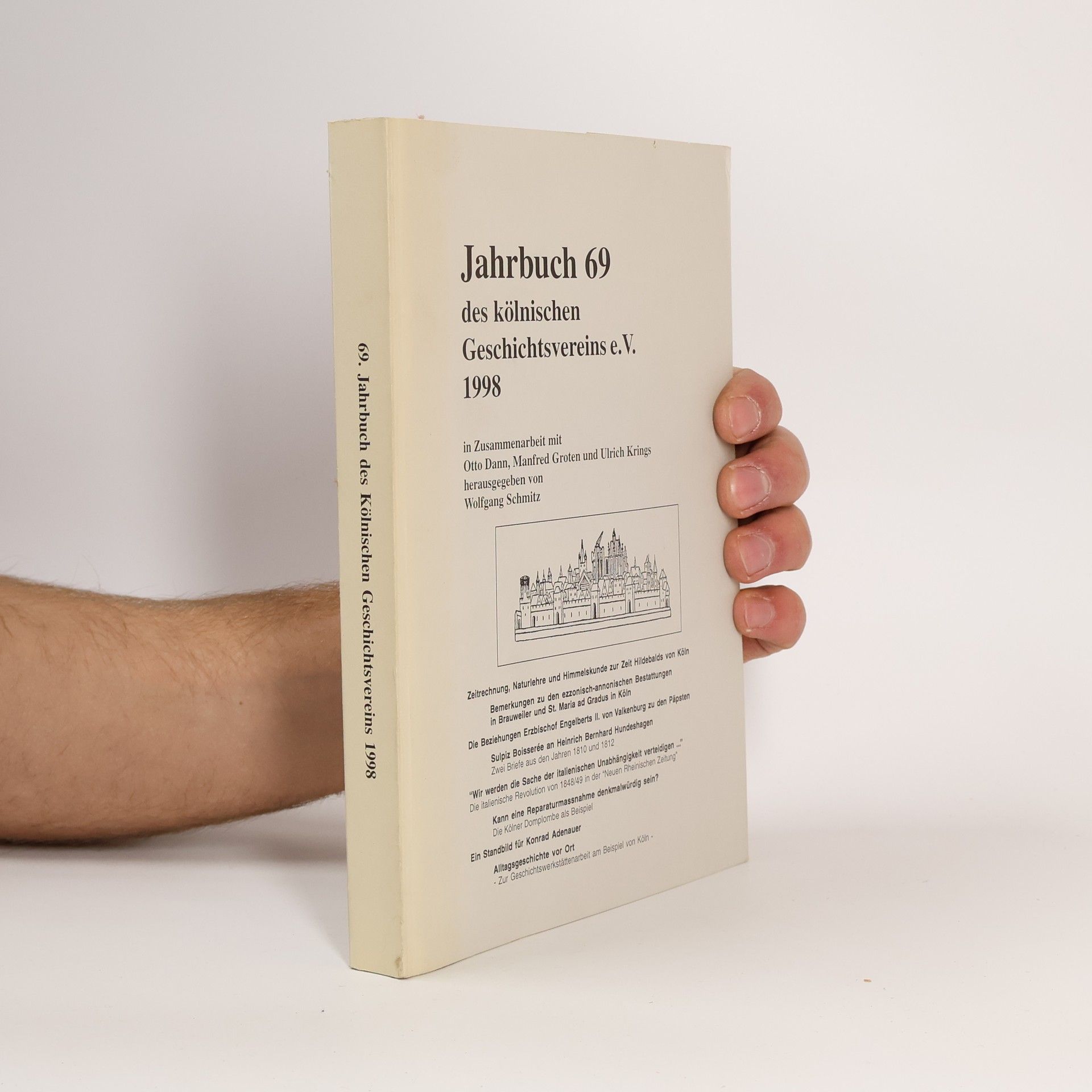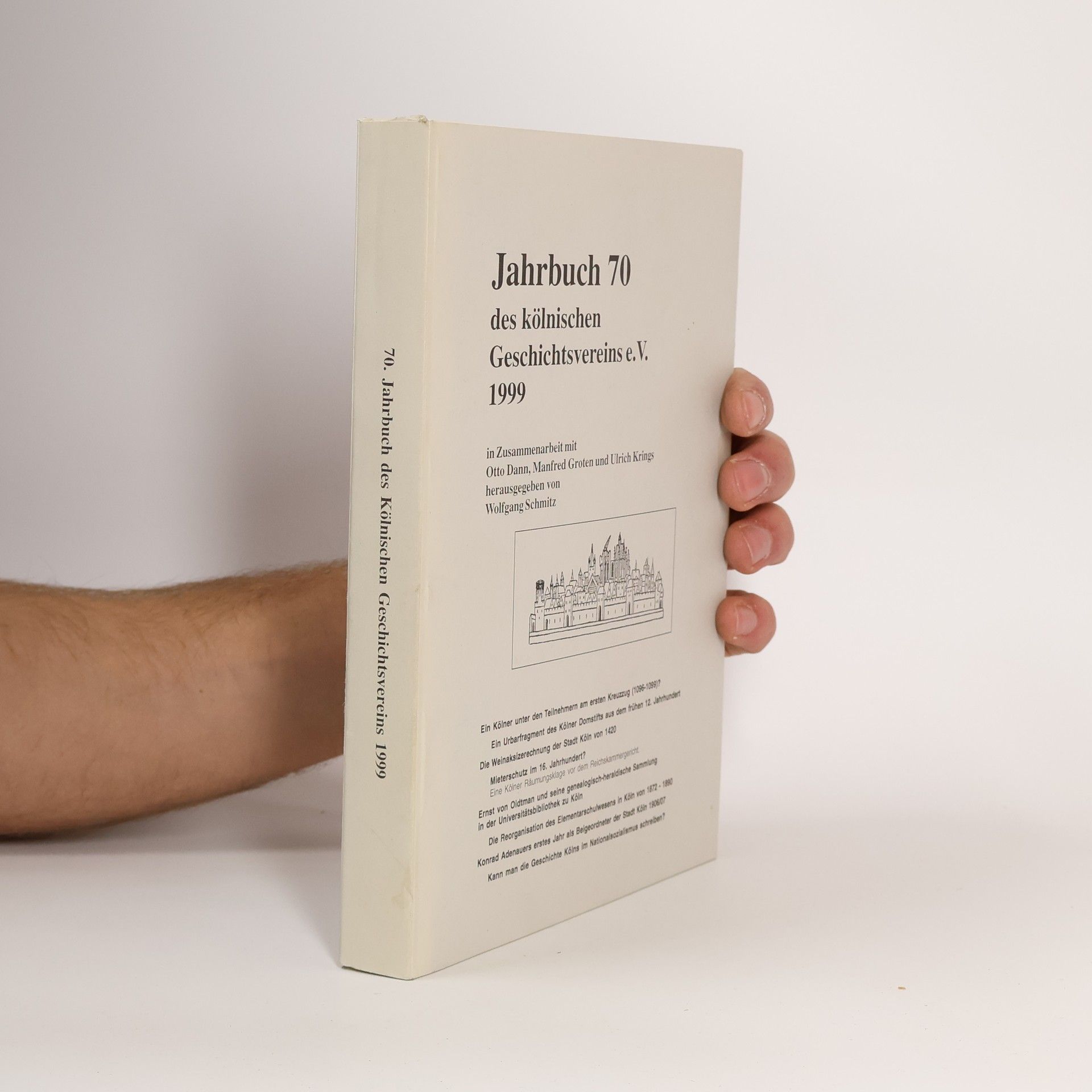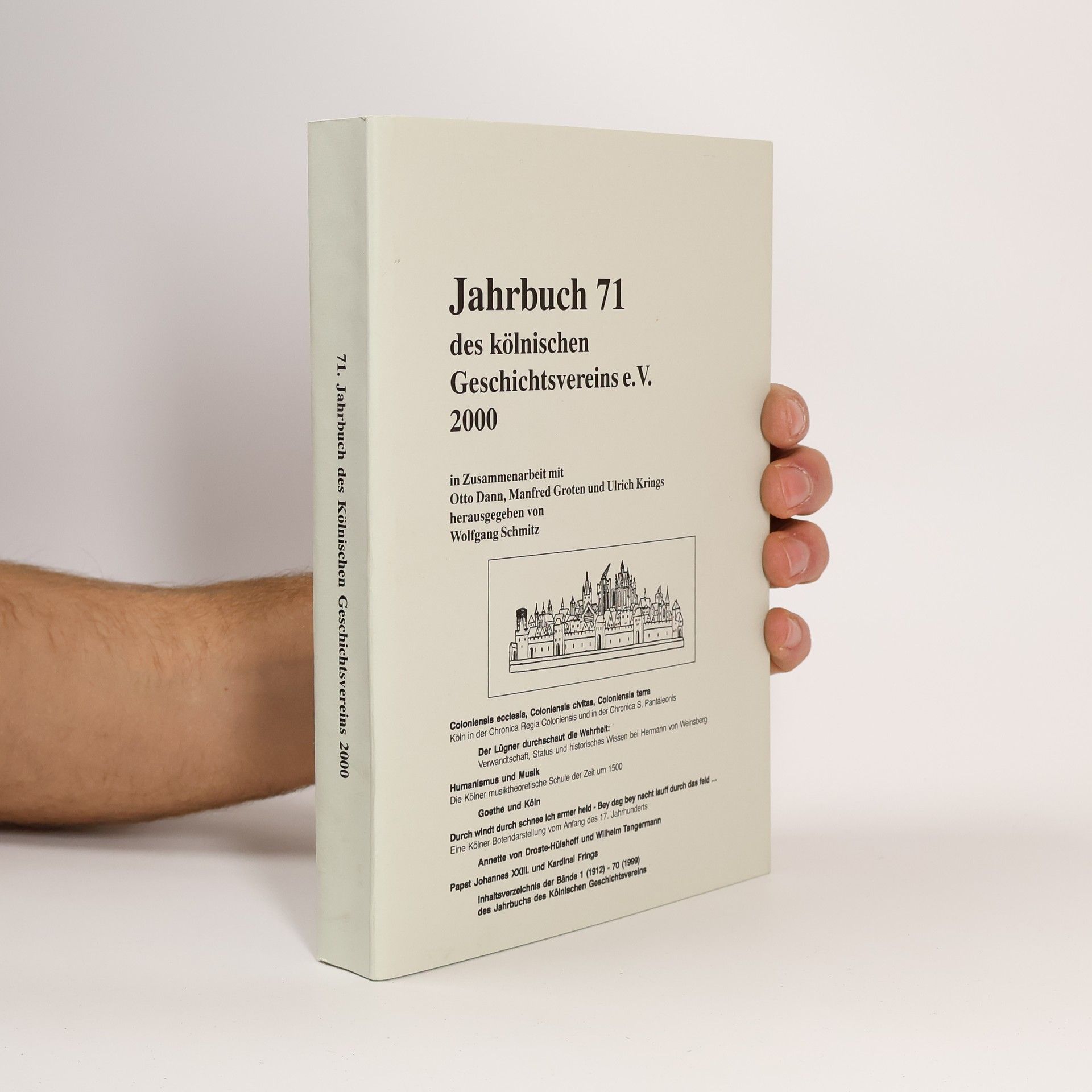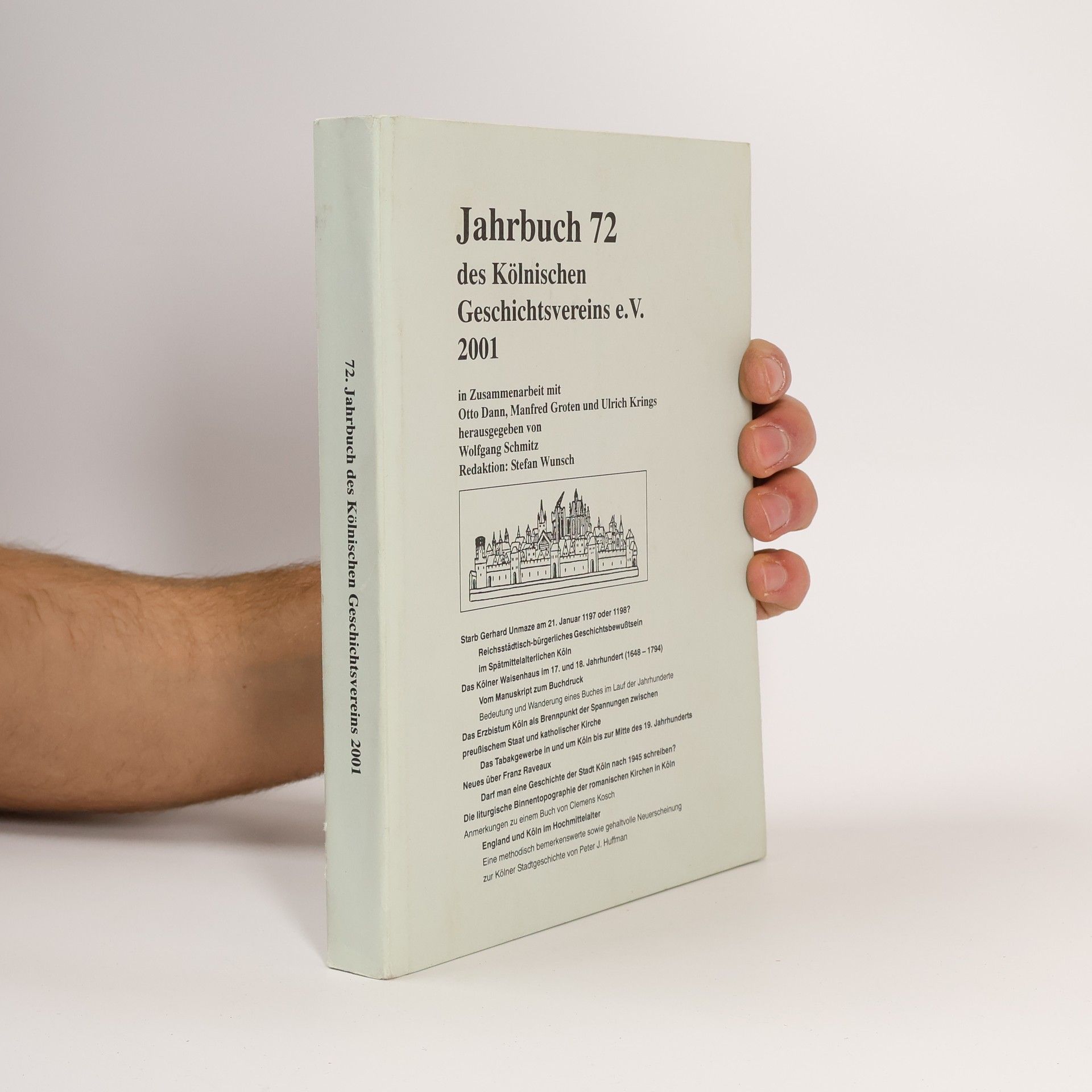Manfred Groten Bücher
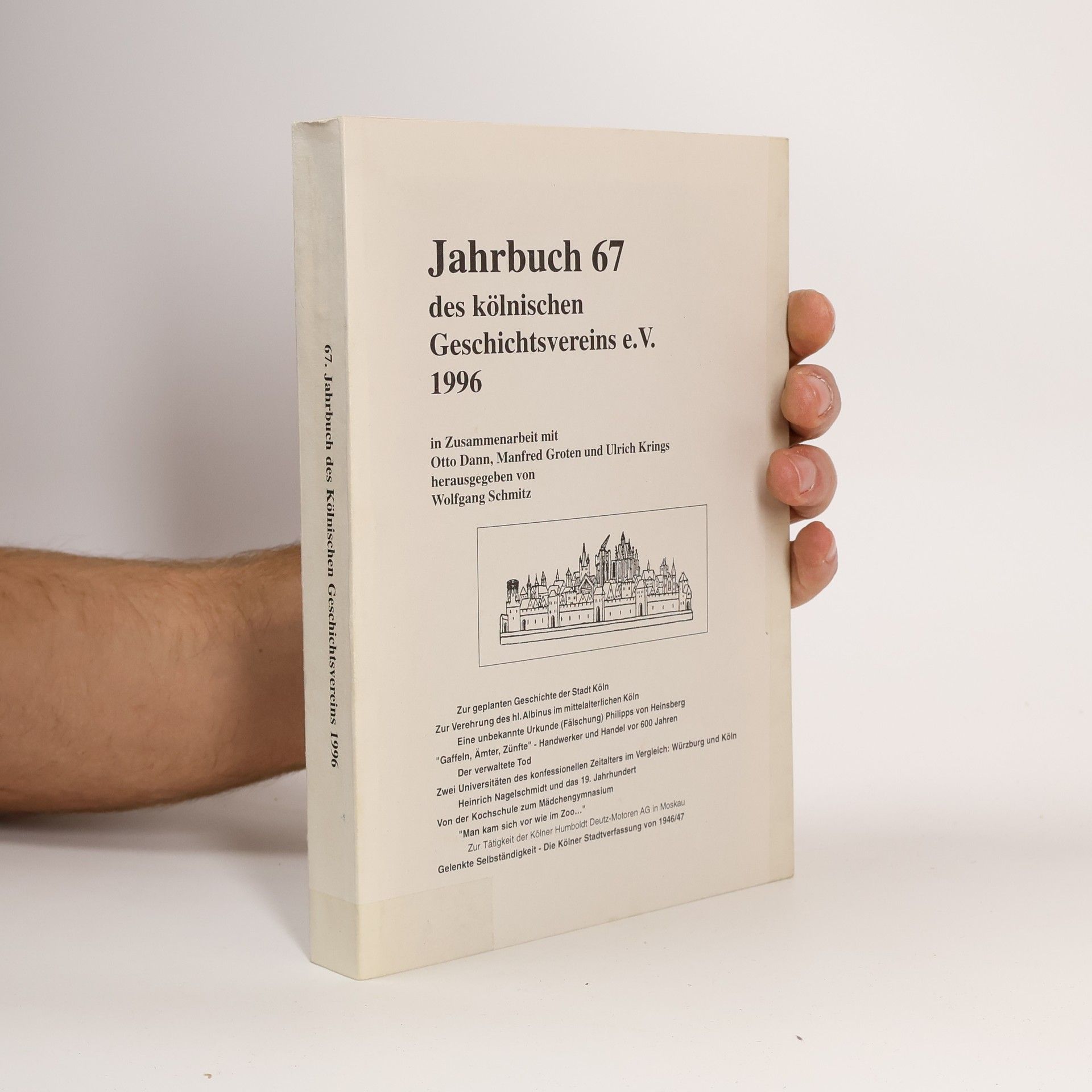
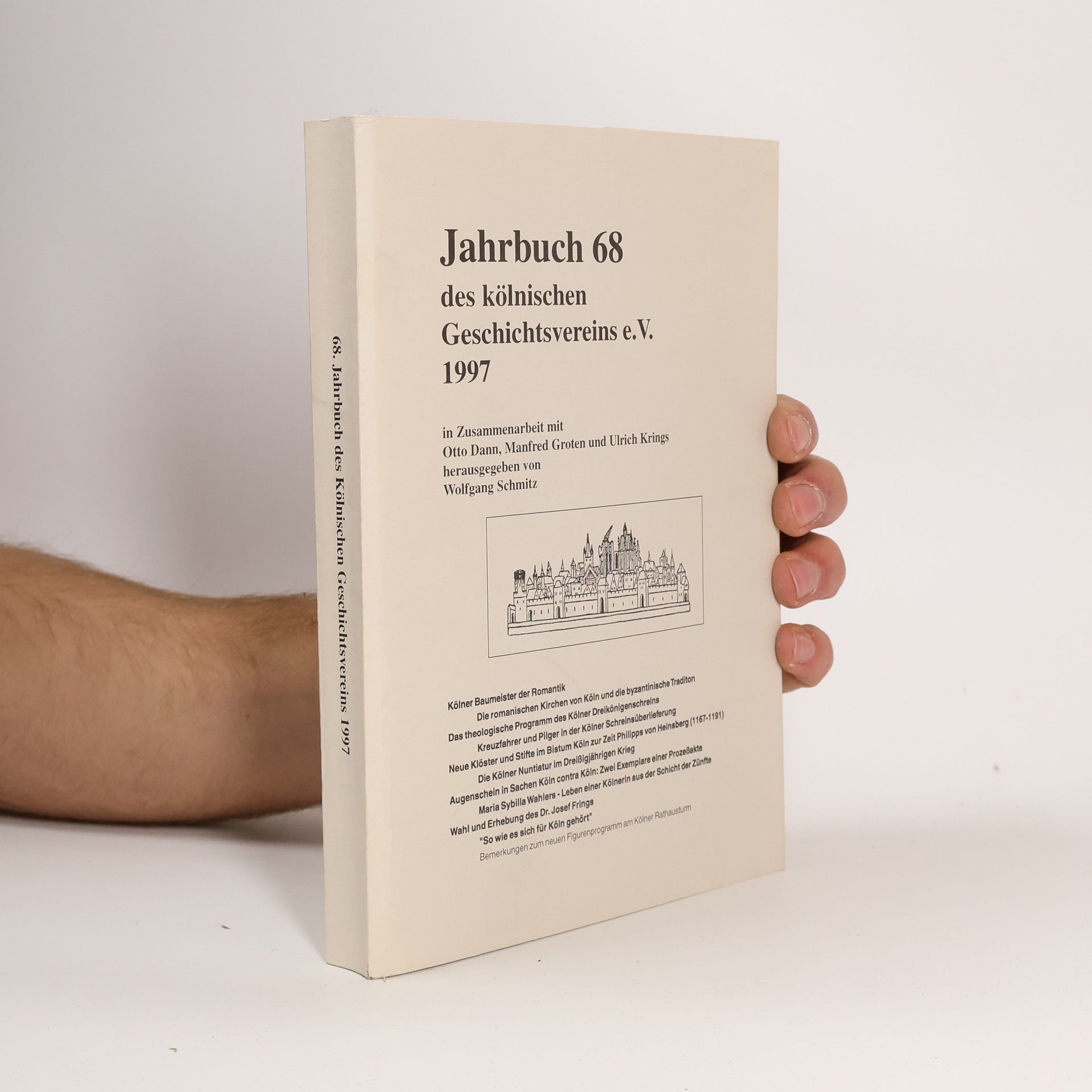
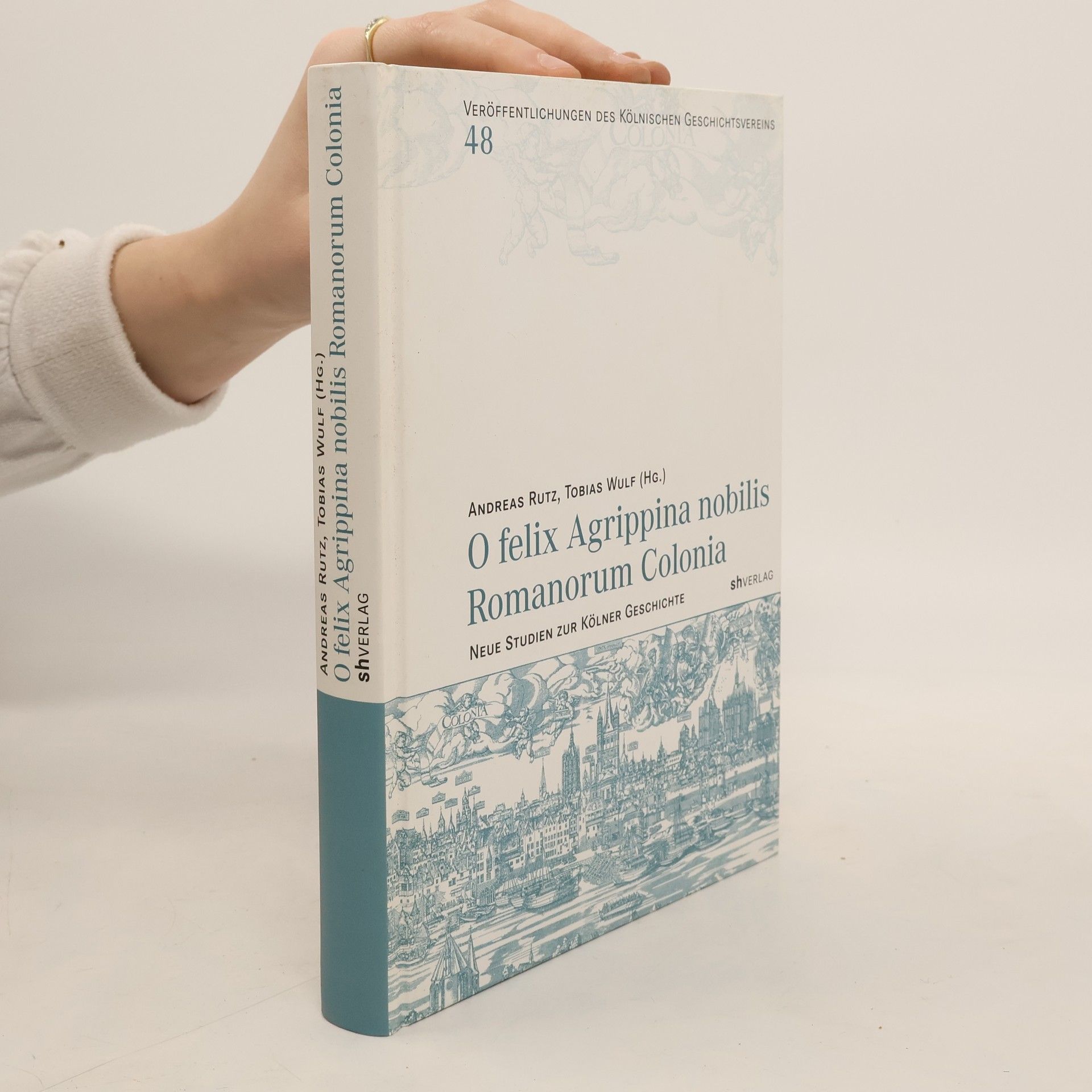
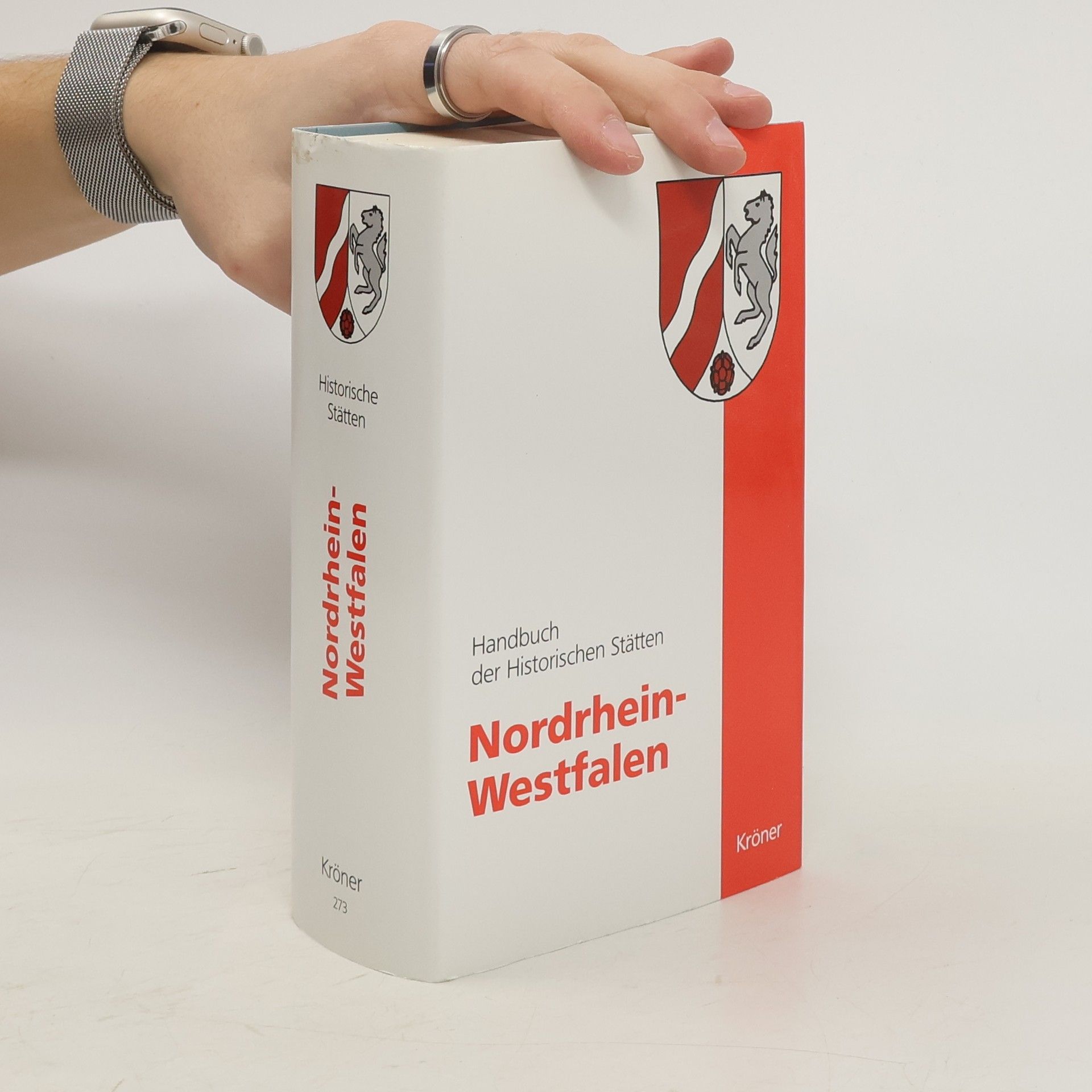
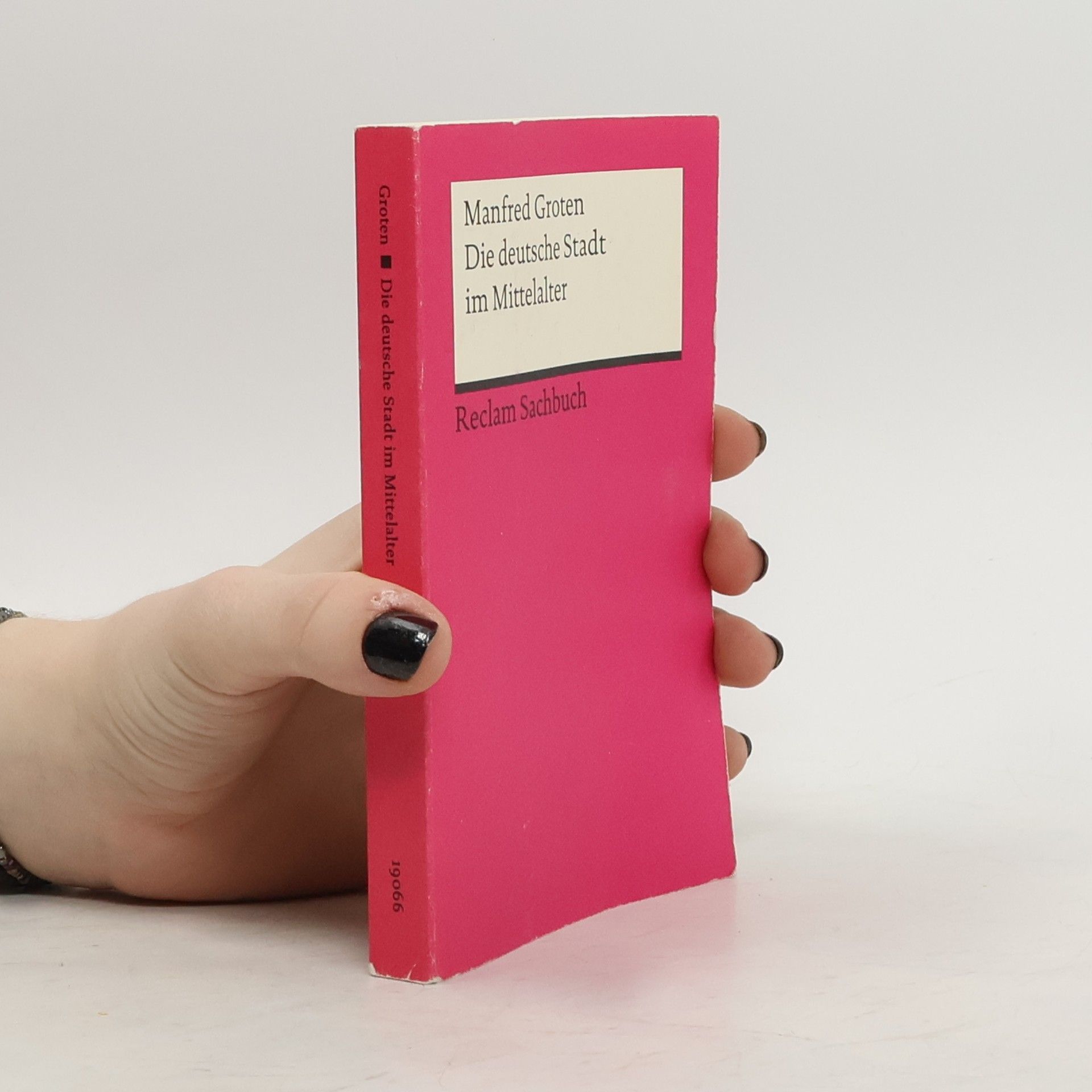

Die deutsche Stadt im Mittelalter
Groten, Manfred – Epochen und Schriften aus den Jahrhunderten; Bedeutsames der deutschen Geschichte
- 310 Seiten
- 11 Lesestunden
Eine Stadt ist nicht nur eine Bevölkerungsagglomeration, sie ist ein Wirtschaftsraum, eine Herrschafts- und Verwaltungseinheit, ein Raum mit gewissem eigenem Recht, ein soziales Gebilde, ein Verband und ein Verbund von Bürgern, eine Lebensform auch im Sinn einer bestimmten Kultur und eines Selbstverständnisses. All dies bildet sich und differenziert sich aus in den dynamischen Zeiten des hohen und späten Mittelalters, und es wird vom Spezialisten für rheinische Geschichte Manfred Groten am Beispiel der (damaligen) einzigen deutschen Metropole Köln mit Seitenblicken auf die vielen kleineren, aber u. U. nicht weniger wichtigen Städte entfaltet.
Kaum eines der ›alten‹ Bundesländer Deutschlands hat in den letzten Jahrzehnten eine derart tiefgreifende Umstrukturierung erlebt wie Nordrhein-Westfalen. Nach nunmehr 35 Jahren wird dieser Entwicklung durch die 3., völlig neu bearbeitete Auflage dieses Bandes des „Handbuchs der Historischen Stätten“ Rechnung getragen. Rund 1400 Ortsartikel dokumentieren den aktuellen Stand der landes- und ortsgeschichtlichen Forschung und berücksichtigen dabei auch neue Forschungsfelder der Geschichtswissenschaften wie die Industrie- und Wirtschaftsgeschichte. Besonderes Augenmerk wurde auf das 19. und 20. Jahrhundert gelegt. Mit zahlreichen Karten, Orts- und Personenregister, einer Einleitung mit einem landesgeschichtlichen Überblick sowie einem Glossar zu den wichtigsten Fachausdrücken empfiehlt sich das Buch gleichermaßen für Fachleute wie für den interessierten Laien.
Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins - 48: O felix Agrippina nobilis Romanorum Colonia
Neue Studien zur Kölner Geschichte ; Festschrift für Manfred Groten zum 60. Geburtstag
- 278 Seiten
- 10 Lesestunden
Zum 60. Geburtstag von Manfred Groten prasentieren seine Schuler ein breites Panorama der Kolner Geschichte vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert und setzen damit zugleich ein erstes wissenschaftliches Lebenszeichen der Kolner Geschichtsforschung nach dem Einsturz des Stadtarchivs am 3. Marz 2009. Das thematische Spektrum umfasst die Verfassungs-, Kirchen- und Sozialgeschichte der Stadt ebenso wie die Geschichte der Universitat und des Kolner Kurstaates bzw. Erzbistums. Eine Schlusselrolle spielt dabei die Analyse personaler Netzwerke. Ob hinsichtlich auswartiger Studenten, der Kolner Pfarrgeschichte im Mittelalter, der Professionalisierung obrigkeitlicher Herrschaftspraktiken am Beginn der Fruhen Neuzeit, interstadtischer Migration, weiblicher Frommigkeitsnetzwerke oder der Priesterwanderung zwischen den Erzdiozesen Koln und Trier im 19. Jahrhundert - die Untersuchung von personalen Verflechtungen ermoglicht jeweils vertiefende Einblicke in die internen Mechanismen und Funktionsweisen der damaligen Gesellschaft.
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins Band 69.1998
- 222 Seiten
- 8 Lesestunden
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins Band 70.1999
- 270 Seiten
- 10 Lesestunden
Jahrbuch 71 des Kölnischen Geschichtsvereins e.V. 2000
- 266 Seiten
- 10 Lesestunden
Jahrbuch 72 des Kölnischen Geschichtsvereins e.V. 2001
- 294 Seiten
- 11 Lesestunden