Franz Metz Bücher
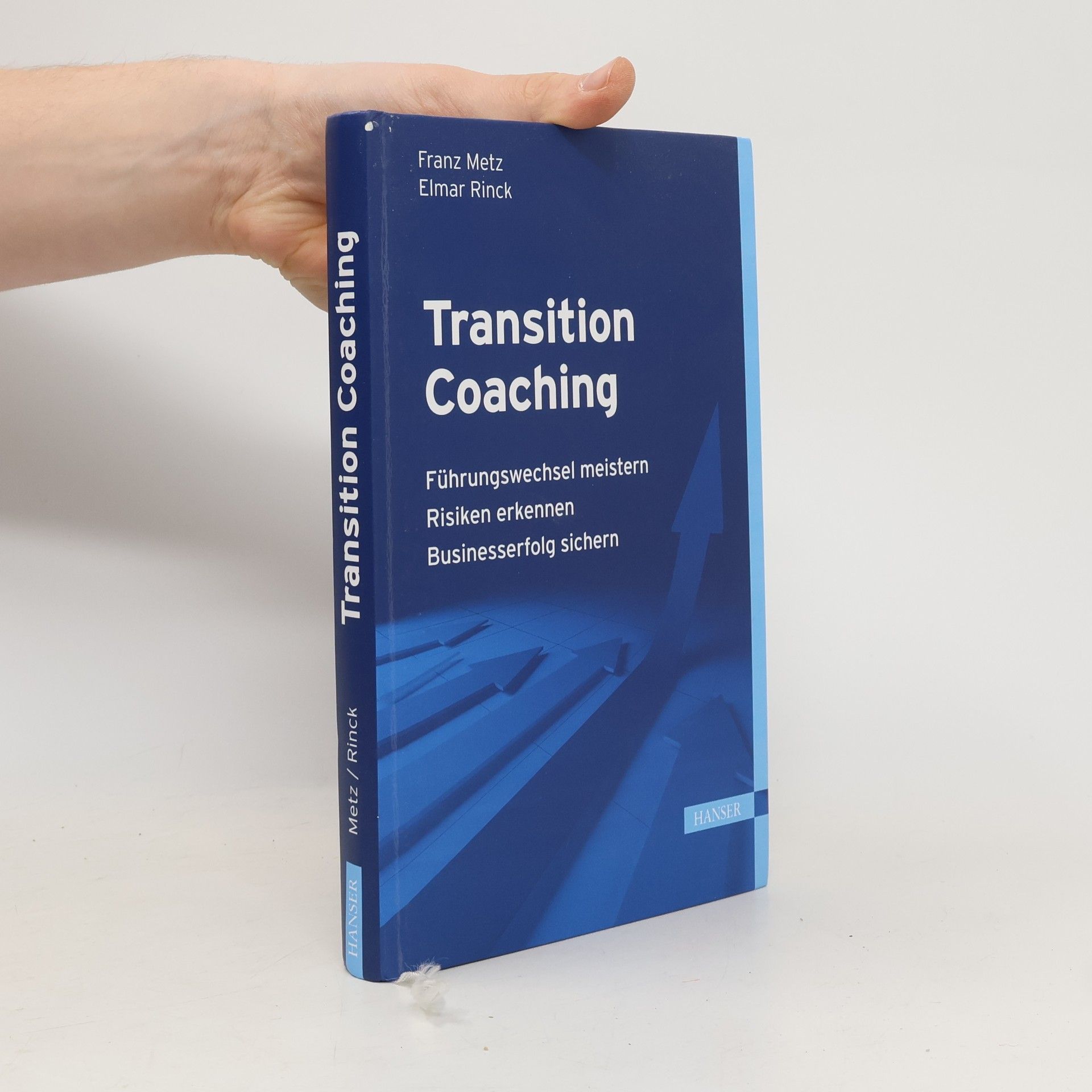




Musikstadt Begapolis
Armin Rippka und die Musik der Banater Stadt Grossbetschkerek (Zrenjanin)
Zrenjanin, Petrovgrad, Veliki Bečkerek, Nagy Becskerek, Groß-Betschkerek, Becicherecul Mare oder einfach nur Becskerek – all dies sind die Namen der Stadt an der Bega im serbischen Banat. Auch noch Begapolis nannte man diese multiethnische Siedlung, deren erste urkundliche Erwähnung im Königreich Ungarn aus dem Jahre 1326 stammt. Die Musikkultur spielte in dieser Stadt schon immer eine große Rolle. Ob im Bereich der Kirchenmusik, Kammermusik, Blasmusik, Chormusik oder Instrumentalmusik, all diese Sparten der Musikkultur waren in Großbetschkerek ständig vertreten. Dies führte dazu, dass sich auch Musiker aus anderen Teilen Europas in dieser Stadt niederließen, nach dem Motto vieler Banater Gesangvereine: „Wo man singt da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder“. Dazu gehörte auch Armin Rippka, ein junger Musiker aus Wien, der sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbetschkerek niedergelassen hat. Er und sein Sohn Imre (Emmerich) Ripka werden in der weiteren Entwicklung der Musikkultur dieser kleinen Metropole an der Bega noch eine wichtige Rolle spielen.
Was bis zum Sturz des kommunistischen Regimes in Rumänien nicht denkbar war, hat der Autor in die Tat umgesetzt: Erstmals legt er hier wertvolle Forschungsergebnisse und Dokumente zur Kirchenmusik der in Rumänien lebenden Deutschen vor. In Rumänien war es in den letzten 50 Jahren nicht gestattet, die Kirchenmusik der nationalen Minderheiten zu erforschen und selbst die rumänische Musikgeschichte wurde der kommunistischen Zensur unterstellt. Kirchenmusikarchive wurden willkürlich zerstört oder von den Behörden beschlagnahmt. Dennoch wurde diese Musikkultur gepflegt, während sie heute, bedingt durch die Auswanderung des größten Teils der deutschen Bevölkerung Rumäniens, zum Aussterben verurteilt ist. Nach knapp 300 Jahren fließt dieses musikalische Erbe, das dereinst aus süddeutschen Gebieten mitgebrachte Kulturgut, in das Herkunftsland zurück. Der Autor versucht dem Fachmann, aber auch dem Laien in komprimierter und handlicher Form die Kirchenmusik e i n e r der vielen seit Jahrhunderten nebeneinanderlebenden Völker und Konfessionen Rumäniens nahezubringen.
Transition Coaching
Führungswechsel meistern, Risiken erkennen, Businesserfolg sichern
- 245 Seiten
- 9 Lesestunden
Rare Book