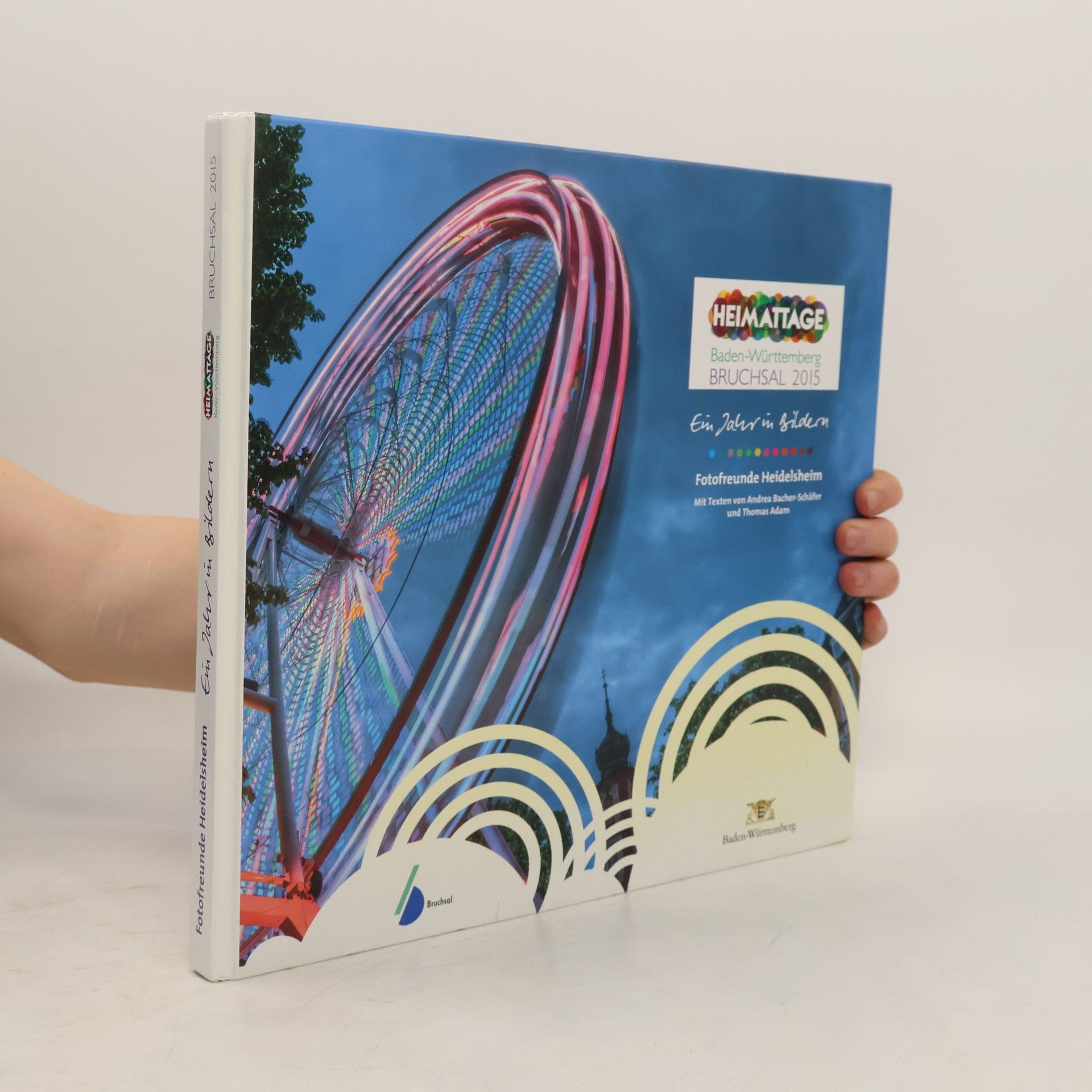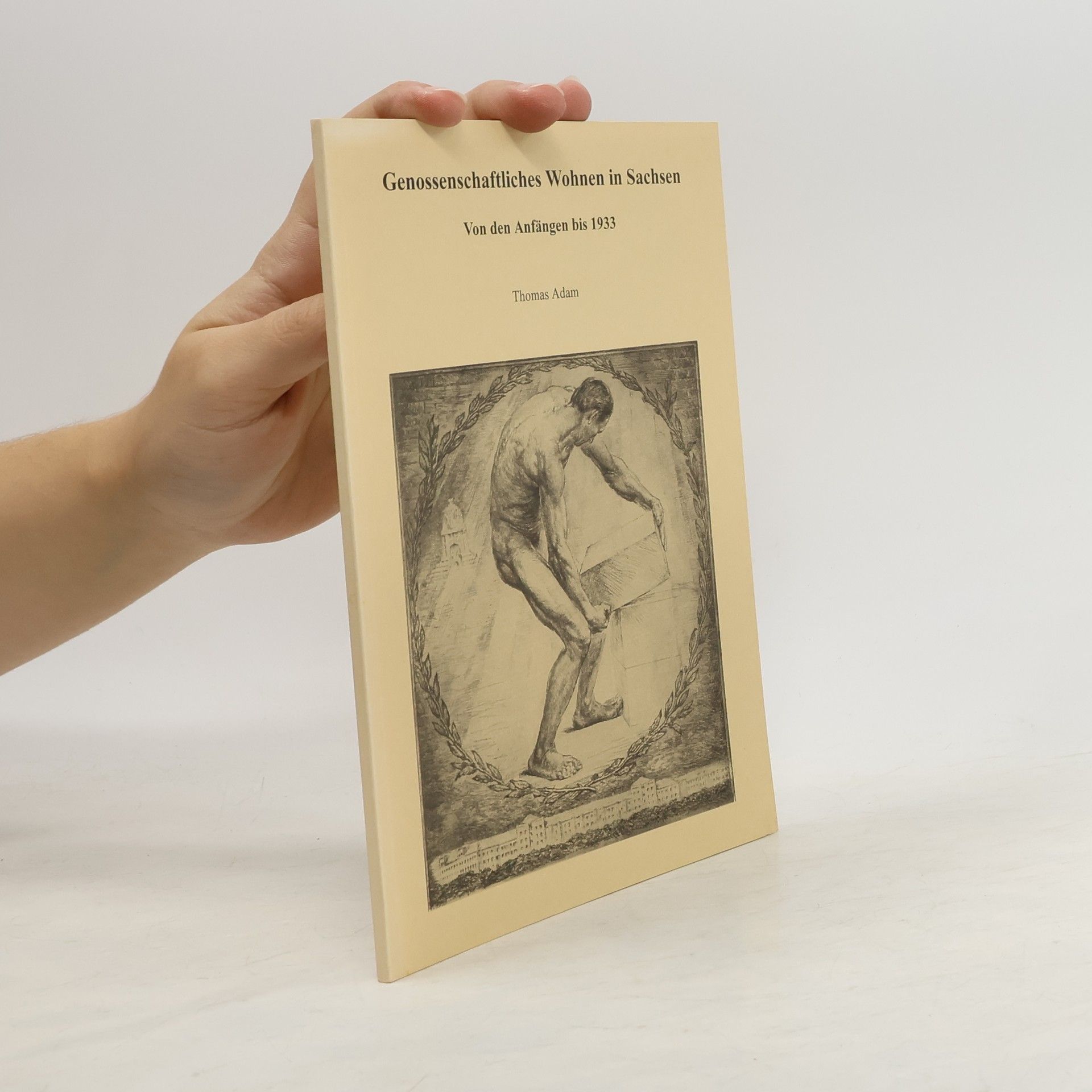Der Kraichgau ist die Bezeichnung einer Landschaft, die im Norden vom Odenwald, im Süden vom Schwarzwald, im Westen von der Oberrheinischen Tief-ebene und im Osten von Stromberg, Heuchelberg und Zabergäu begrenzt wird. Die größten Städte in diesem Kulturraum sind Bretten, Bruchsal, Sinsheim, Eppingen und Bad Rappenau. Daneben finden sich zahlreiche mittlere und kleinere Dörfer im Kraichgau wie Bad Schönborn, Oberderdingen und Kraichtal. Thomas Adam beschreibt die Geschichte des 'Lebensraums Kraichgaus' von den ersten Besiedelungen bis in unsere Zeit. So ist die einzige verfügbare Gesamtschau der Geschichte des Kraichgaus entstanden. Unterhaltsam, wissenschaftlich fundiert und kompakt.
Thomas Adam Bücher
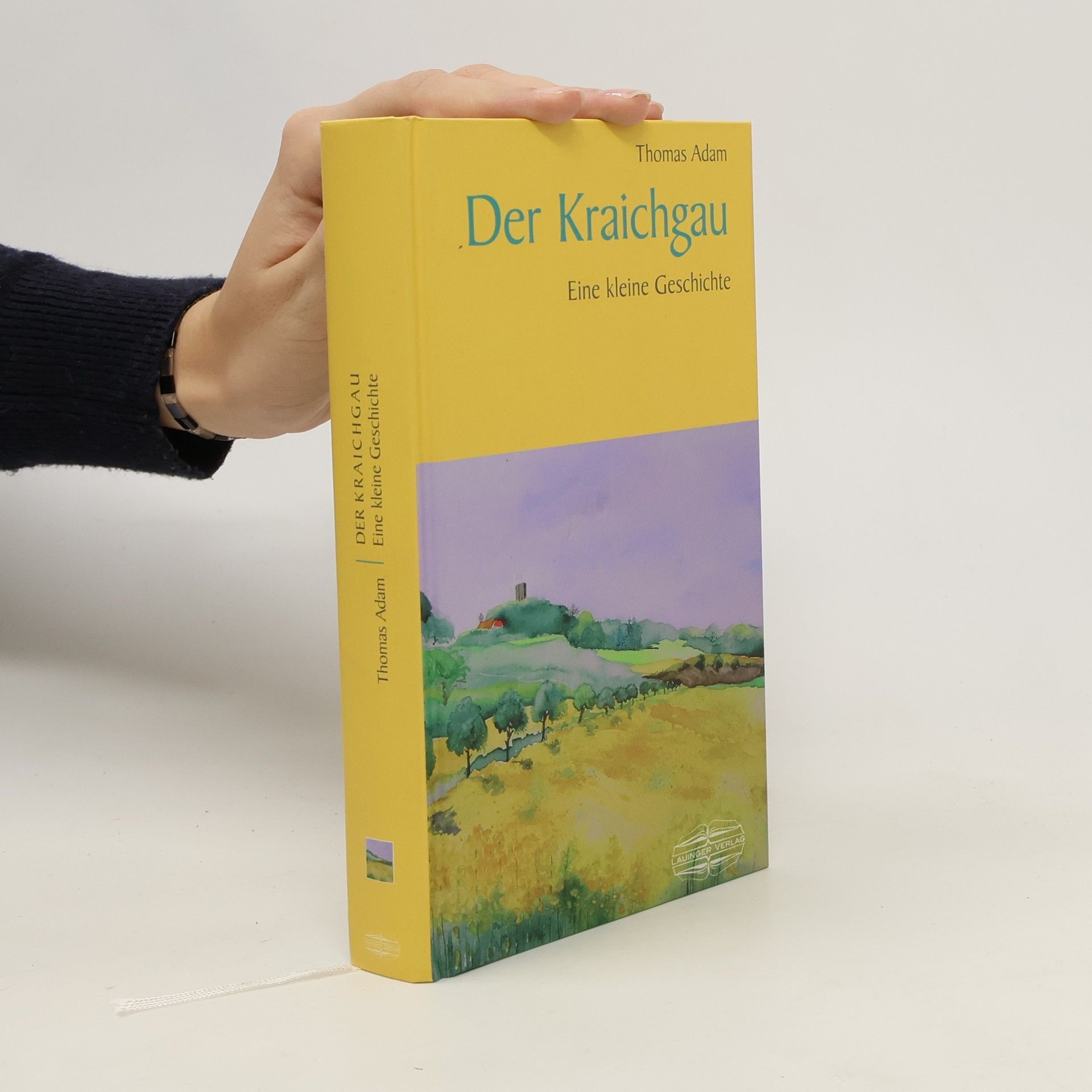




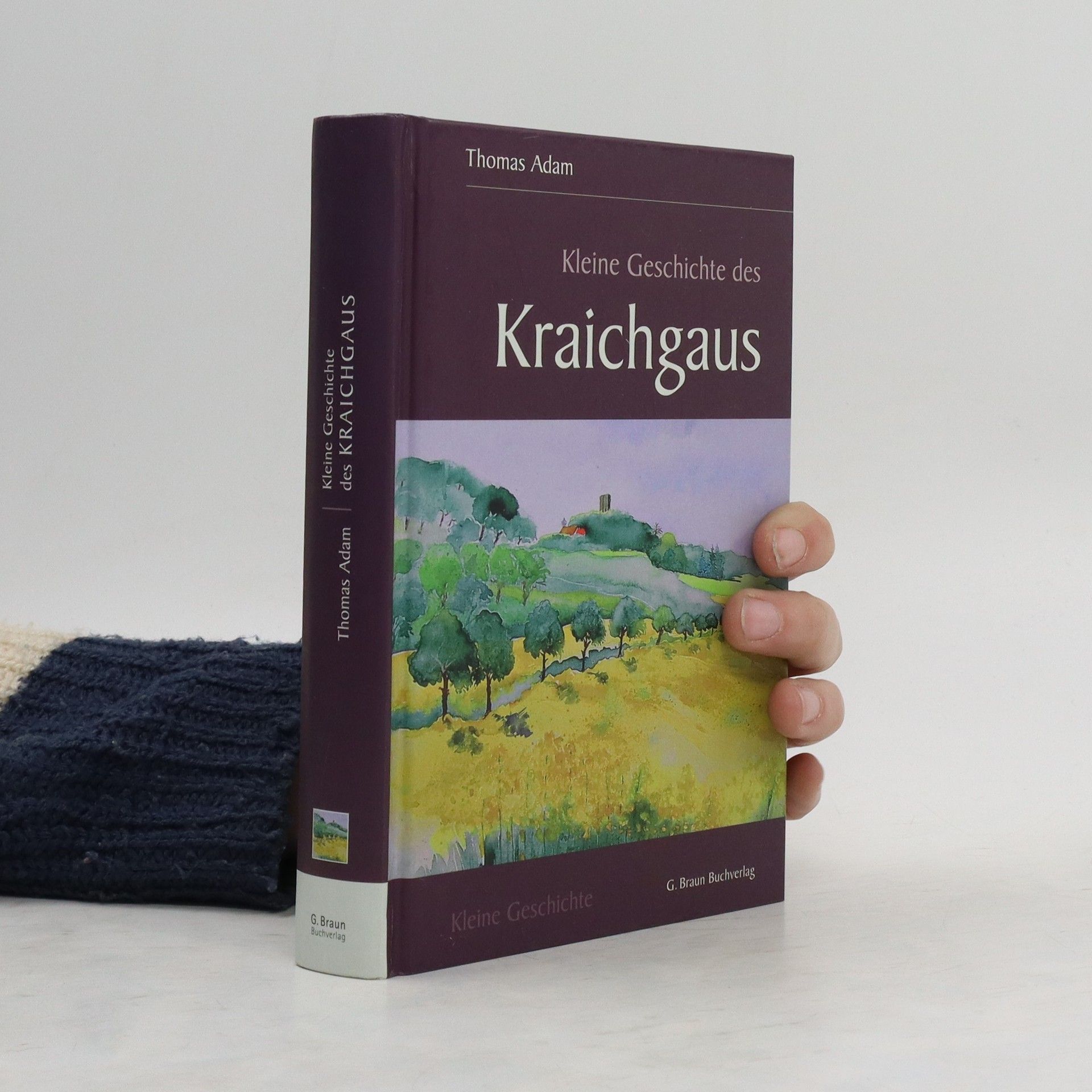
König Fußball überall: Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass ein Fußballspiel in der Liga, im Pokal oder in einem internationalen Wettbewerb stattfindet. Doch die historische Beschäftigung mit dem Phänomen Fußball ist keine Spielerei, sondern zentraler Analysegegenstand der modernen, länderübergreifenden Alltags-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtsgeschichte.Durch eine komparative Analyse der Darstellung von Fußball in verschiedenen Medien, die Rolle des Fußballs als (Hoch-)Schulsport, die historische Wahrnehmung der FIFA sowie einzelner Vereine oder bedeutender Trainer und Spieler wird die enge Verquickung zwischen Fußball einerseits sowie Gesellschaft und Politik andererseits deutlich. Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)
Deutschland in der Welt
Gesellschaft, Kultur und Politik seit 1815
Wie wirkte sich der Ausbruch des Vulkans Tambora, der 1815 im fernen Indonesien stattfand, auf die deutsche Geschichte aus? Warum hat sich die deutsche Tradition des Weihnachtsbaums im 19. Jahrhundert weltweit verbreitet? Wie gelangte das Fußballspiel in den 1870er Jahren aus Großbritannien an hiesige Gymnasien und wurde im 20. Jahrhundert zum Nationalsport der Deutschen? Kaum eine Entwicklung, die die moderne Gesellschaft in Deutschland formte, kann ausschließlich aus der deutschen Geschichte heraus erklärt werden. Thomas Adam schildert sie von 1815 bis zur Gegenwart erstmals aus einer konsequent globalgeschichtlichen Perspektive. Im Gegensatz zu anderen Überblicksdarstellungen, die sich auf den engen Raum des deutschen Nationalstaats und auf einen politikhistorischen Ansatz beschränken, bietet er eine lebendige Kultur- und Sozialgeschichte der Menschen, die in Deutschland gelebt und es geprägt haben, aber auch jener, die es verlassen haben. Historische Ereignisse und Entwicklungen, die man oft als »typisch deutsch« ansieht, erscheinen in diesem transnationalen Kontext in einem völlig neuen Licht.
Gesang der Zukunft
Gesangtherapeutische Kunst
Der Kraichgau
Eine kleine Geschichte
Die kleine Geschichte des Kraichgaus – eine Zeitreise vom Homo heidelbergensis bis zur TSG 1899 Hoffenheim. Zunächst war die Landschaft zwischen Odenwald, Schwarzwald, Neckar und Oberrheintal ein umkämpfter Durchgangsraum und politisch zersplitterter Zankapfel, entwickelte sich aber zur wichtigsten Nahtstelle des Landes Baden-Württemberg. Der Kraichgau-Experte Thomas Adam legt mit »Der Kraichgau. Eine kleine Geschichte« die überarbeitete und aktualisierte Neuauflage des beliebten Standardwerks vor – in handlichem, neuem Format und mit zahlreichen Ausflugstipps zum Erleben der Geschichte. Er skizziert die Historie dieser Landschaft von ihren Anfängen bis in die Gegenwart und geht auf die Entwicklung der Burgen, Schlösser, Kulturlandschaften, Religion sowie der Menschen in unterschiedlichen Epochen ein.
Bruchsal erlebte 2015 ein außergewöhnliches Jahr mit einer Vielzahl an Veranstaltungen, die in ihrer Fülle und Dichte einzigartig waren. Die Heimattage Baden-Württemberg, die Bruchsal ausrichten durfte, umfassten fast 400 Angebote, die auf großes Interesse stießen. Die Stadt präsentierte sich als Bühne des Bundeslandes mit ihren kulturellen und landschaftlichen Schätzen sowie ihren Bürgerinnen und Bürgern. Gelegen an der Grenze zwischen der nördlichen Oberrheinebene und dem Kraichgauer Hügelland, wurde Bruchsal zu einem „Schaufenster des ganzen Landes“ und stellte sich gemeinsam mit seinen fünf Stadtteilen einem breiten Publikum vor. Der beeindruckende Veranstaltungsreigen hinterlässt viele Erinnerungen und Bilder in der Stadt. Besonderer Dank gebührt den Fotofreunden Heidelsheim, die unermüdlich zahlreiche Veranstaltungen dokumentierten und viele Stunden ihrer Zeit investierten. Ihre Fotos werden ein bedeutendes Stück Erinnerung an die Heimattage 2015 bleiben und spiegeln wider, was diese Hunderte von Veranstaltungen in Bruchsal bewegt haben. Der vorliegende Bildband bietet einen kleinen Einblick in die Vielfalt der Ereignisse und der dabei entstandenen Aufnahmen.
Joß Fritz, ein Bauernführer des frühen 16. Jahrhunderts, mobilisierte sowohl Obrigkeiten als auch Untertanen und verkörperte das Streben nach „Gerechtigkeit“ und „Freiheit“. Geboren um 1470 in Untergrombach, ist er bis heute ein Symbol bäuerlich-revolutionärer Kraft, besonders im südbadischen und elsässischen Grenzraum. Anlässlich des 500. Jahrestags der Untergrombacher Bundschuhverschwörung von 1502 würdigte die Stadt Bruchsal sein Leben und Wirken in einer Reihe von Veranstaltungen. Der Jahrestag bietet auch Anlass für eine längst überfällige Lebensbeschreibung von Joß Fritz. Die Resonanz in der Tagespresse zeigt, dass das Thema über lokale Grenzen hinaus großes Interesse weckt. Trotz seiner Popularität fehlte bisher eine umfassende, moderne Bearbeitung seines Lebens. Der Autor Thomas Adam schließt diese Lücke mit seinem 320 Seiten umfassenden, reich bebilderten Werk. Er verknüpft anschaulich die großen Fragen der Übergangszeit vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit mit den Lebensnöten einfacher Menschen. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen, oft unbekannten Bilddokumente, die das Buch zu einem spannenden Lesebuch und unverzichtbaren Nachschlagewerk machen.
Genossenschaftliches Wohnen in Sachsen
Von den Anfängen bis 1933