Welche Auswirkungen hatte die Wende auf die Karrierechancen von ostdeutschen Wissenschaftlerinnen? Verschlechterten sich insbesondere für Frauen aus den neuen Bundesländern die Berufs- und Aufstiegsmöglichkeiten? Heike Amos untersucht am Beispiel von Physikerinnen erstmalig, welche Folgen der Transformationsprozess für Wissenschaftlerinnen hatte. Die Umbrüche, so ein Ergebnis, trafen Physiker und Physikerinnen zunächst gleichermaßen, erst nach 2000 wurde die Physik in den neuen Bundesländern wieder "männlicher und westdeutscher". Anhand von vielen ungedruckten Dokumenten aus zwölf Archiven und eigens geführten Interviews mit Physikerinnen zeichnet Heike Amos die Berufswege der Wissenschaftlerinnen nach und erstellt eine "Gruppenbiographie". Zu den bedenkenswerten Aussagen der Befragten gehört, dass sie - obwohl der Herbst 1989 von ihnen mehrheitlich als politisch befreiend erlebt wurde - die Jahre nach der Wende negativ erinnern. Sie nahmen diese Zeit als belastend, enttäuschend und undemokratisch wahr.
Heike Amos Bücher
1. Jänner 1962
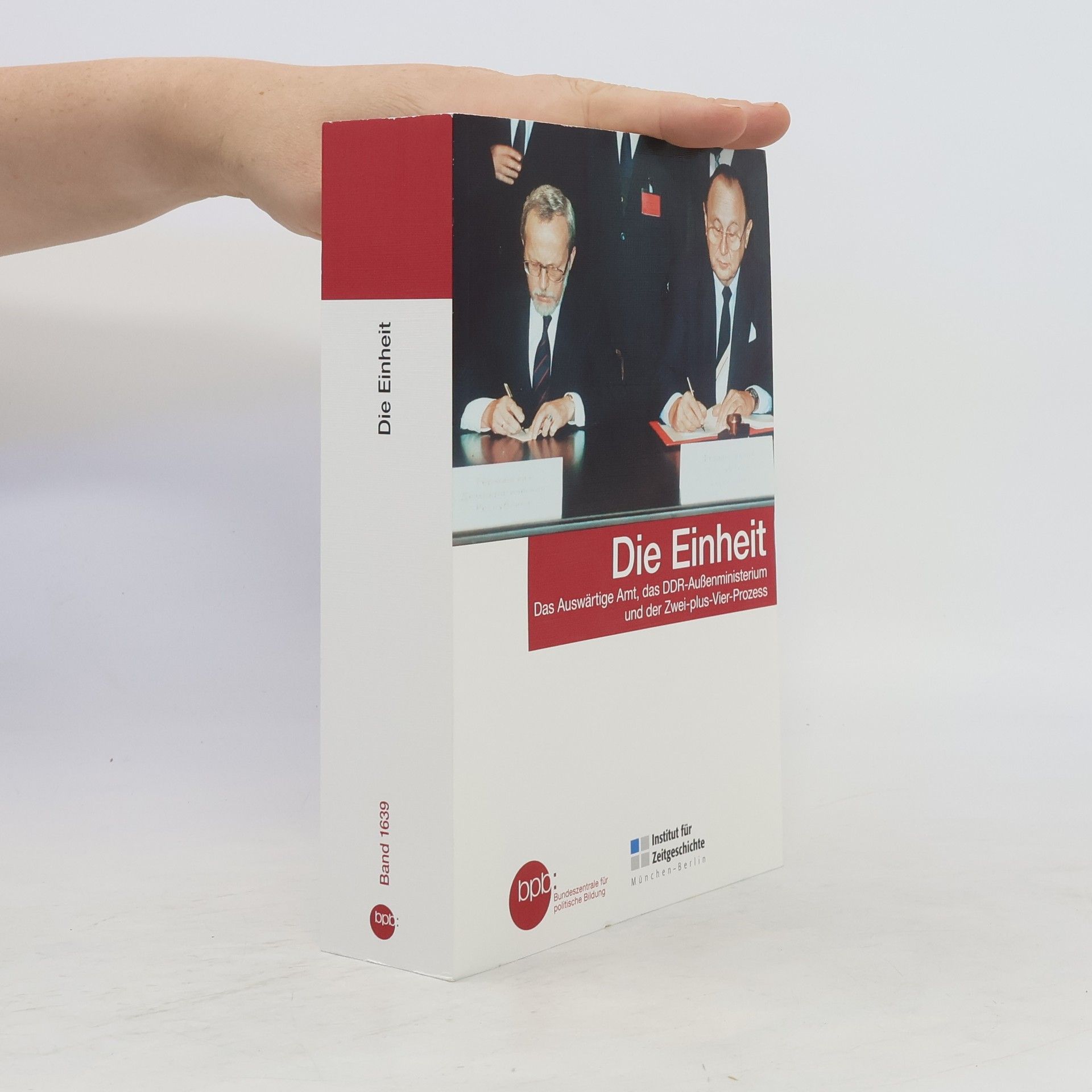

Die Einheit
Das Auswärtige Amt, das DDR-Außenministerium und der Zwei-plus-Vier-Prozess
- 834 Seiten
- 30 Lesestunden
Deutschlands Einheit 1989/90 veränderte die Welt: Wie kein anderes Ereignis markiert sie das Ende des Kalten Krieges. Zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung legt das Institut für Zeitgeschichte München–Berlin eine leserfreundliche Edition auf höchstem wissenschaftlichen Niveau vor: 170 bisher unveröffentlichte, vorzeitig freigegebene Dokumente des Auswärtigen Amts und des DDR-Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, vorwiegend aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amts, lassen die dramatischen Umbrüche lebendig werden: von den Botschaftsflüchtlingen ab Sommer 1989 bis zur staatlichen Einheit im Herbst 1990.