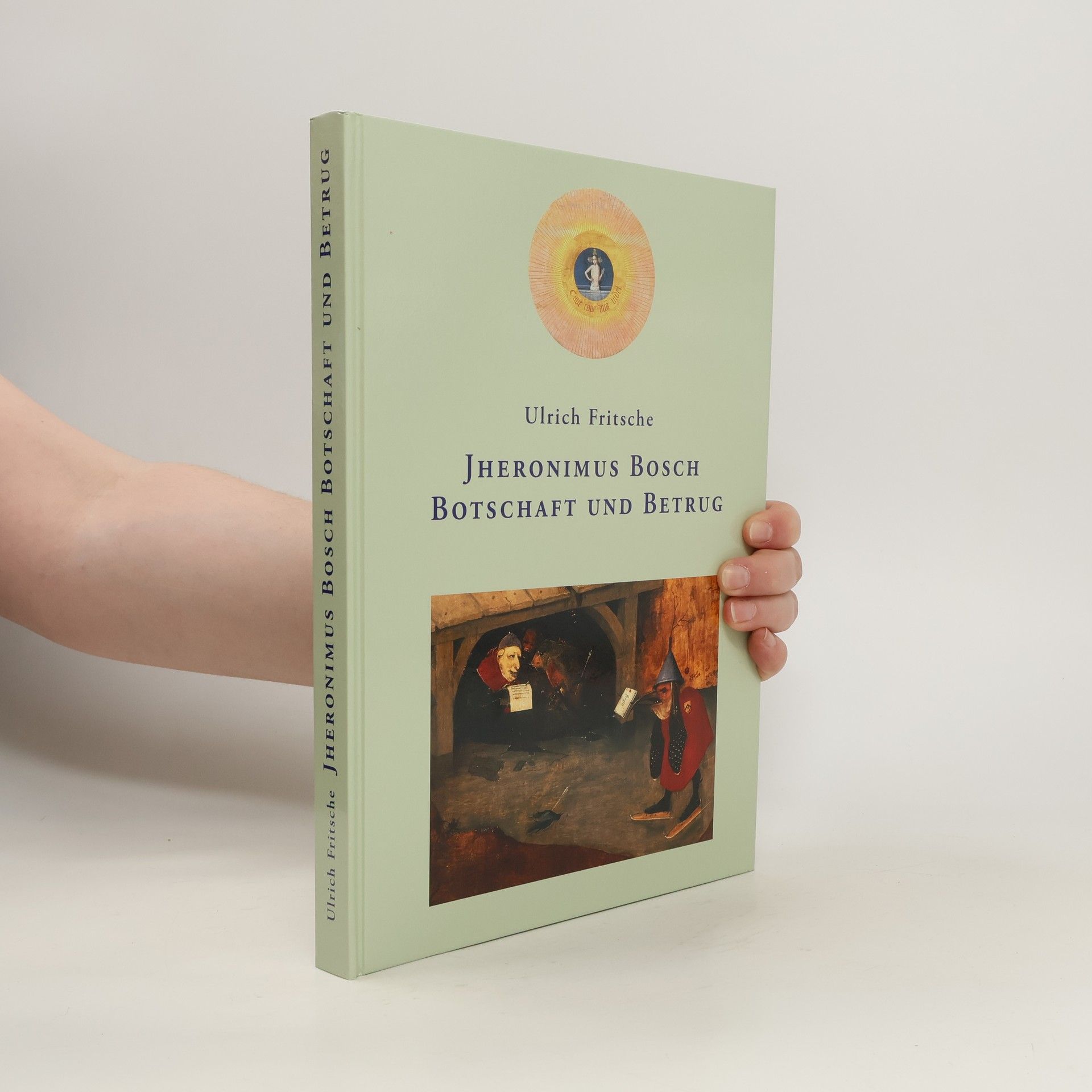Jheronimus Bosch - Botschaft und Betrug
- 231 Seiten
- 9 Lesestunden
Der Maler Jheronimus Bosch lebte an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit und gilt als Meister des Phantastischen. Seine seltsamen Figuren irritieren, doch sie sind genau durchdacht. Bosch hatte eine brisante Botschaft, die er symbolisch verschlüsseln musste, um sich und sein Werk zu schützen. Bis heute haben nur wenige seine Geheimnisse erfasst. Er veranschaulichte subtile Gedankengänge mithilfe eines neuplatonischen Symbolsystems, das sich aus seinen Werken ableiten lässt. Alles, auch Pflanzen und Tiere, verweist auf Menschen. Was monströs erscheint, ist Ausdruck von Fehlverhalten. Bosch prangerte Habgier, Gewalt, Täuschung, Dummheit und Dünkel an und zeigte, wie die „frohe Botschaft“ des Christentums verfälscht wurde. Er wollte einer besseren Zeit den Weg bereiten. Umfassende Erläuterungen zu Werken wie dem „Garten der Lüste“ und den „Versuchungen des hl. Antonius“ finden sich in zwei Büchern von Ulrich Fritsche. Der dritte Band deckt den überraschenden Sinngehalt von 17 weiteren Gemälden auf und erlaubt ein Resümee: Bosch ist weitgehend enträtselt! Seine einzigartige Symbolik, raffinierte Bildkompositionen und eine hoffnungsvolle Weltanschauung verdienen es, in ihrer wahren, verborgenen Bedeutung gewürdigt zu werden.