Victor Stoichita Bücher

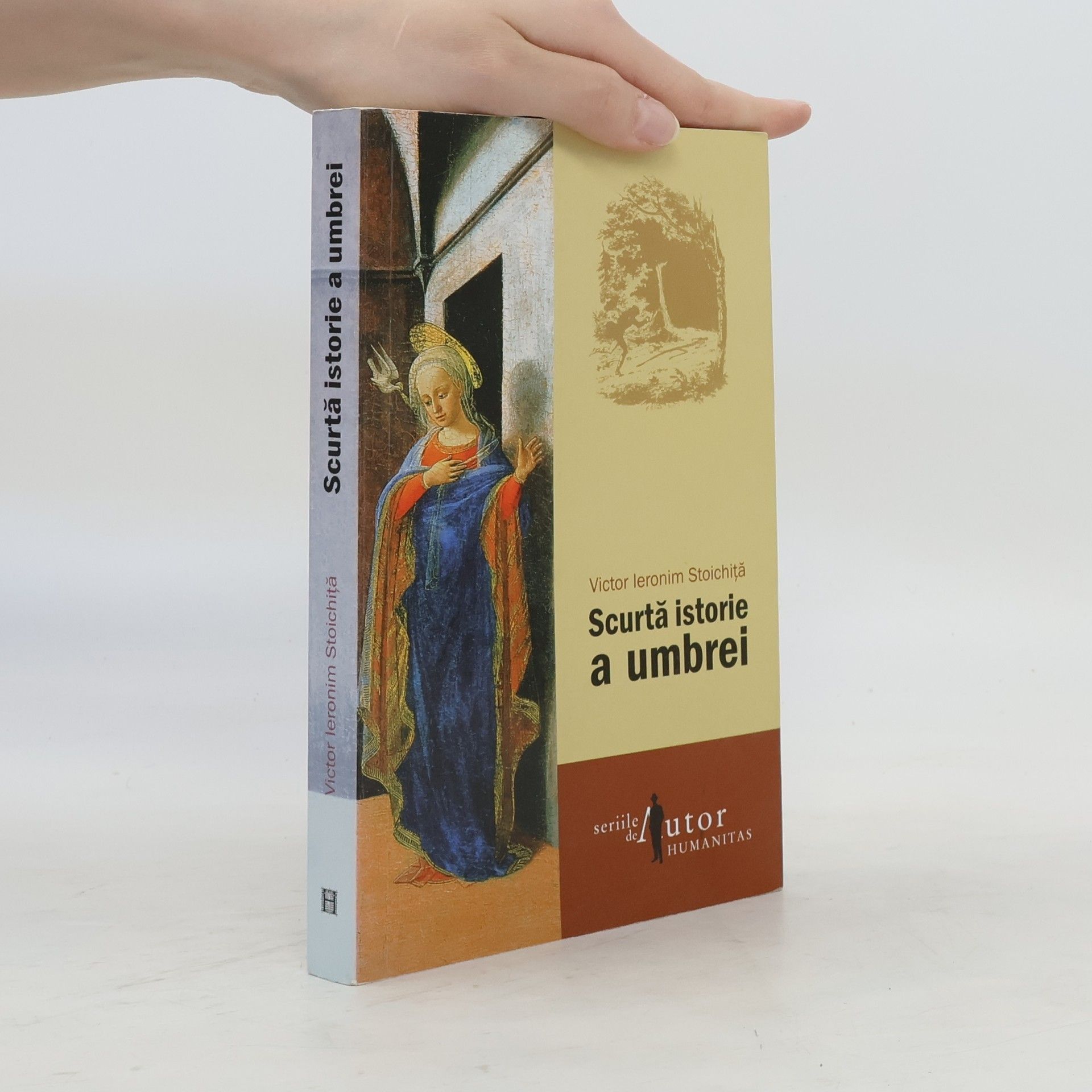
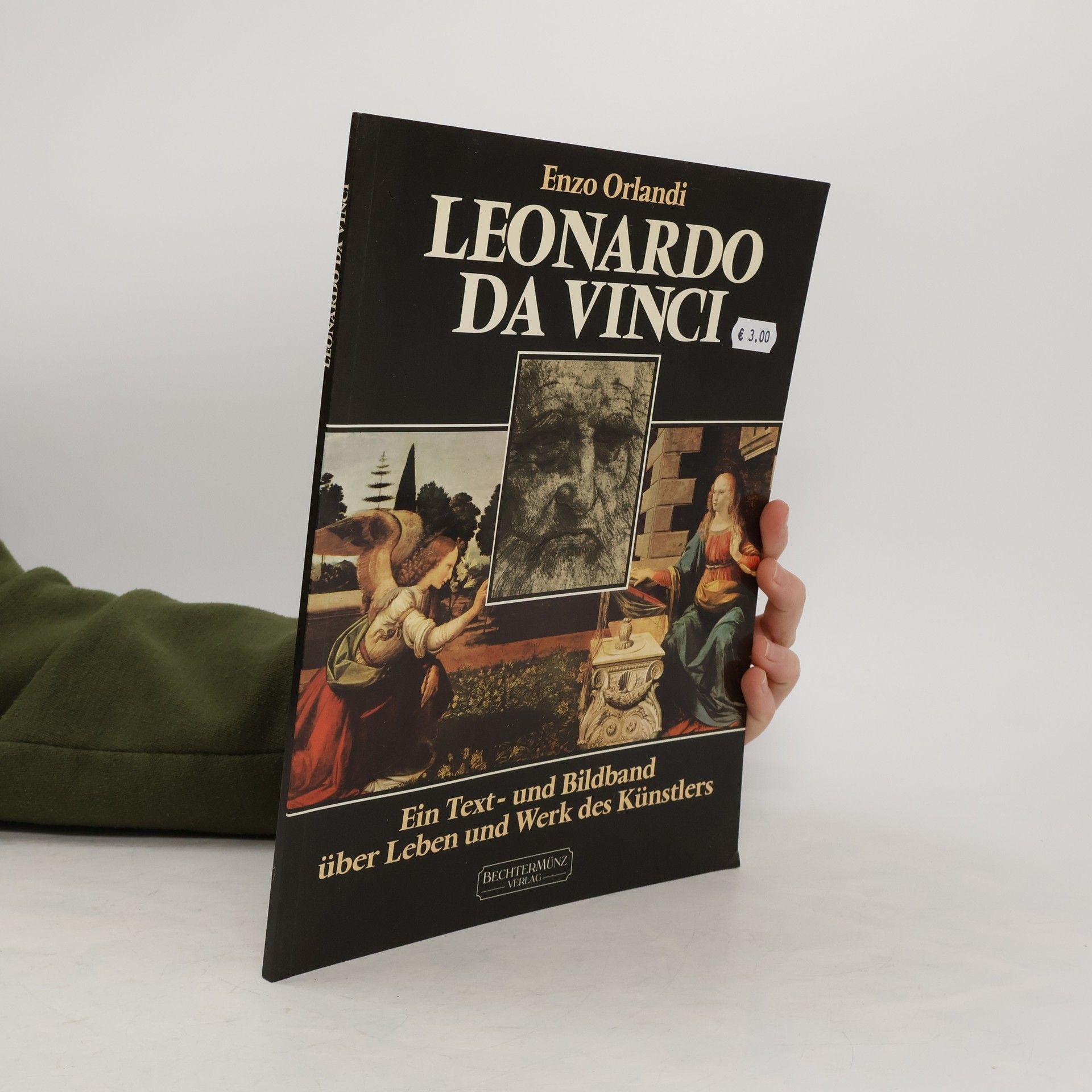

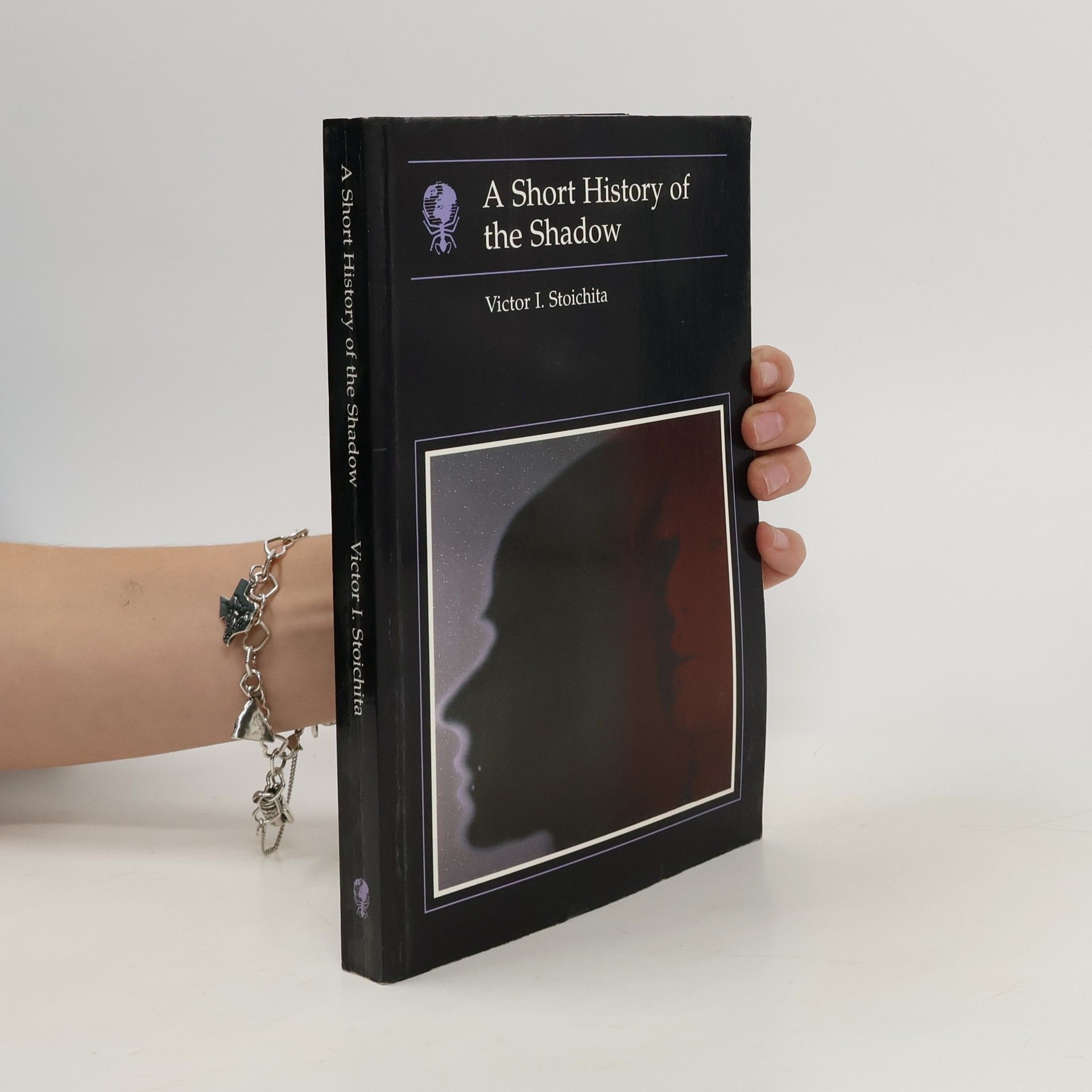

Short History of the Shadow
- 264 Seiten
- 10 Lesestunden
An investigative tour de force. It untangles the history of one of the most enduring technical and symbolic challenges to beset Western artists - the depiction and meanings of shadows.
Victor I. Stoichitas Neuinterpretation eines der berühmtesten und zugleich rätselhaftesten Gemälde der italienischen Renaissance, Vittore Carpaccios »Vision des Heiligen Augustinus«, ist aufsehenerregend. Carpaccio (um 1465–1525) schuf das Gemälde zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Teil eines Ausstattungszyklus zu Ehren des Heiligen Hieronymus in der Scuola degli Schiavoni in Venedig. Wie es Carpaccio vermochte, ein telepathisches Wunder im Medium Malerei wiederzugeben, verdeutlicht Stoichita hier nicht nur, indem er Klarheit in die komplexe Ikonographie des Gemäldes bringt, die Textgrundlage einer Re-Lektüre unterzieht und das dichte Gewebe an Verbindungslinien zwischen geschriebener und gemalter Erzählung darlegt. Seine Interpretation des Bildes verändert auch entscheidend die Sicht auf das Programm und den Sinn des Gemäldezyklus im Ganzen. Das Buch entstand im Rahmen der Panofsky-Professur am Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, die Victor I. Stoichita im Jahr 2016 innehatte.
Obraz we właściwym sensie tego słowa jest pojęciem stosunkowo nowym. W stosunku do dawnych wyobrażeń, związanych z określonym miejscem i funkcją sakralną, obraz jest przedmiotem, którego nie definiujemy ani w odniesieniu do liturgii, ani do stałego miejsca ekspozycji. Jego pojawienie się u schyłku epoko renesansu uznawane jest za najistotniejsze wydarzenie w historii sztuki zachodniej. Głównym celem niniejszego studium jest ukazanie procesu, poprzez który metamalarskie zabiegi przyczyniły się do stworzenia kondycji sztuki nowoczesnej. Narodziny obrazu zbiegają się z ukształtowaniem się świadomości malarstwa jako takiego, z narodzinami „nowoczesnej” koncepcji artysty. Zjawisko ustanowienia obrazu jest ostatecznie efektem ostrej konfrontacji nowego wyobrażenia z jego własnym statusem, z jego własnymi granicami. „Ustanowienie obrazu”, książka uznana za jedno z większych osiągnięć historii sztuki ostatnich lat oraz jako wyznacznik możliwości odnowy badań w tej dziedzinie, przetłumaczona na wiele języków, ale od dawna niedostępna, jest prezentowana obecnie w wydaniu poprawionym i uaktualnionym przez autora.