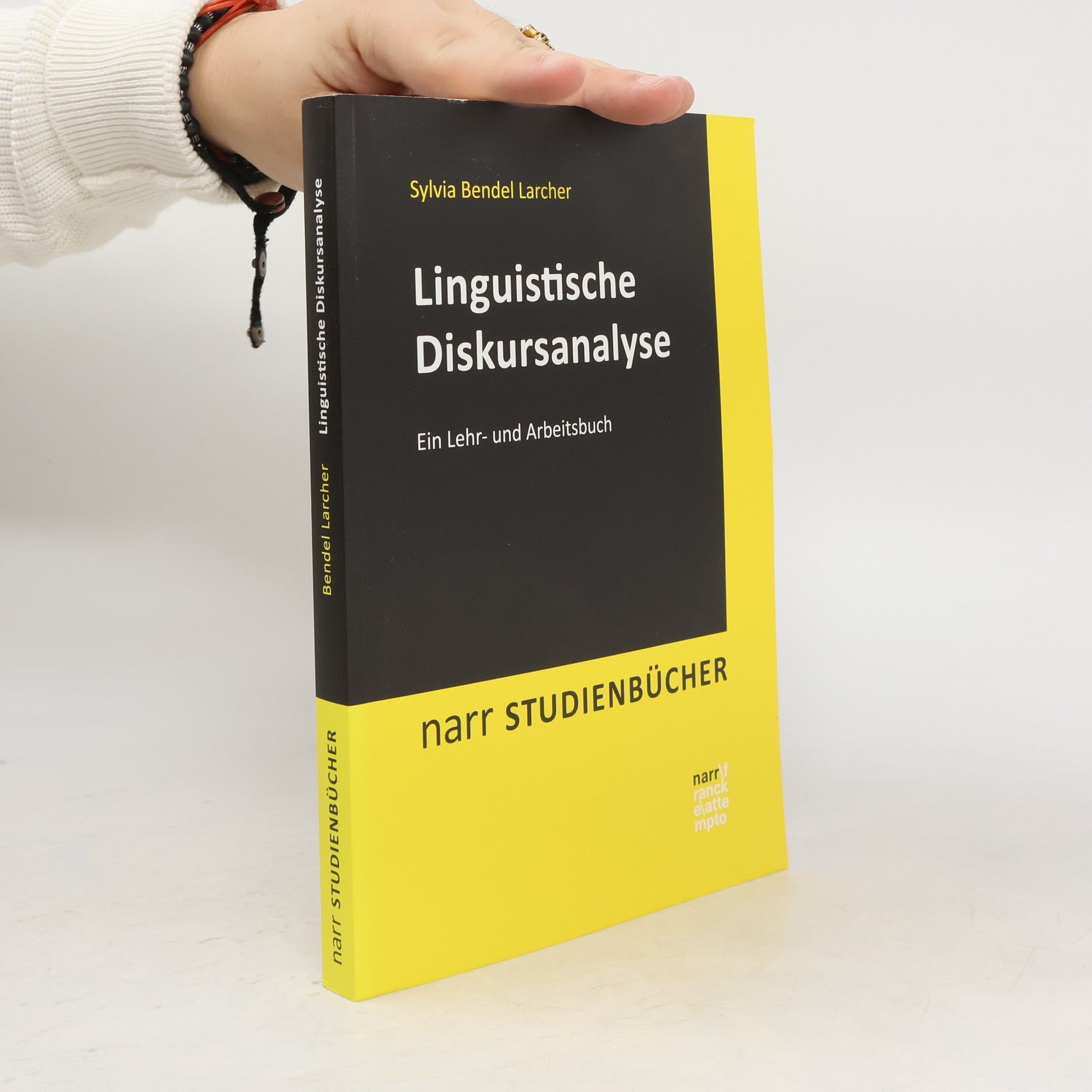Good practice in der institutionellen Kommunikation
Von der Deskription zur Bewertung in der Angewandten Gesprächsforschung
Der Themenband widmet sich der Frage, wie man in institutionellen Gesprächen Formen gelingenden sprachlichen Handelns identifizieren kann. Drei theoretisch-methodisch ausgerichtete Beiträge diskutieren, was Bewertungsgrundlagen dafür sind, wie man diese empirisch erheben kann und wie good practice im Gespräch zu identifizieren ist. Sieben empirisch ausgerichtete Beiträge arbeiten analytisch konkrete Formen von good practice für verschiedene institutionelle Settings heraus, vom Bildungs- und Gesundheitswesen über die Privatwirtschaft bis zur rechtlichen Betreuung. Das Schlusskapitel fasst die Erträge der in enger Kooperation entstandenen Beiträge in systematischer Form zusammen. Der Themenband bildet dadurch den gegenwärtigen State of the Art der noch jungen Forschung zu good practice in der Angewandten Gesprächsforschung ab.