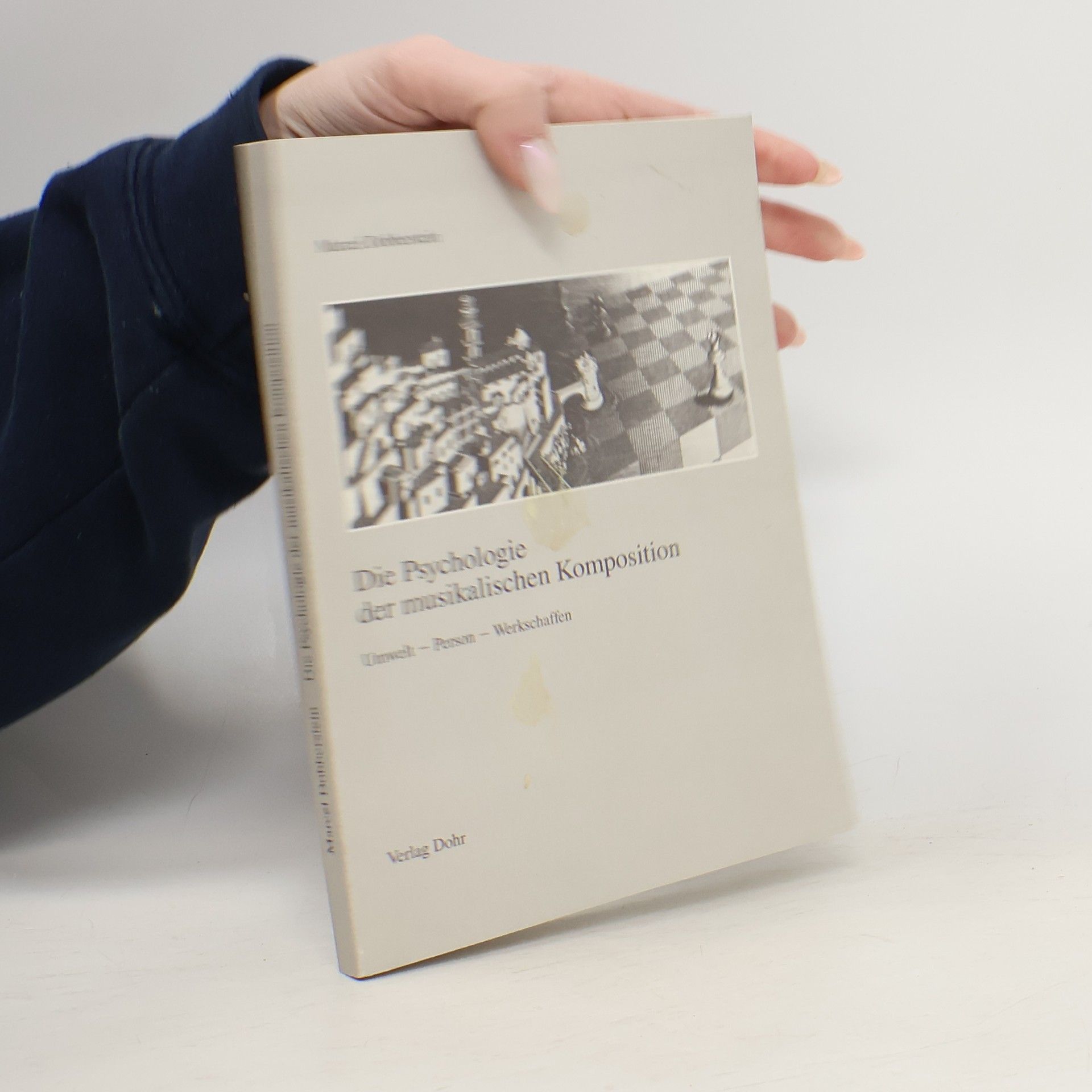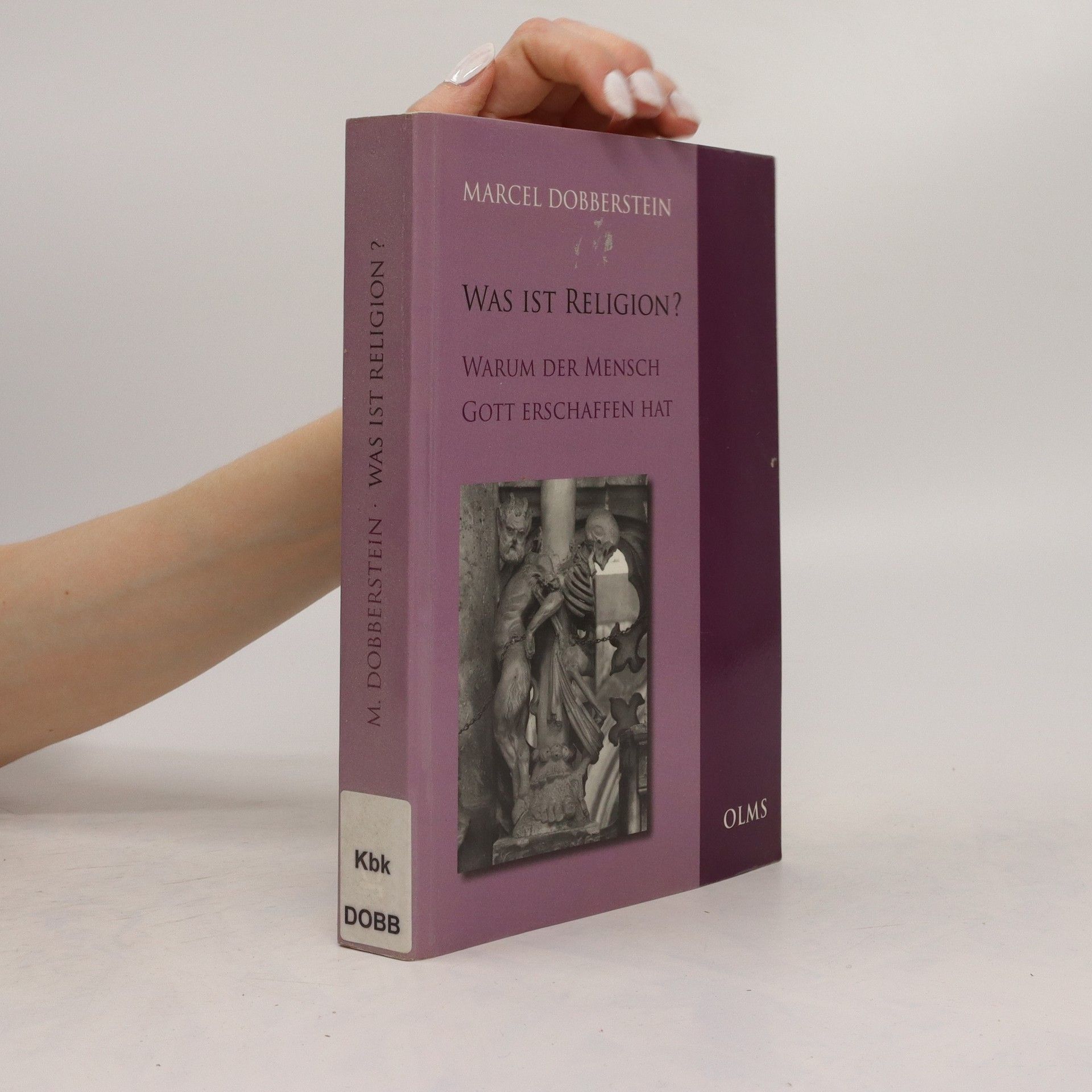Was ist Religion?
- 345 Seiten
- 13 Lesestunden
Ja, Herr Nietzsche und auch Herr Freud: Die Menschheit hat sich in der Religion eine Sammlung törichter Märchen erschaffen. Gott ist nicht der Hüter des Erhabenen, sondern des Dunklen und Zaghaften im Menschen. Der Mensch hat Gott geschaffen, um den Tod und den Teufel zu besiegen, um Macht über andere zu erlangen und um die Träume vom absoluten Leben zu unterstützen. Dieser Gigant ist launisch. Selbst der sorglose Gott der „Nächstenliebe“ ist nur dem schlichten Gemüt bekannt. Vor Gottes Zorn bleibt nichts verschont. „Die Hölle ist eine schwache Vorstellung, die uns Gott unfreiwillig von sich selbst gibt“ (Bataille). Religion zieht den Tod ins Leben und ist ein Schrei nach Liebe aus Mangel daran. Ein Wahn der Omnipotenz kämpft gegen die Individuation und formt einen „paranoiden Zug, der unserer Spezies endemisch ist“ (Koestler). Das Gespensterspiel in seinen tausend Varianten hat in der Gesellschaft noch Realität. Es ist ein Skandal, dass „unerbittliche Feinde der Denkfreiheit und des Fortschritts zur Erkenntnis der Wahrheit“ (Freud) Einfluss in Öffentlichkeit, Wissenschaft und Erziehung behalten. Ein Grund dafür ist die weit verbreitete Verkennung des Wesens der Religion.