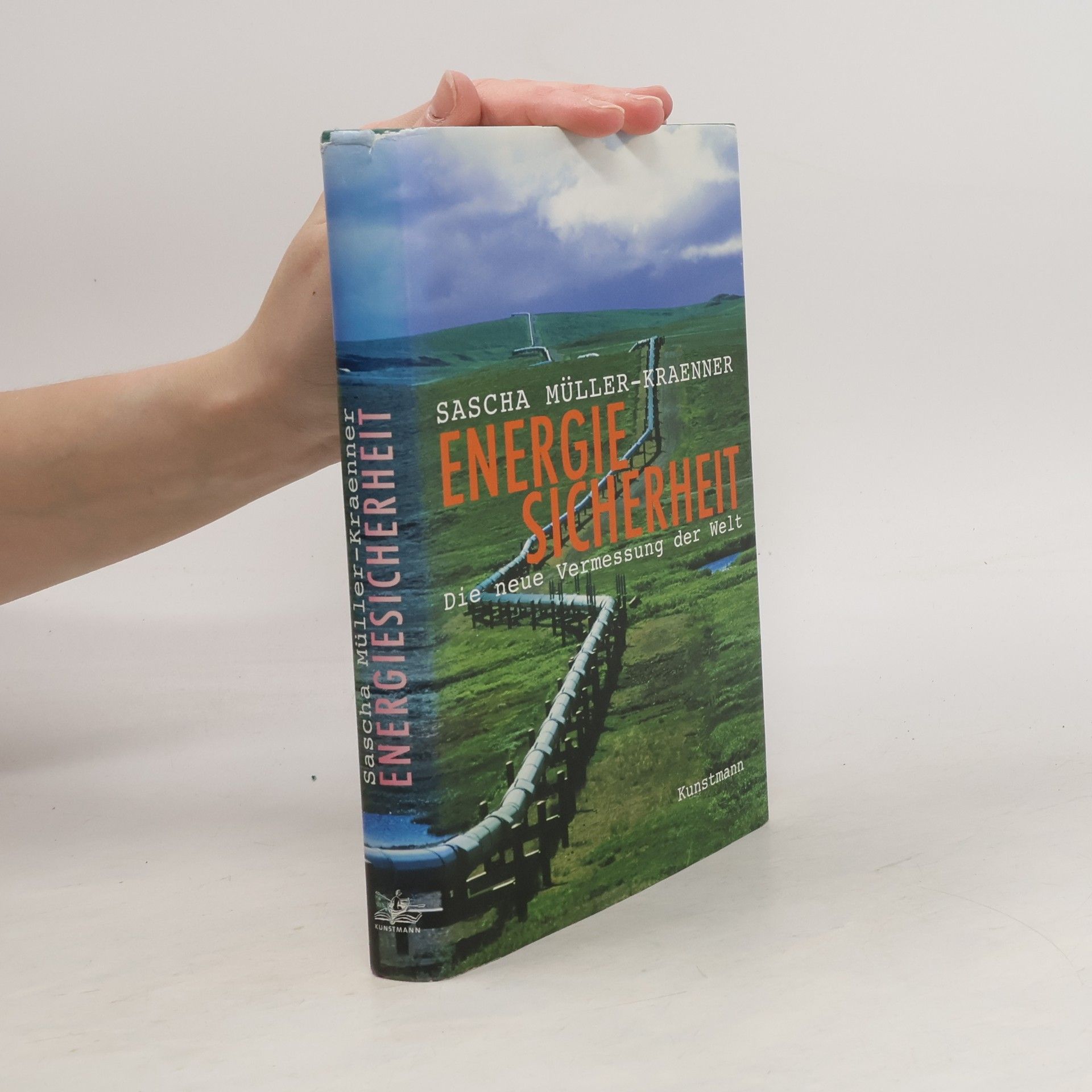Energiesicherheit
- 238 Seiten
- 9 Lesestunden
Beim Run auf die letzten Energieressourcen wird derzeit die Welt neu vermessen. Die internationalen Machtverhältnisse verschieben sich entlang der Frage, wer die Ressourcen und den Zugang zum Weltmarkt kontrolliert. Das neue Sorgenkind der Weltgemeinschaft heißt Energiesicherheit. Der Begriff meint nicht nur die sichere und bezahlbare Versorgung mit Energie, sondern eine Politik, die im Kampf um Rohstoffe nicht neue Konflikte schafft und die Umwelt schädigt. Gibt es eine Alternative zu der gefährlichen Großmachtpolitik, die Länder wie China, die USA und Russland derzeit verfolgen? Als Antwort auf die weltweite Energiekrise plädiert Müller-Kraenner für eine kooperative Energiepolitik im europäischen Rahmen, die unsere Wirtschaft mit Energie aus unterschiedlichen Quellen versorgt: bezahlbar, umweltfreundlich, sicher.