Wolfgang Mitsch Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
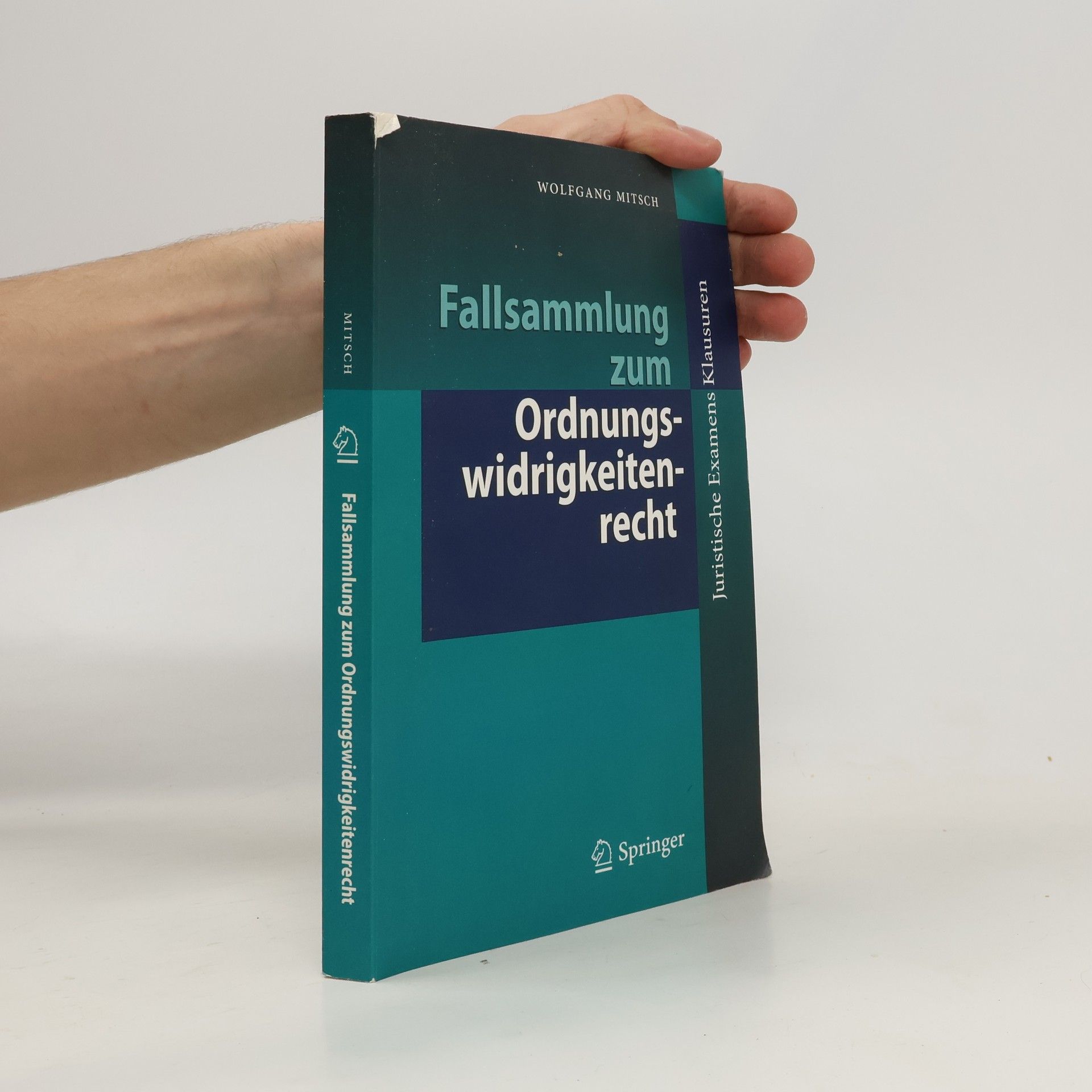



Die klare und verständliche Darstellung der examensrelevanten Fragestellungen steht im Mittelpunkt dieses Lehrbuchs. Durch ein bewährtes didaktisches Konzept wird die Materie nachhaltig eingeprägt, während wertvolle Impulse zur eigenständigen Reflexion gegeben werden. Zudem behandelt das Buch strafrechtsrelevante Fragen im Kontext der Corona-Pandemie, was es besonders aktuell und relevant macht.
Strafrecht in der Examensklausur
- 600 Seiten
- 21 Lesestunden
Fallsammlung zum Ordnungswidrigkeitenrecht
- 250 Seiten
- 9 Lesestunden
Mit Einführung der „Schwerpunktbereiche“ in die universitäre Juristenausbildung hat das Interesse für das Ordnungswidrigkeitenrecht an den Juristenfakultäten deutlich zugenommen. Studierende, mit strafrechtlichem Schwerpunktbereich haben wachsenden Bedarf an Lern- und Übungsmaterialien zu diesem Rechtsgebiet. Die Fallsammlung leitet den Benutzer dazu an, die erworbenen Rechtskenntnisse in die praktische Bearbeitung realitätsnaher anschaulicher Rechtsfälle umzusetzen. Darüber hinaus festigt der Leser durch die intensive fallbezogene Beschäftigung mit dem Ordnungswidrigkeitenrecht sein vorhandenes Wissen und bestehende Wissenslücken werden geschlossen. Die Fähigkeit zur angemessenen sprachlichen Darstellung juristischer Gutachten, Entscheidungen und Problemlösungen werden geschult.