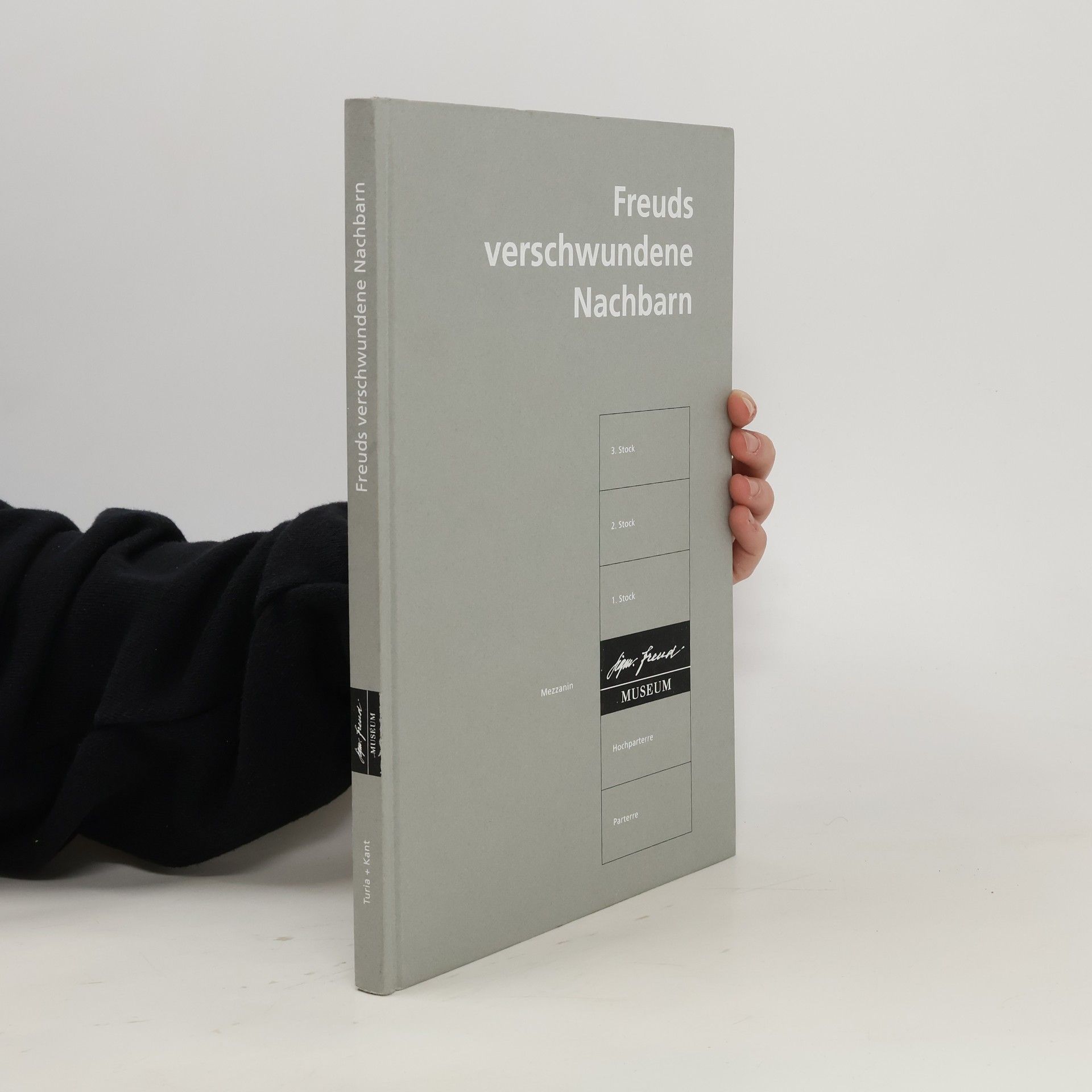Die Couch
- 239 Seiten
- 9 Lesestunden
Ein simples Möbelstück hat sich zum Synonym für die Psychoanalyse entwickelt. Das Buch folgt den Bedeutungsebenen dieses Alltagsgegenstandes und beleuchtet mit den Mitteln von Wissenschaft, Kunst und Literatur die Gedankenräume, die im Liegen entstehen. Dem Wiener Nervenarzt Sigmund Freud ging es vor allem um die Analyse von Assoziationen und Phantasien, die in dieser entspannten Haltung ans Licht kommen. Aus der Sicht der Couch hinterfragt das Buch den aktuellen Stand der Psychoanalyse und den heutigen Stellenwert der Couch. Eine ungewöhnliche Publikation, die das Phänomen Freud aus einem völlig neuen, horizontalen Blickwinkel betrachtet.