Die litauisch-amerikanische Pädagogin Tonja Soloveitchik, geborene Lewit, (1904–1967) ist eine Zeitzeugin der Geschichte jüdischer Diaspora in Litauen, Deutschland und in den USA. Aufgewachsen in einer religiösen Familie inmitten von Wilna, dem „Jerusalem des Nordens“, promovierte sie an der Universität Jena und war an der Seite ihres Ehemannes, Rabbi Joseph Ber Soloveitchik (1903–1993), Gründerin einer modern-orthodoxen Schule für Mädchen und Jungen in Bosten. Der vorliegende Band enthält die 1931 erschienene Dissertation von Tonja Lewit über die nur wenig bekannte Geschichte der jüdischen Schule in Polen. Begleitet wird die Wiederveröffentlichung dieser Schrift von Tonja Lewit durch einen Beitrag über ihre Studienzeit in Jena, ein Lebensbild, verfasst von ihrer Tochter Tovah Lichtenstein, und eine Würdigung ihrer Lebensleistung von Landesrabbiner Zsolt Balla, Vorstandsmitglied der „Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland“ (ORD). Mit einem biographischen Beitrag von Tovah Lichtenstein
Michael Wermke Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
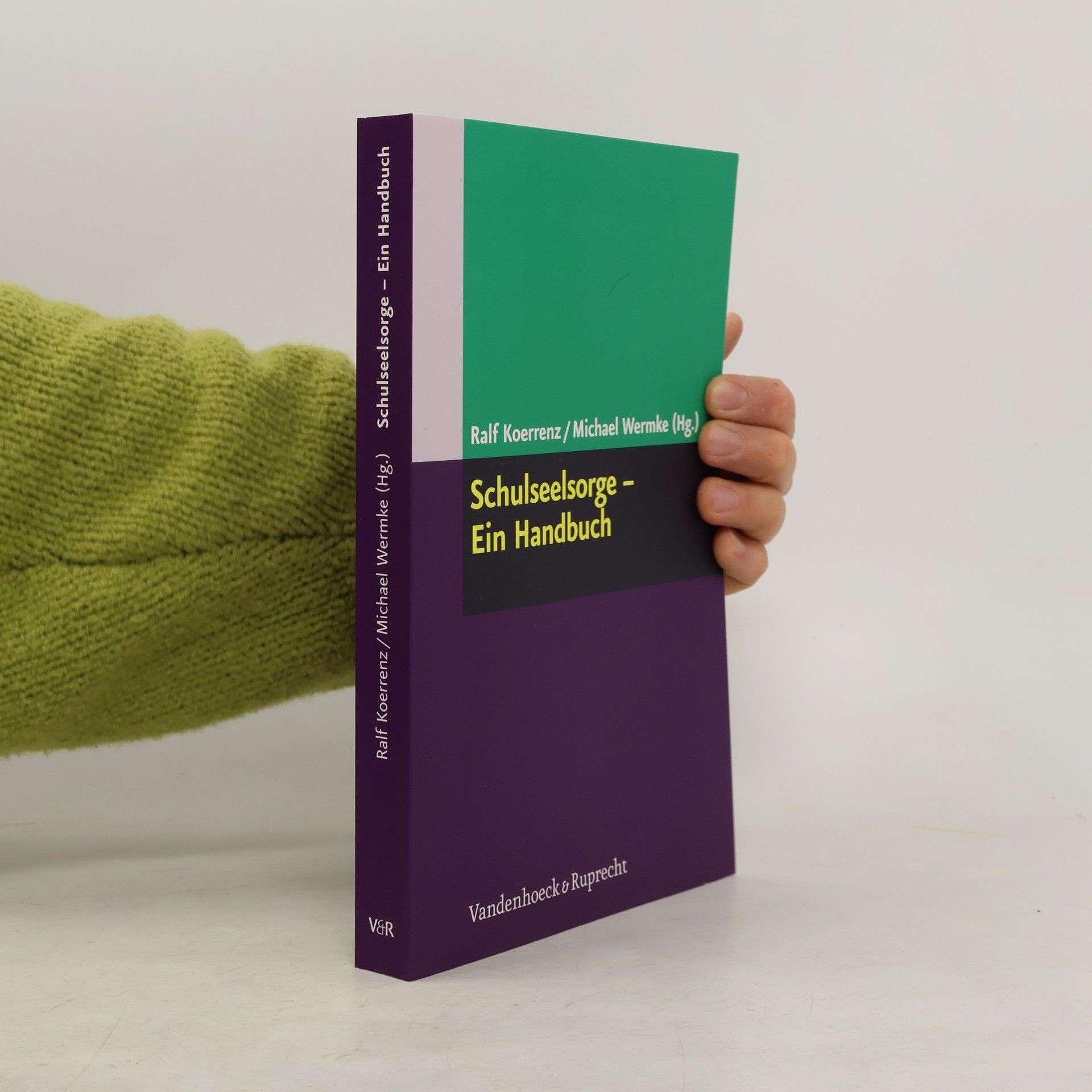


Ein letztes Treffen im August 1941
Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik
Insbesondere auf Schule als Lebensraum beziehen sich die vielfältigen Praktiken der Schulseelsorge. Schule ist aus Sicht der beteiligten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen immer weit mehr als 'nur' Unterricht. Im Handbuch Schulseelsorge werden entsprechende Handlungsräume und Konfliktsituationen untersucht sowie Praxismodelle und Erfahrungsfelder beschrieben. Ausgewiesene Experten analysieren die Grundlagen und elementaren Strukturen von Schulseelsorge und bieten in ökumenischer Offenheit grundlegende Orientierungen für Theorie und Praxis auf diesem wichtigen gemeinsamen Gebiet von Schule und Kirche.