Gefragt nach Stuttgarts Wahrzeichen, fällt einem mit Sicherheit als erstes der Fernsehturm ein, zudem Altes und Neues Schloss, Staatsgalerie, der Bahnhofsturm und natürlich die Grabkapelle auf dem Rotenberg. Doch die Stadt und ihre Vororte bieten noch viel mehr bemerkenswerte Kulturdenkmale von der Vor- und Frühgeschichte bis zur Postmoderne. Kennen Sie z. B. das IBM-Areal in Vaihingen oder den Wohnkomplex „Romeo und Julia“ in Zuffenhausen-Rot? Oder wussten Sie, dass in der Mühlhausener Veitskapelle die am besten erhaltenen Wandmalereien des Mittelalters in Baden-Württemberg zu finden sind? 16 Themenkapitel laden mit zahlreichen Abbildungen in thematischen Essays und Beschreibungen dazu ein, die beeindruckende architektonische Überlieferung der Landeshauptstadt zu erkunden. Dabei reicht das Spektrum von steinzeitlichen Hinterlassenschaften über Bauten für Wirtschaft, Kultur, Verkehr, Produktion sowie Lehre und Forschung bis zu Wohnbauten und den religiösen Orten Stuttgarts.
Christian Ottersbach Bücher
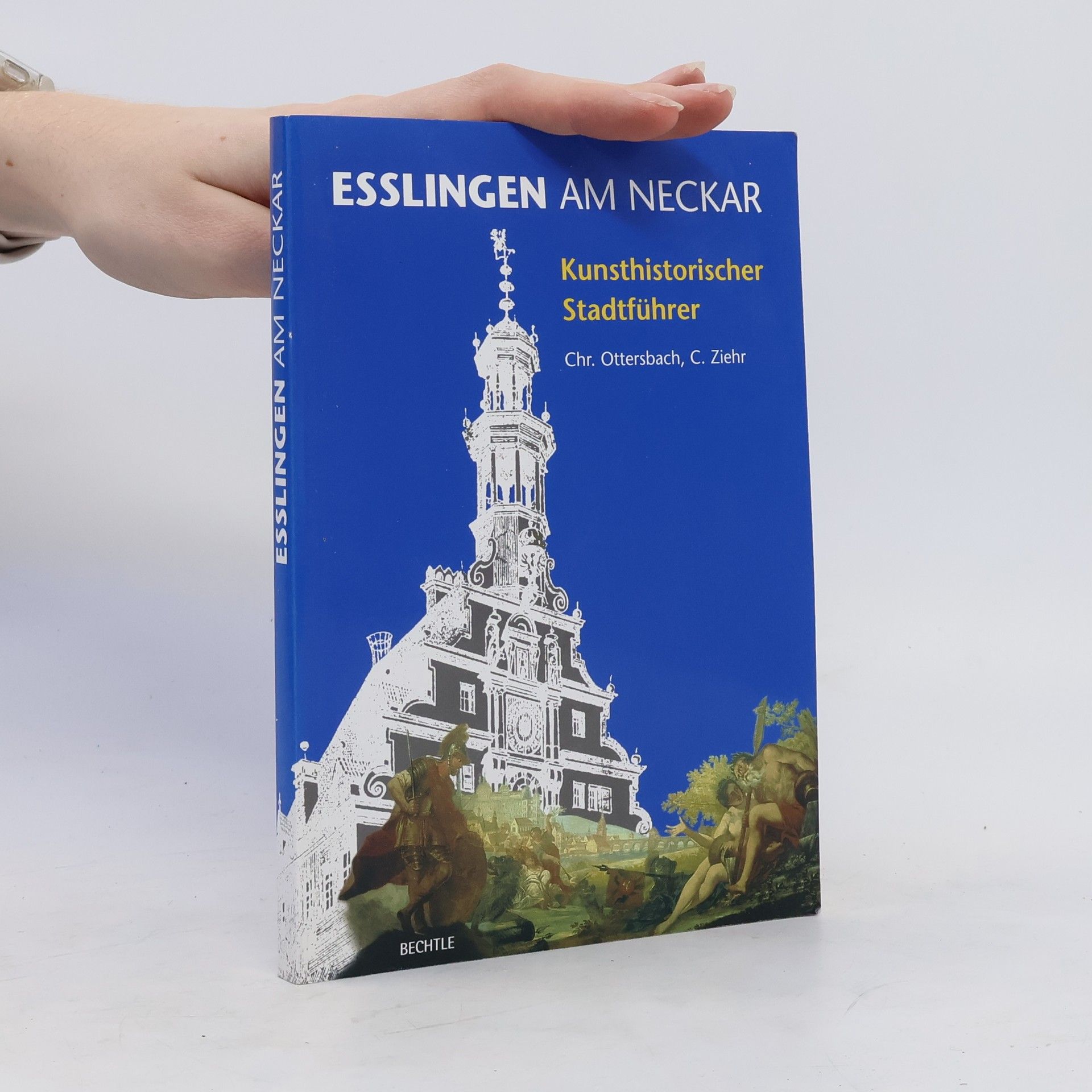
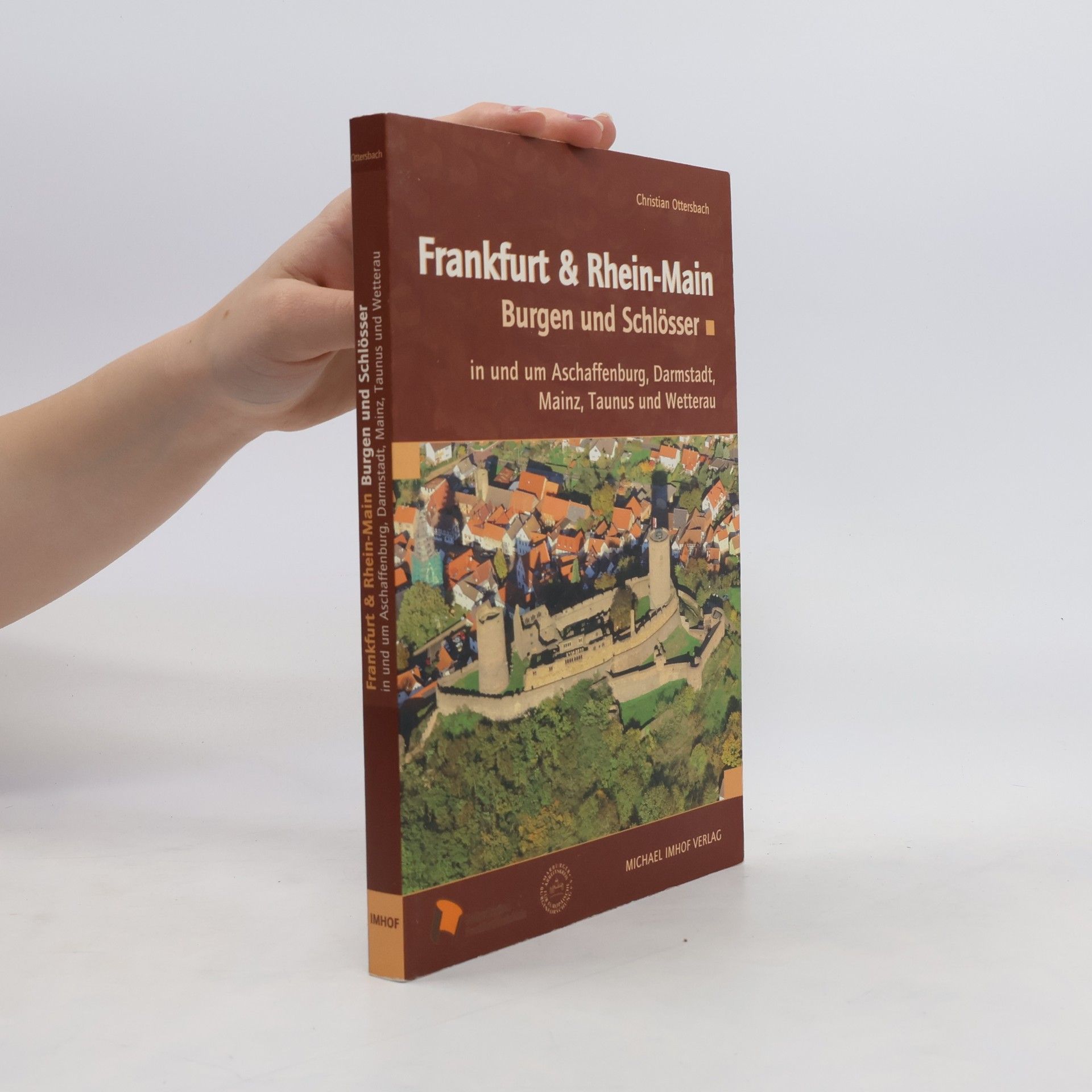


Festungen in Baden-Württemberg
- 240 Seiten
- 9 Lesestunden
Baden-Württemberg bildete in Spätmittelalter und früher Neuzeit einen bunten Flickenteppich vieler Territorien. Entsprechend reich ist der Bestand an historischen Wehrbauten. Fast jeder Landesherr modernisierte spätestens seit dem 16. Jahrhundert eine seiner Burgen und baute sie zur Landesfestung aus.
Im Großraum Rhein-Main liegt eine Fülle alter Burgen, Schlösser und Herrensitze. Darunter sind so bekannte Anlagen wie Burg Münzenberg in der Wetterau, die Festung Königstein oder Schloss Friedrichsburg in Bad Homburg v. d. Höhe. Die große Vielzahl der Objekte findet ihre Erklärung in der einstigen territorialen Zersplitterung des Rhein-Main-Gebietes. Die Kurfürsten und Erzbischöfe von Mainz sowie diverse Grafen- und Herrengeschlechter konkurrierten seit dem Hochmittelalter um die Vorherrschaft in der Region. Ihre Burgen und Schlösser legen Zeugnis ab von ihren Gebietsansprüchen und ihrem Repräsentationsbedürfnis. Unter den Bauten finden sich Spitzenwerke des romanischen Profanbaus, so die Kaiserpfalz in Gelnhausen oder die Burg Münzenberg, aber mit den Schlössern in Offenbach und Aschaffenburg auch Höhepunkte deutscher Renaissancebaukunst. Nicht weniger eindrucksvoll stellen sich die barocken Palastanlagen und Lustschlösser der Grafen von Hanau und der Landgrafen von Hessen-Darmstadt dar. Der vorliegende Band begleitet zu 96 ausgewählten Burgen, Schlössern und Herrensitzen im Rhein-Main-Gebiet. Dabei werden nicht nur so große und bedeutende Anlagen wie die Residenzschlösser in Darmstadt und Mainz thematisiert, sondern auch zahlreiche kleine Landschlösser und Adelssitze. Der zeitliche Bogen spannt sich von der Turmburg des 11. Jahrhunderts bis zum historistischen Schloss des 19. Jahrhunderts.