Carl-Christoph Schweitzer Bücher

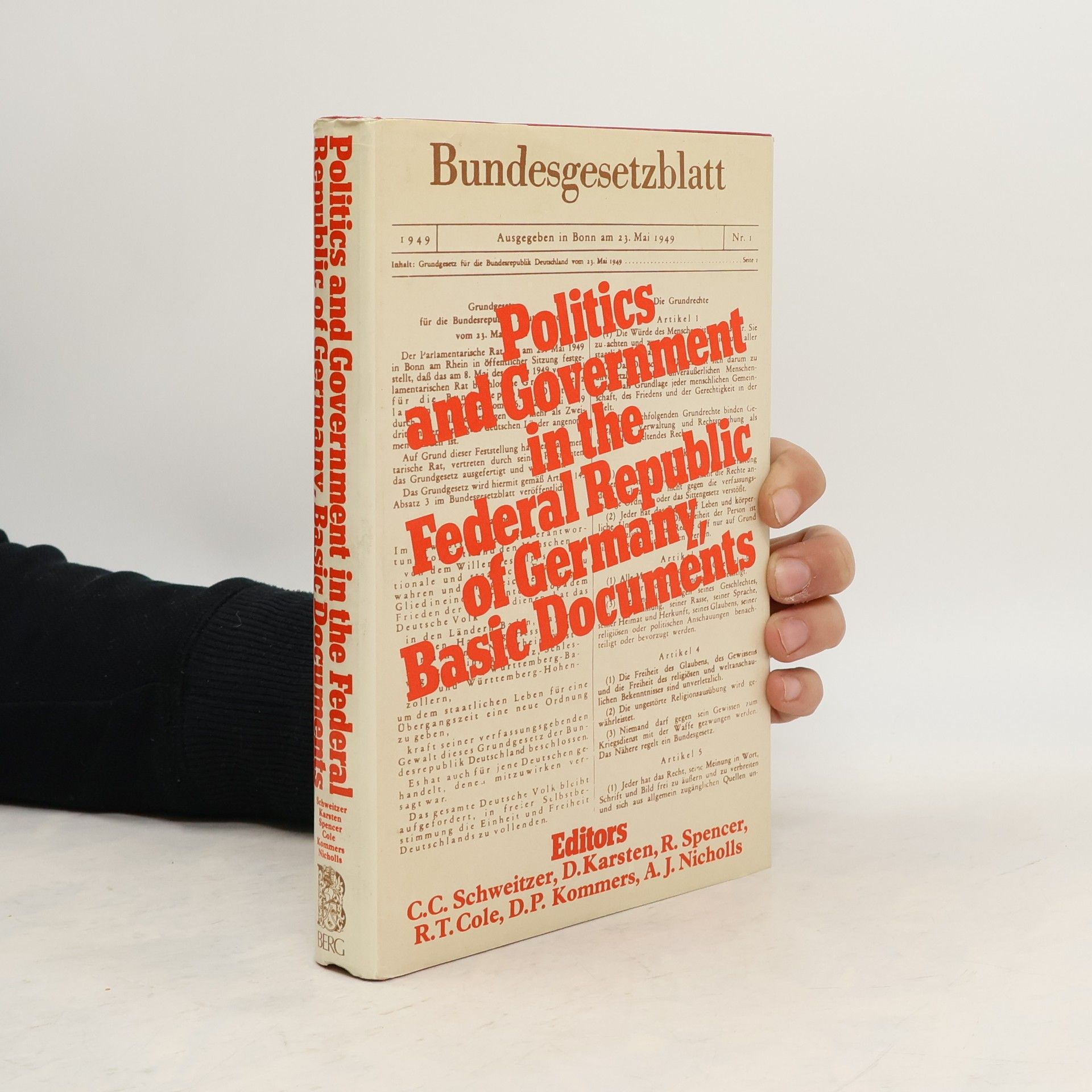
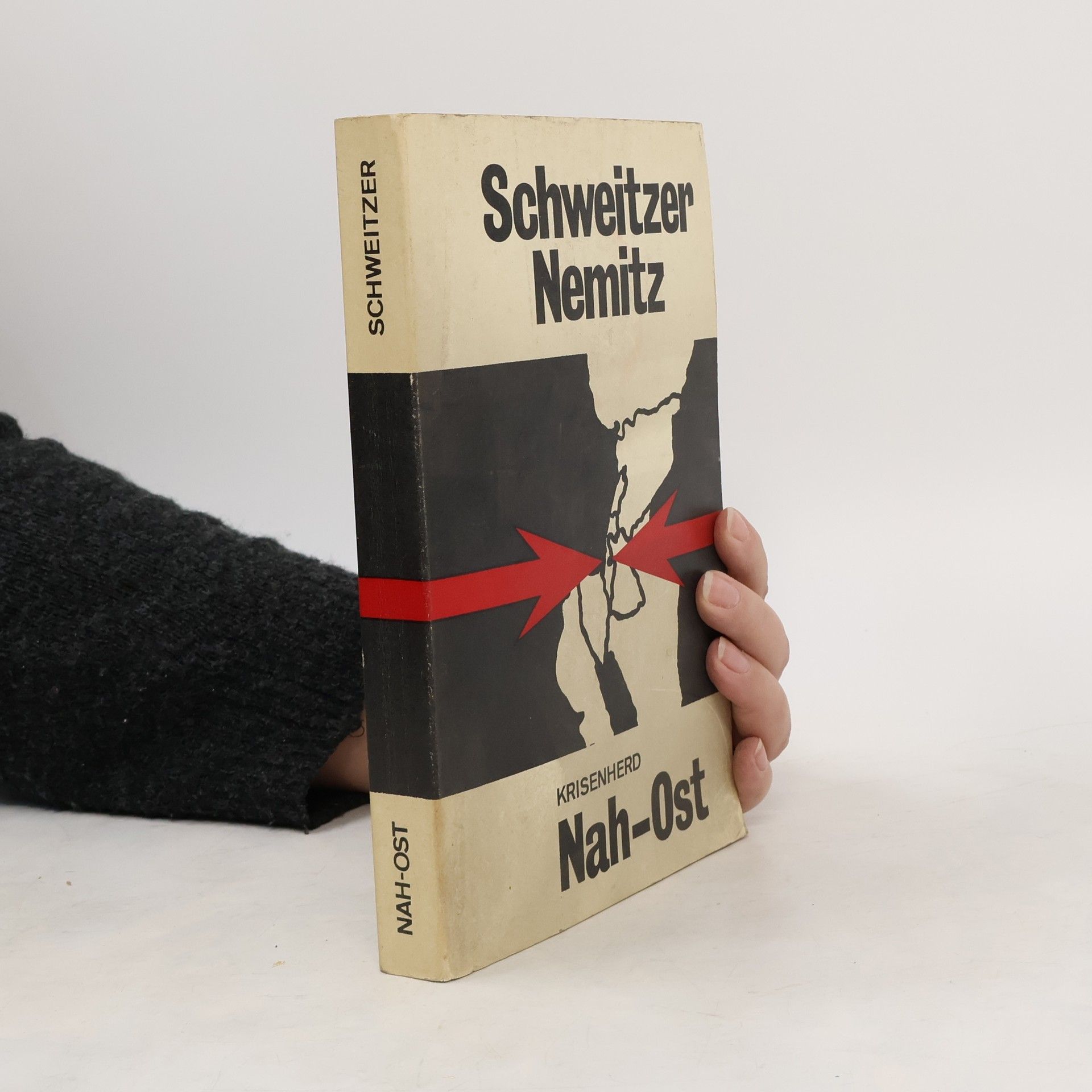
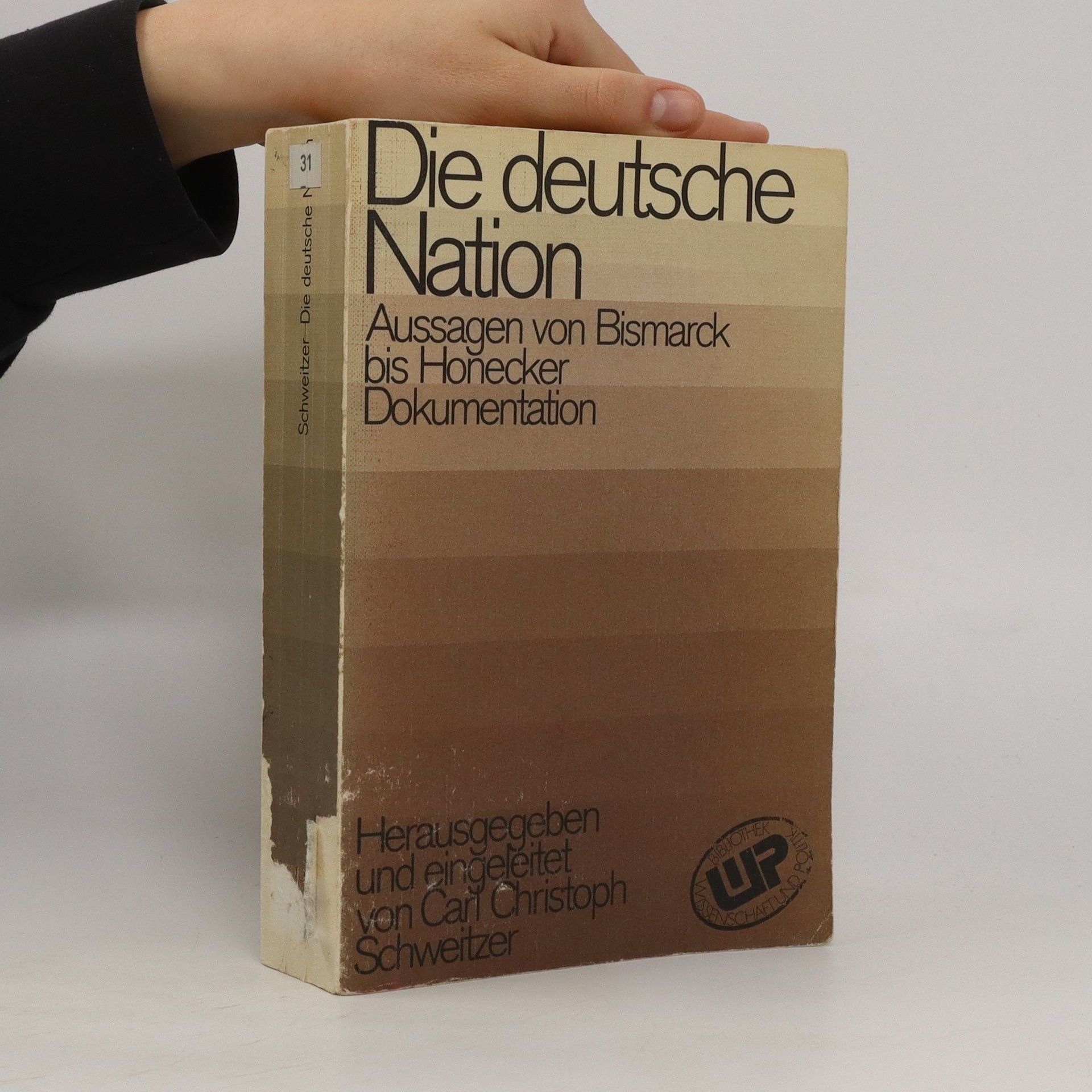
Lebensläufe — hüben und drüben
- 396 Seiten
- 14 Lesestunden
Über 40 Jahre waren die Deutschen östlich und westlich der Eibe voneinander getrennt. Mit zunehmend perfektionierter "Grenzsicherung" im Jargon der SED, "Mauer und Schießbefehl" in der sicherlich exakteren Charakterisierung im freien Teil Deutschlands, waren sie dann mehr oder weniger völlig voneinan der abgeschottet. Westliche Rundfunkanstalten, speziell westliches Fernsehen zu empfangen, war zunächst geflihrIich für die im Machtbereich Pankows und Moskaus lebenden Deutschen, ist im Laufe der Jahre dann nicht mehr zu ver hindern gewesen, wurde aber bis zuletzt offiziell verurteilt. Später sollte sich ge rade das Medium Fernsehen als ein zweischneidiges Instrument westlicher Auf weichung des kommunistisch-totalitären Herrschaftsgefüges erweisen - zwei schneidig, weil positiv gesehen die Stimmen und Stimmungen der Freiheit an die Substanz des Unterdrückungsregimes gehen mußten, negativ, weil viele un reflektiert Nachrichten konsumierende Deutsche in den heutigen neuen Bundes ländern sicherlich auch ein verzerrtes Bild vom uneingeschränkten Glück und Wohlstand in einer scheinbaren westlichen Überflußgesellschaft bewußt oder unbewußt in sich aufnahmen. Demgegenüber wurden Ost-Rundfunkanstalten, Ost-Fernsehen und Ost-Zeitungen von den Deutschen im Westen völlig zu Recht genauso wenig als seriöse Instrumente objektiver Aufklärung betrachtet, wie dies bei der Masse der Bevölkerung im Osten selber der Fall war.