Das Du-Denken
Martin Buber zwischen Dialektik und Dialogik
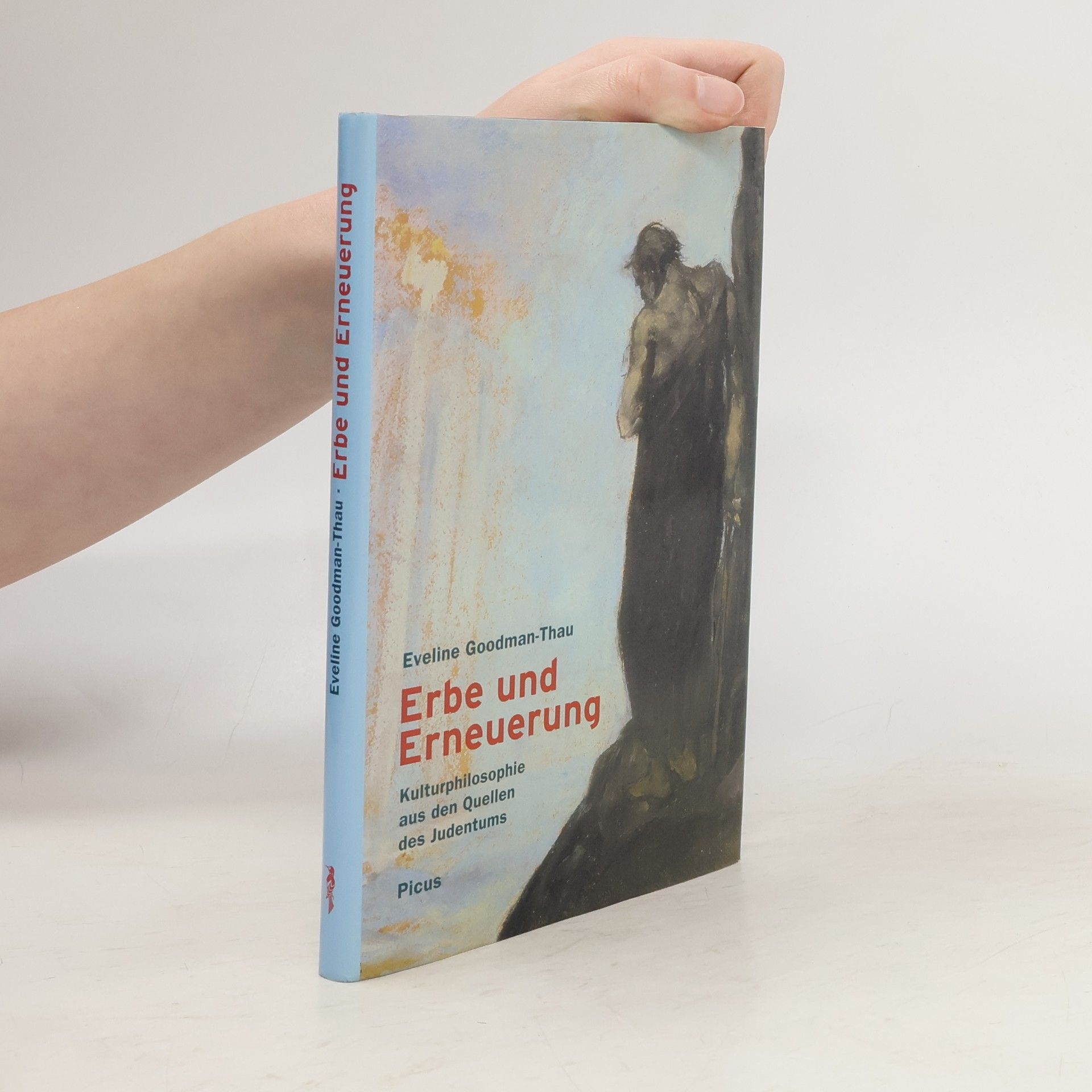
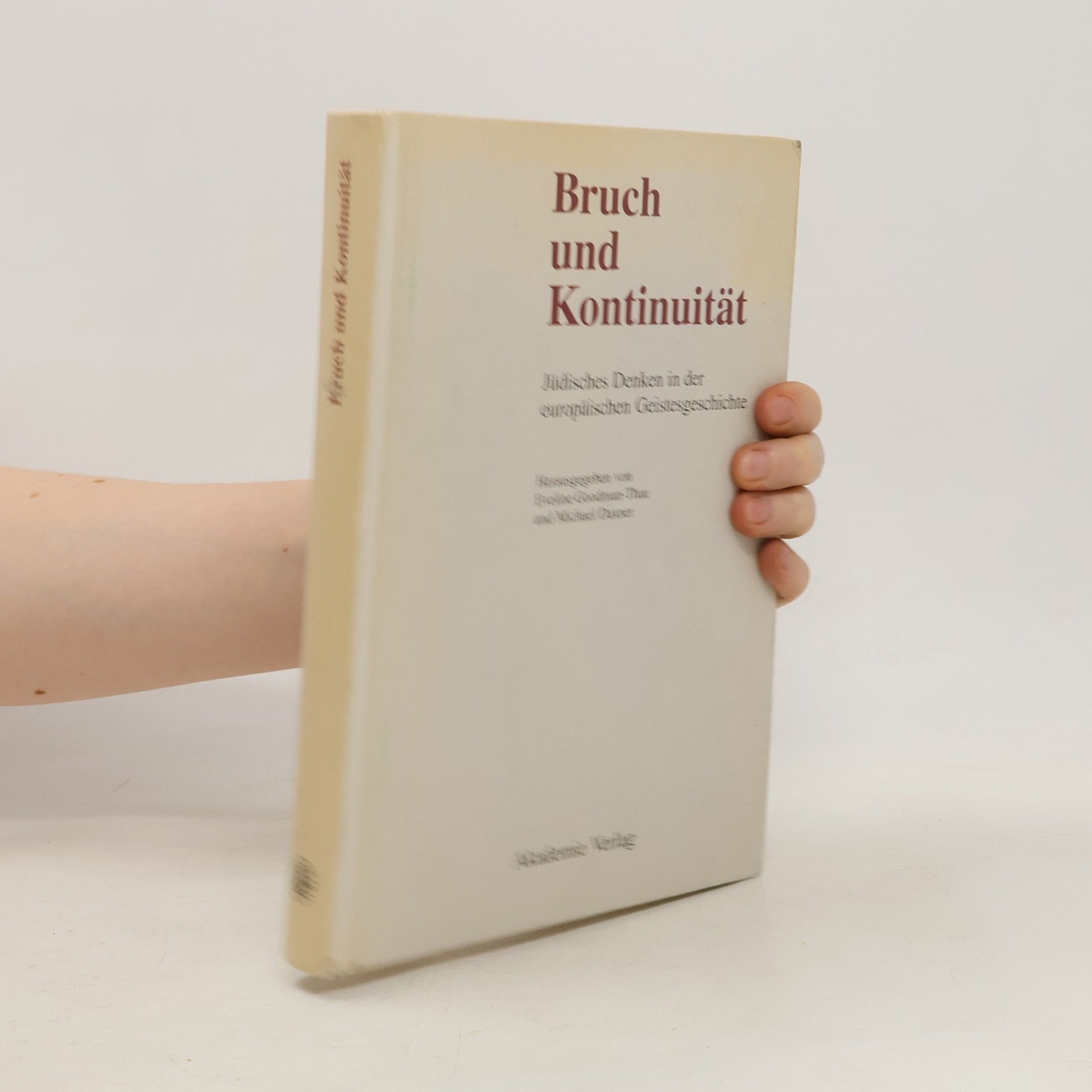


Martin Buber zwischen Dialektik und Dialogik
„Gefährten auf dem Weg zu haben, bedeutet, gemeinsame Erinnerungen zu leben, jenseits der historischen Wahrheit.“ In imaginären und realen Denk-Gängen durch Wien entfaltet die Rabbinerin Eveline Goodman-Thau lebensgeschichtliche und kulturphilosophische Erzählungen. Als erste Rabbinerin Österreichs in einer Wiener jüdisch-liberalen Gemeinde reflektiert sie über ihre Beziehung zur Stadt: „Wien als Geburtsort lag ganz weit weg – ein geschlossener Garten, unbetretbar, unberührbar.“ Wien war für sie „abwesend, da das Wesentliche, der Mensch, ja fehlte.“ Diese Abwesenheit führt zu einer Hoffnung, die sie auf ihren Denk-Gängen begleitet. Sie findet Trost in der Abwesenheit, wo an jeder Ecke neue alte Lebensstücke entdeckt werden, an einem Ort, wo Geschichte und Biografie sich kreuzen. Goodman-Thau schafft eine „geografische Biografie“ und beschreibt den Prozess des Schreibens, der nicht ohne Brüche erfolgt. Es ist ein ständiges Gegen-Denken: das Erkennen des „Alten, dessen, was nicht mehr da ist“, und das Sehen „mit neuen Augen“. Sie zieht eine kritische Bilanz über einen Abgrund und schlägt eine Brücke, die kein anderes Ufer hat. In dieser assoziativen und authentischen Stärke offenbaren sich die Aufzeichnungen der „Rabbinerin in Wien“.