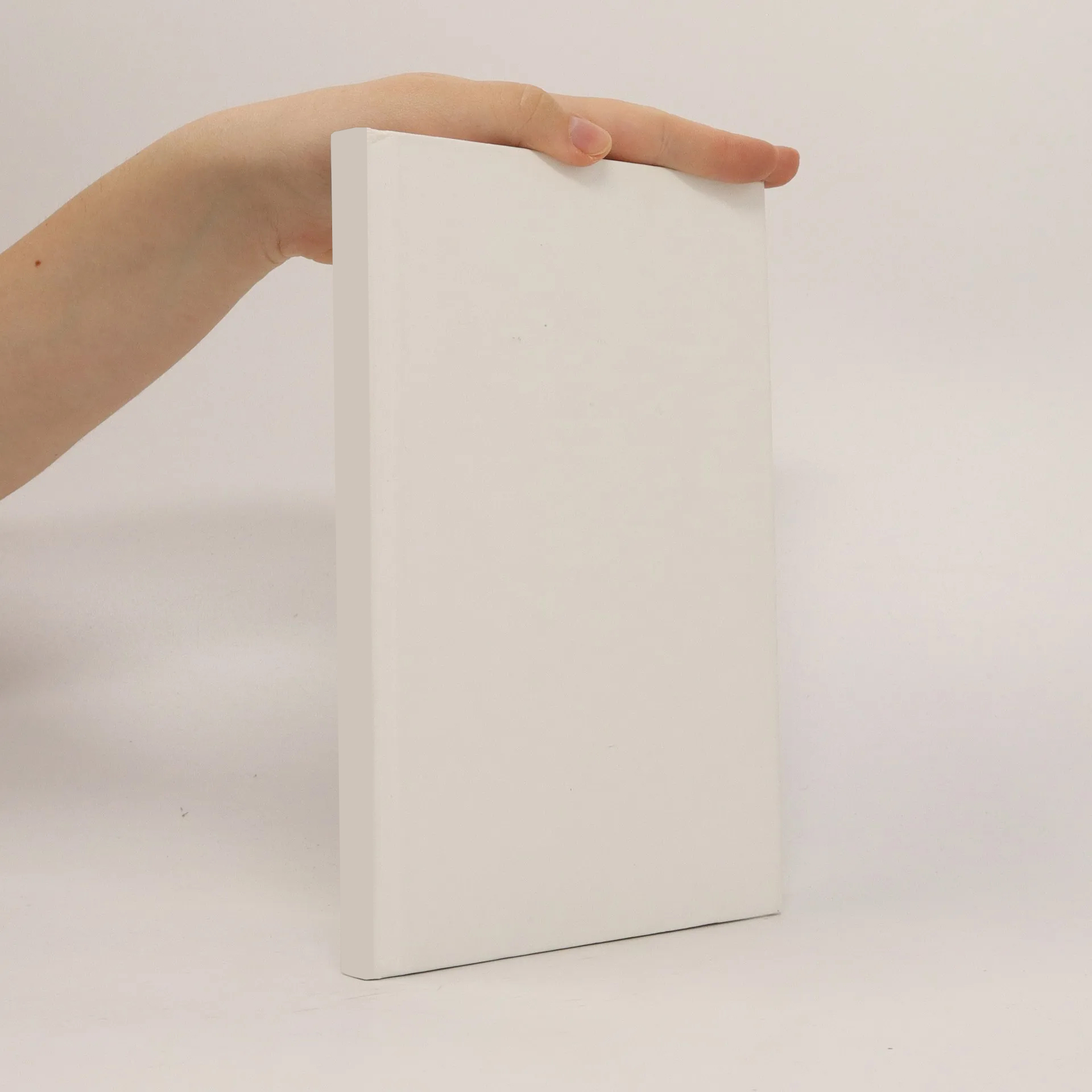
Parameter
Mehr zum Buch
Unsere Familie stammt aus dem Sudetenland, aus Schluckenau im Nordböhmen, den wir 1946 verloren haben. Was dies bedeutet, wissen alle Vertriebenen. Nach meinem Abschied konnte ich ein geordnetes Leben führen, bis ich im Alter alte Briefe las und die Vergangenheit lebendig wurde. Diese Erinnerungen wollte ich niederschreiben. Die politischen Ereignisse der Dreißigerjahre und die Kriegserfahrungen in Berlin prägten meine Jugend. Unsere Putzfrau, eine Baptistin, hatte in den Dreißigern Angst um ihren Mann, der mit kommunistischen Freunden in Konflikte mit nationalsozialistischen Schlägertrupps geriet. Sie berichtete von Todesfällen in einer Anstalt für behinderte Kinder, die verdächtig erschienen. Ich erlebte die Sorge meiner Eltern während der Judenverfolgungen in Berlin und erfuhr mit sechzehn Jahren von gezielten Morden an jüdischen Mitbürgern. Ein Bekannter meiner Familie, Dr. Schmeisser, half Juden über die Grenze und wurde 1943 verhaftet. Als Medizinstudentin erlebte ich das Unglück der Menschen im Krankenhaus von Schluckenau. Die Schicksale der Patienten spiegelten die Katastrophe des Krieges wider. Der Verlust an Vermögen war gering im Vergleich zu dem Schicksal derer, die ihr Leben verloren. Es bleibt die Erinnerung an das Ausgeliefertsein der Einzelnen gegenüber dem Schicksal, das durch das Handeln anderer verursacht wurde. Historikerinnen und Historiker bemühen sich, die komplexen Zusammenhänge zu rekonstruieren, in de
Buchkauf
Offene Wunden, Eva Stiegler-Eisenzapf
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2004
Lieferung
- Gratis Versand in ganz Österreich
Zahlungsmethoden
Keiner hat bisher bewertet.