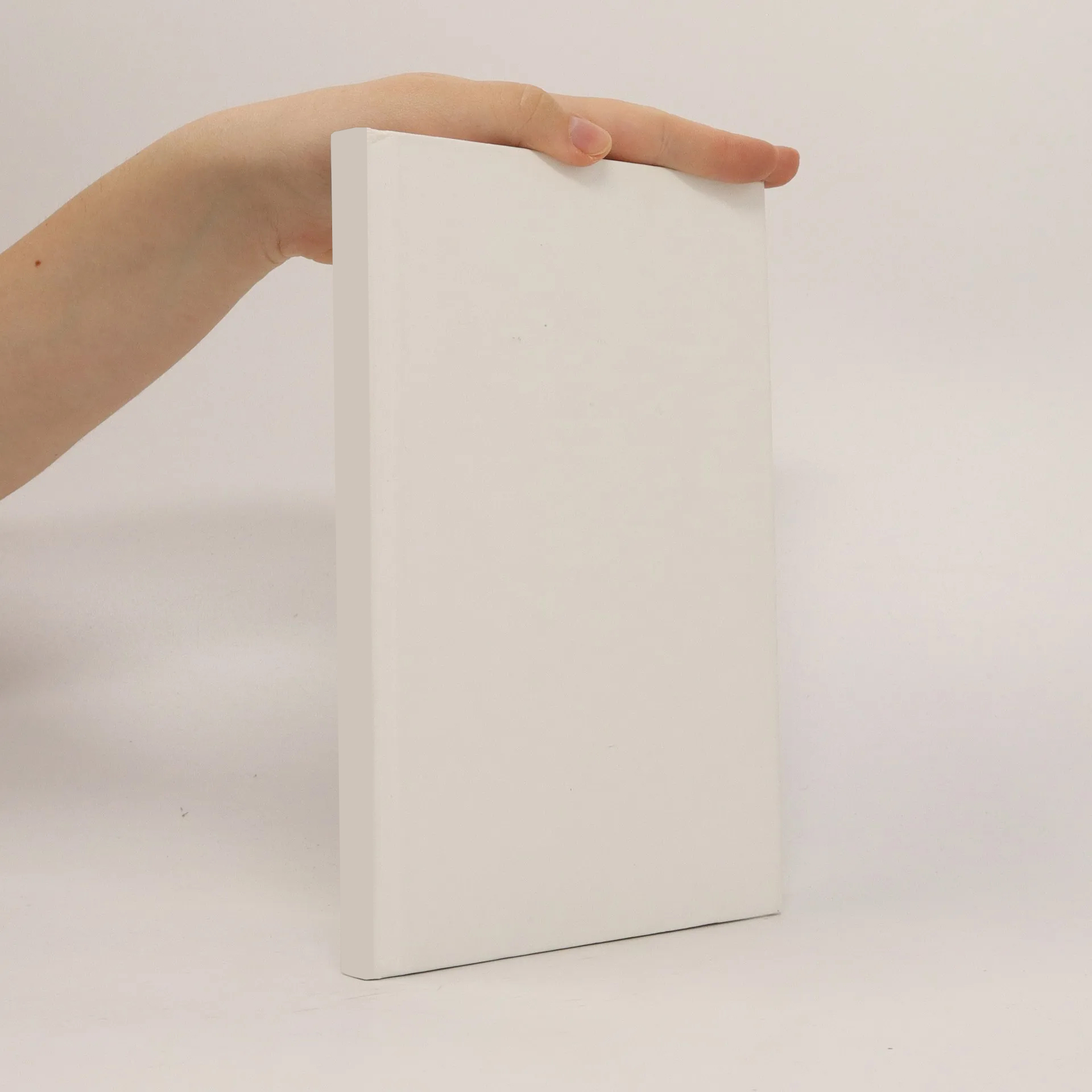
Parameter
Mehr zum Buch
Im Mittelalter war Kunst nahezu immer funktional und eng mit spezifischen Zwecken verbunden. Memorialbilder verdeutlichen dies besonders gut, da sie zahlreiche historische und kunsthistorische Aspekte vereinen. Caroline Horch, Historikerin und Kunsthistorikerin, analysiert in ihrer Dissertation, wie wichtig es ist, diese Bildwerke in ihren historischen, religiösen, politischen und künstlerischen Kontext zu integrieren. Ihre Methode, Kunstgeschichte als Geschichtswissenschaft zu betrachten, führt zu neuen Erkenntnissen, insbesondere zu Datierungsfragen. Sie zeigt, dass Form, Funktion und Inhalt von Memorialbildern in einem dynamischen Verhältnis zueinander standen. Memoria im Mittelalter umfasste mehr als das heutige Totengedächtnis; sie beinhaltete soziale und karitative Verpflichtungen der Stifter. Neben liturgischen Gedenkpraktiken war die Vergegenwärtigung des Verstorbenen zentral, und Memorialbilder hatten vielfältige Funktionen. Horch untersucht fünf bedeutende Werke, darunter das Miniaturbild von Bischof Otto von Bamberg, das den Anspruch auf seine Heiligsprechung dokumentiert. Der „Cappenberger Kopf“ verdeutlicht den Funktionswandel von Memorialbildern, während die Naumburger Stifterfiguren Fragen zur Gemeinschaft und ihrem Standort im Naumburger Dom aufwerfen. Auch das Memorialbild von Herzog Rudolf IV. legitimierte die lebende Gemeinschaft, während das Bild von Bischof Gebhard II. nach seiner Heiligsprechung obsolet w
Buchkauf
Der Memorialgedanke und das Spektrum seiner Funktionen in der bildenden Kunst des Mittelalters, Caroline Horch
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2001
Lieferung
- Gratis Versand in ganz Österreich
Zahlungsmethoden
Keiner hat bisher bewertet.