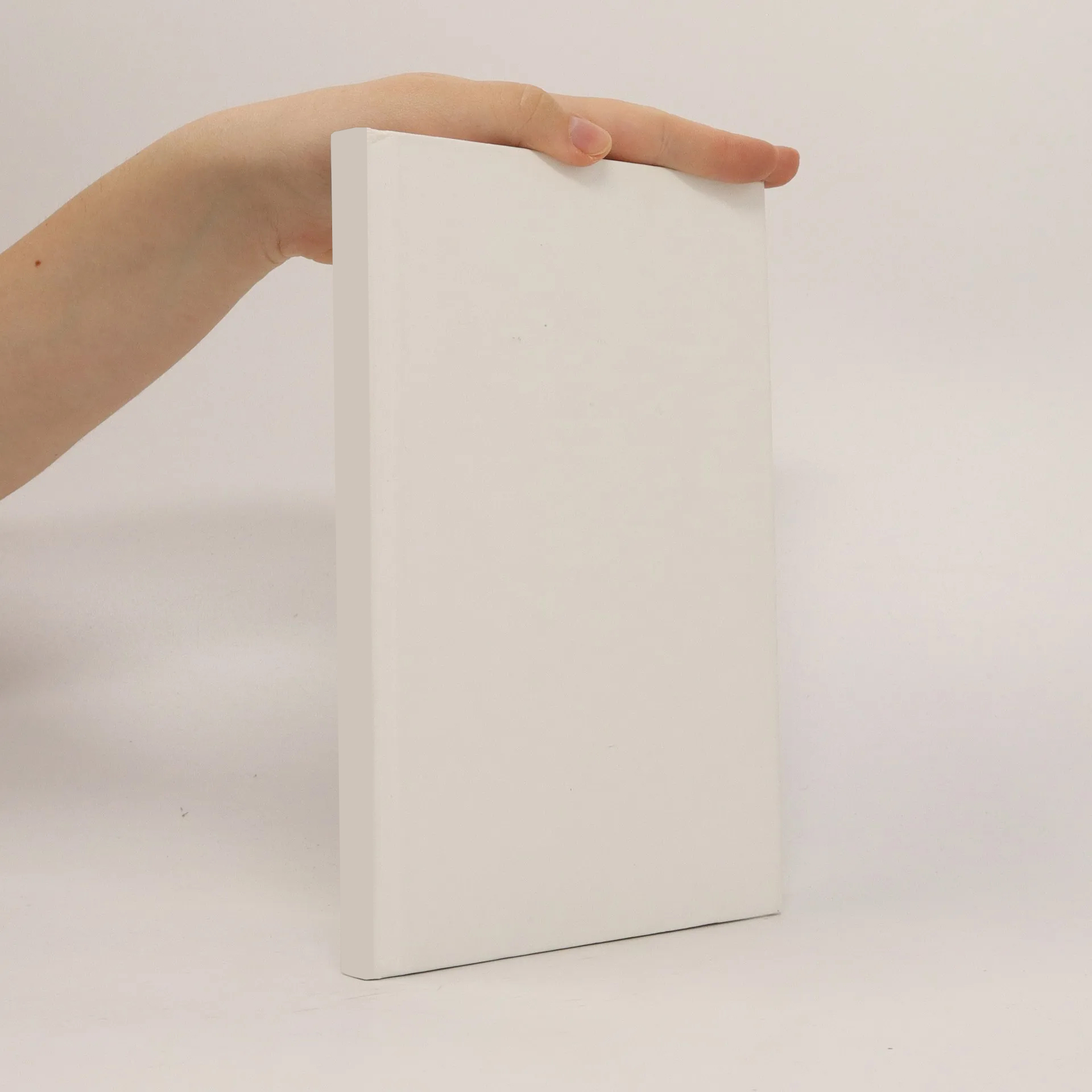
Mehr zum Buch
Bereits in der zweiten Hälfe des 18. Jahrhunderts wurde in Preußen die Schulpflicht für Jungen und Mädchen zwischen sechs und vierzehn Jahren gesetzlich festgeschrieben. Während für die Söhne der oberen Gesellschafsschichten des Gymnasium zur Verfügung stand, dessen Absolvierung auf Berufskarrieren in Staat und Militär vorbereitete, ergab sich für die Töchter der höheren Stände durch die Schulpflicht ein Problem. Auch ihnen wollte man den Volksschulbesuch nicht zumuten, denn dort hätten sie die Schulbank womöglich mit ihren späteren Hausangestellten teilen müssen. Eine „höhere“ Bildung im Sinne einer Gymnasialbildung oder gar eine Berufstätigkeit waren, abgesehen von einer Beschäftigung als Lehrerin oder Erzieherin im Falle der Ehelosigkeit, für Mädchen des Bürgertums jedoch nicht vorgesehen. Deshalb mussten die Eltern entweder einen Hauslehrer engagieren, was mit erheblichen Kosten verbunden war und deshalb nur für wenige sehr wohlhabende Familien infrage kam, oder sich für die Gründung von Mädchenschulen für höhere Töchter einzusetzen. Bei den in de ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründeten „höheren“ Töchterschulen handelte es sich überwiegend um private Unternehmungen, die noch keiner staatlichen Reglementierung unterstanden. Der Ausbildungsschwerpunkt lag neben der religiösen Erziehung auf dem neusprachlich-musischen Bereich. Es gab keine Mathematik, wenig Naturwissenschaften, keine alten Sprachen; es wurden weder Abschlusszeugnisse noch Berufsberechtigungen erteilt. Der Begriff „höhere“ bezieht sich im Hinblick auf die Mädchenschule deshalb zunächst auch nicht auf die dort vermittelten Inhalte, sondern auf die Herkunft ihrer Klientel, die sich aus den höheren Gesellschaftsschichten rekrutierte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts engagierte sich die kräftige soziale Basis des Bürgertums zunehmend erfolgreich für die Einrichtung von städtischen höheren Töchterschulen. Etwa um die gleiche Zeit erklärte die erste deutsche Frauenbewegung eine verbesserte Mädchen- und Frauenbildung zu einem ihrer Hauptanliegen. Dieses Buch stellt Hildesheim als exemplarisch für die Entwicklung des höheren Mädchenbildungswesens in einer mittelgroßen preußischen Stadt des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts dar. Es zeigt im Einzelnen die Herausbildung unterschiedlicher, typisch weiblicher Ausbildungsformen auf einem sozialen Hintergrund, der zahlreiche gesellschaftliche Spannungen in sich vereinigte: Konflikte zwischen den Gesellschaftsschichten, zwischen Stadt- und Landinteressen, zwischen den Konfessionen. Der Leser lernt die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, Institutionsgründerinnen, Schulleiterinnen und Rektoren mit ihrem individuellen Engagement für die Schulentwicklung kennen sowie die Zwänge, denen sie unterworfen waren und gegen sie rebellierten oder denen sie sich beugten.
Buchkauf
Vom Anstandsunterricht zur Hochschulreife, Kathrin Weise
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2009
Lieferung
- Gratis Versand in ganz Österreich
Zahlungsmethoden
Keiner hat bisher bewertet.