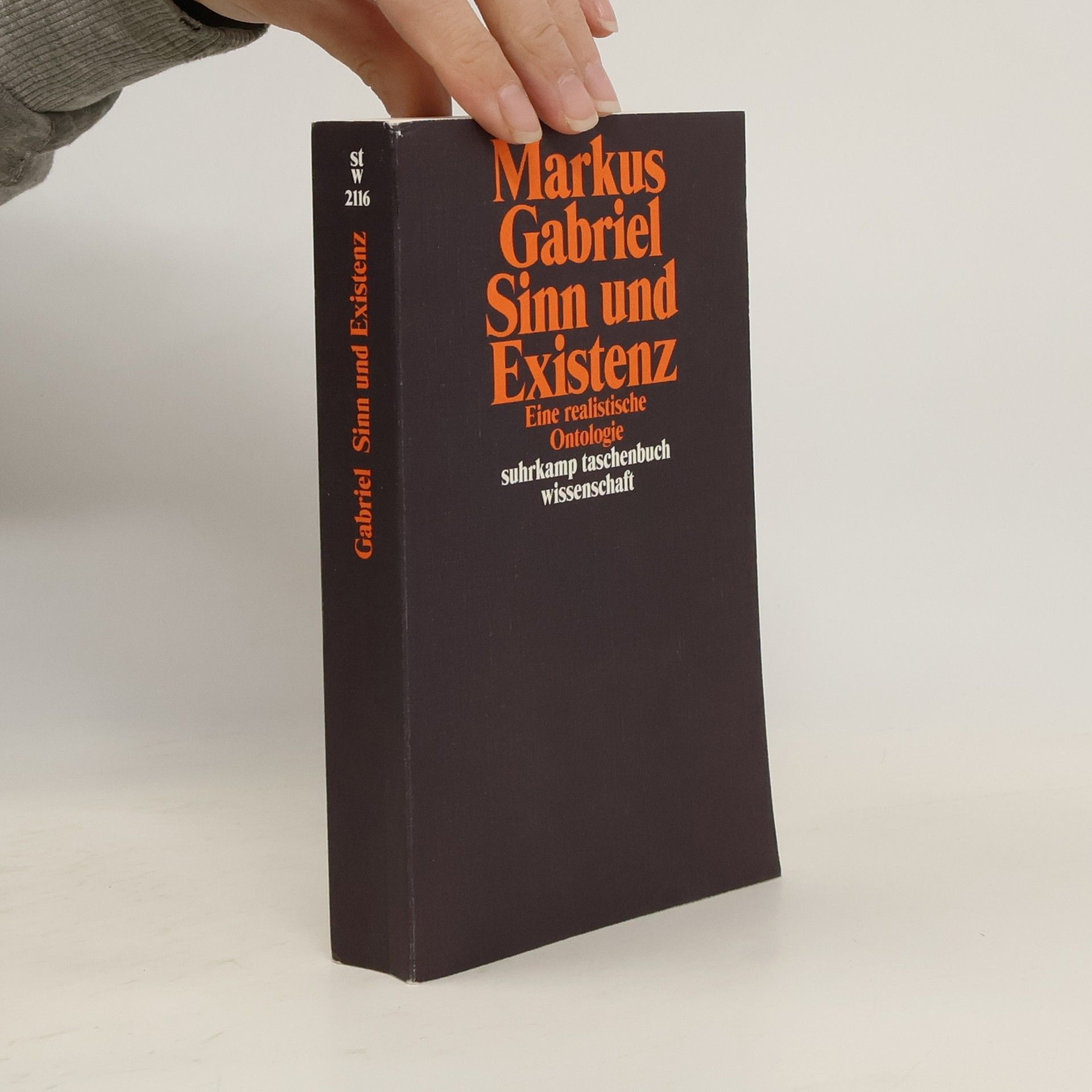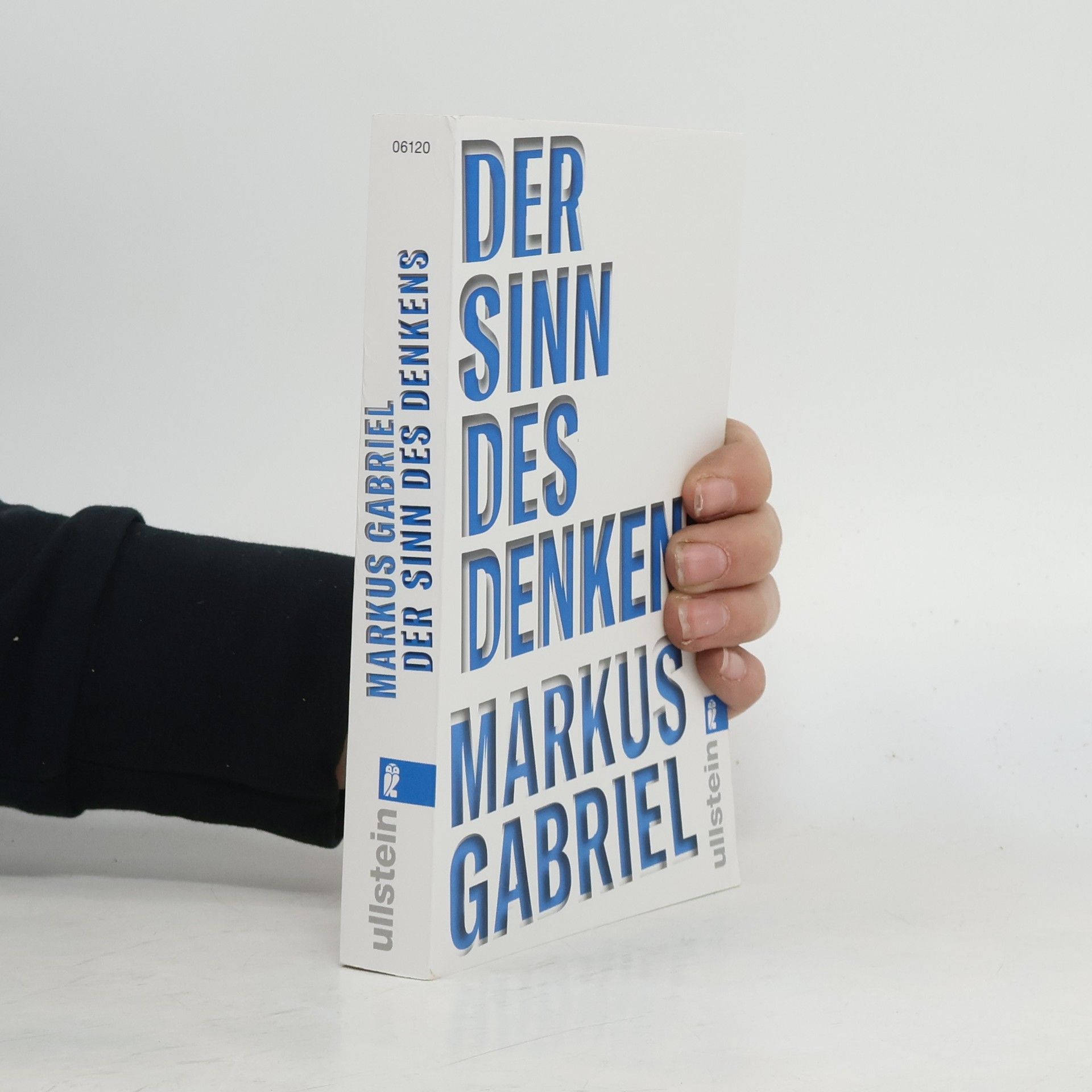Zwischen Gut und Böse
Philosophie der radikalen Mitte
Ein gutes Leben, das Richtige tun: Wie kann das gelingen? Gert Scobel und Markus Gabriel entwerfen eine neue Ethik, auf die wir – als Einzelne, als Gesellschaft und als Staat – unser Handeln auch in Krisenzeiten aufbauen können. Zwischen Gut und Böse liegen unzählige Möglichkeiten. Entsprechend weit spannen die beiden Philosophen ihre Gedanken: Anknüpfend an Traditionen der guten Lebenspraxis, an abendländische und asiatische Denkwege gehen sie der Frage nach, wie wir in einem komplexen Leben mit begrenzter Erkenntnis gute Entscheidungen treffen können. Im Dialog entwickeln Gabriel und Scobel das Prinzip der »radikalen Mitte«, in der sich unser Wissen, Denken, Fühlen, unsere Werte und Erfahrungen in einer Entscheidung und zugleich im Handeln verdichten. Werden wir uns dieser Mitte bewusst und kultivieren sie, erkennen wir in ihr die Wirklichkeit, aber auch den gewaltigen Raum der Möglichkeiten: und dazwischen uns selbst. In dieser Mitte, davon sind Markus Gabriel und Gert Scobel überzeugt, ist das Gute immer eine reale Option. Ursprünglich erschienen in der Edition Körber.