Das Studienbuch gibt Einblick in die Grundzüge des österreichischen Strafprozess-rechts. Die Gewichtung der einzelnen Problembereiche orientiert sich vorrangig an den Bedürfnissen der Praxis. Beispiele veranschaulichen die oft komplexe Gesetzes-materie und vermitteln gleichzeitig einen Überblick über die einschlägige Rechtspre-chung. Die Neuauflage berücksichtigt die jüngsten Gesetzesänderungen, welche ua durch das Strafrechtliche Entschädigungsgesetz 2005 (StEG 2005, BGBl I 2004/125) und die Strafprozessnovelle 2005 (BGBl I 2004/164), mit der die Protokollierung wesent-lich vereinfacht wurde, erfolgt sind. Literatur und Rechtsprechung sind bis November 2005 eingearbeitet worden.
Stefan Seiler Bücher


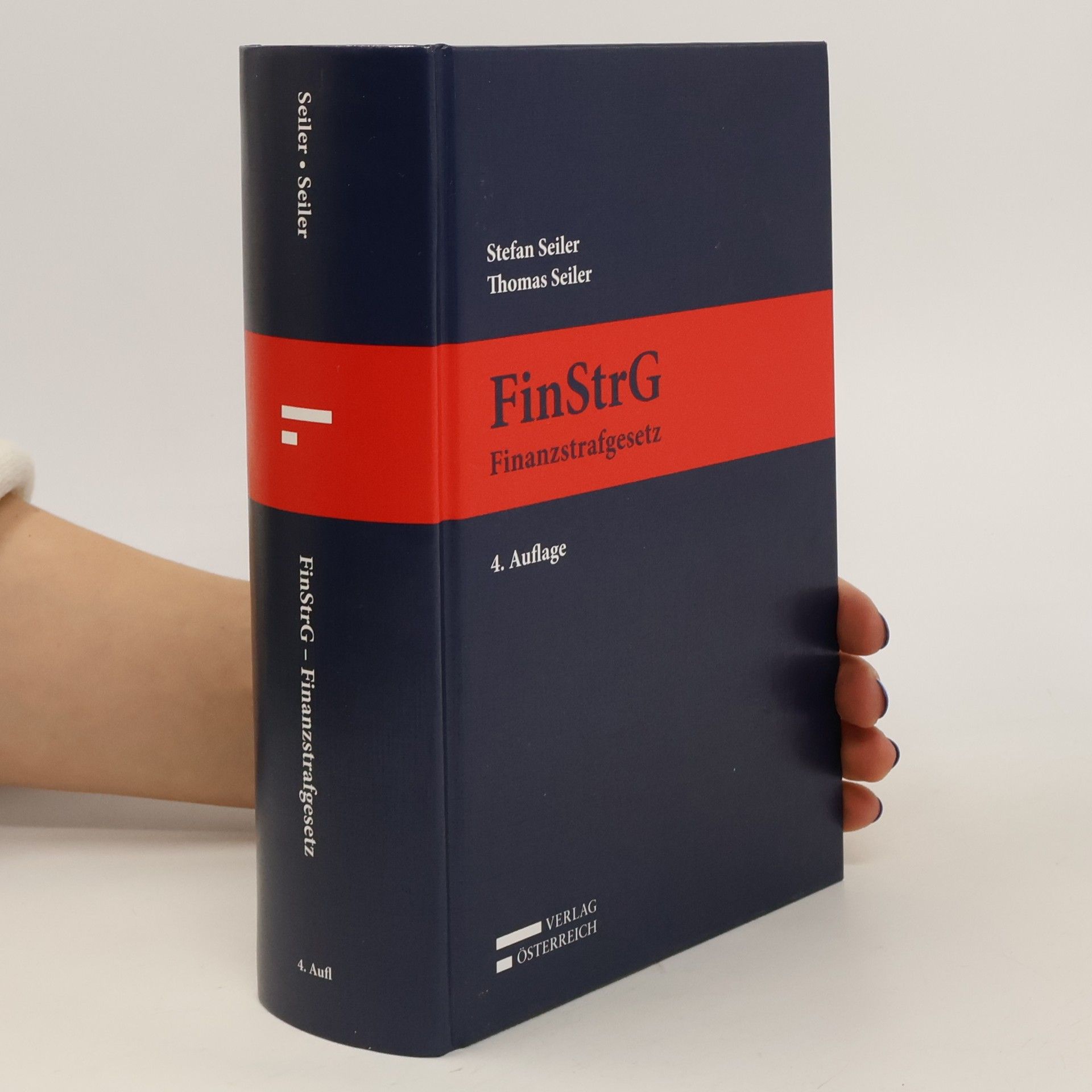

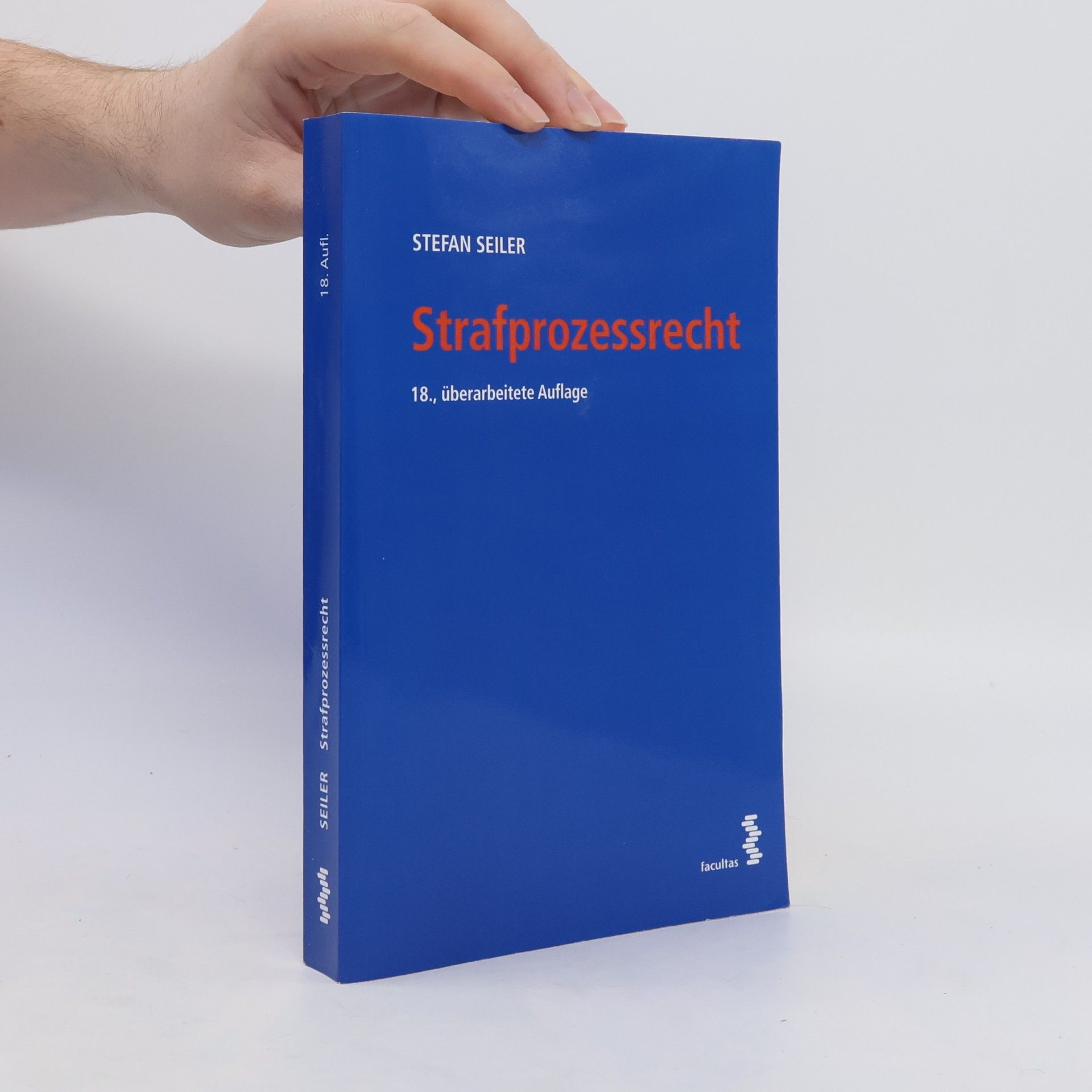
Das Studienbuch bietet eine umfassende Einführung in das Strafrecht, insbesondere im Allgemeinen Teil I. Es erklärt die grundlegenden Elemente des Verbrechensbegriffs und stützt sich dabei auf die aktuelle Rechtsprechung. Strittige Themen werden durch relevante Lehrmeinungen beleuchtet, und jedes Kapitel verweist auf weiterführende Literatur zu spezifischen Detailfragen. Damit ist das Buch sowohl für Studierende als auch für Praktiker eine wertvolle Ressource zur Vertiefung des Verständnisses im Strafrecht.
Die Neuauflage des Kommentars zum Finanzstrafgesetz berücksichtigt die seit der Vorauflage ergangenen Änderungen des Finanzstrafgesetzes. Zu nennen sind vor allem das Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012 (BGBl I 2013/14) und die Finanzstrafgesetz-Novelle 2013 (BGBl I 2013/155), mit denen das Bundesfinanzgericht eingeführt wird. Der Kommentar dient sowohl als umfangreiches Nachschlagewerk als auch als handlicher Arbeitsbehelf. Die einzelnen Bestimmungen und deren Auslegung werden anhand der aktuellen Judikatur des VfGH, VwGH, UFS und OGH übersichtlich erläutert. Diverse Erlässe des BMF finden ebenfalls Berücksichtigung.
Das vorliegende Studienbuch zum Strafrecht Allgemeiner Teil I vermittelt das Grundlagenwissen zum Strafrecht. Es werden die Aufbauelemente des Verbrechensbegriffs erläutert. Die Ausführungen zu den einzelnen Bereichen stützen sich auf die herrschende Rechtsprechung. Zu strittigen Punkten werden die einschlägigen Lehrmeinungen zitiert, auf weiterführende Literatur zu Detailproblemen wird am Anfang der jeweiligen Kapitel hingewiesen. Nach jedem Kapitel findet sich in Form von Schemata eine einprägsame Zusammenfassung der behandelten Bereiche. In systematischer Abfolge werden jene Punkte aufgelistet, die bei der strafrechtlichen Beurteilung einer Sachverhaltskonstellation zu beachten und gegebenenfalls näher zu prüfen sind. Studierenden wird damit gleichzeitig ein Leitfaden bei der Bearbeitung von Diplomklausurfällen in die Hand gegeben. Literatur und Rechtsprechung sind bis Dezember 2015 eingearbeitet worden.
Das praxisnahe Lehrbuch gibt einen Einblick in das österreichische Sanktionensystem und zeichnet sich durch leichte Lesbarkeit aus. Den Bedürfnissen der Praxis entsprechend wurde die herrschende Judikatur möglichst weitgehend in den Text aufgenommen. Die Gesetzesmaterie soll dadurch einprägsam veranschaulicht und gleichzeitig ein Überblick über die aktuelle Rechtsprechung geboten werden. An vielen Stellen wird auf prozessuale Aspekte hingewiesen, um die für das Verständnis wichtigen Zusammenhänge zwischen materiellem und formellem Recht zu verdeutlichen. Die Neuauflage berücksichtigt die Judikatur bis Juli 2015 und die Änderungen durch das Strafrechtsänderungsgesetz 2015.