Psychotherapie in Österreich seit 1945
Eine professionssoziologische Untersuchung zur Etablierung als Gesundheitsberuf und akademische Disziplin
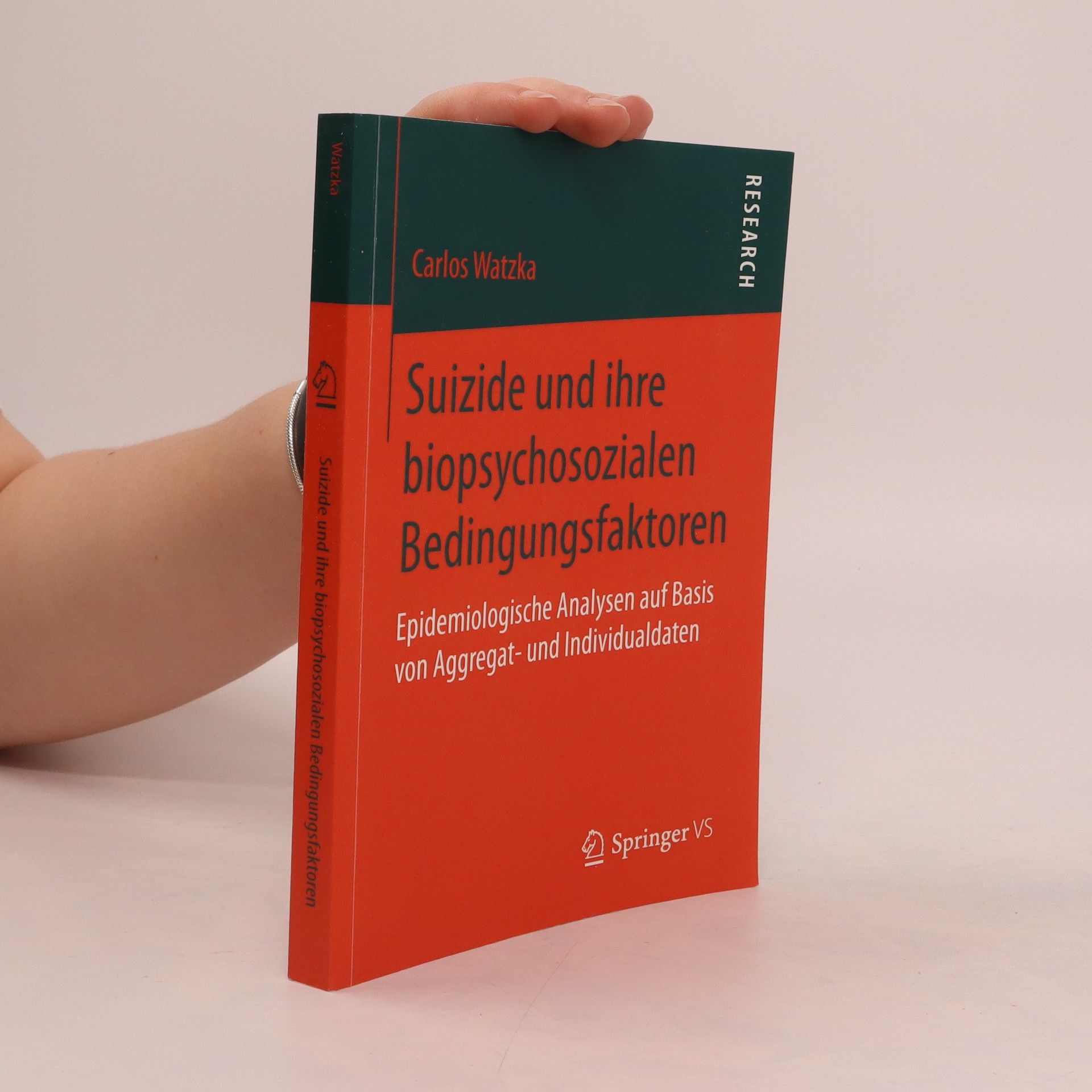



Eine professionssoziologische Untersuchung zur Etablierung als Gesundheitsberuf und akademische Disziplin
Daten und Analysen mit Fokus Steiermark
Die Diätetik der Emotionen im frühneuzeitlichen Katholizismus in Bayern und Österreich
Die frühchristliche Theologie war stark von manichäisch-weltablehnenden Ideen geprägt, die im Widerspruch zum mosaischen 'Schöpfungslob' standen. Dieser Konflikt beeinflusste das Menschenbild der katholischen Kirche und deren Umgang mit Emotionalität und Gesundheit. Im Zuge der Reformation entwickelte der Katholizismus eine 'innere Mission', die Askese und Disziplin propagierte. Die katholische Reform führte zu einer rigorosen Seelenführung und strikter Affektregulation, was auch die Vorstellungen von seelischer und leiblicher Gesundheit des Klerus prägte. Carlos Watzka untersucht diesen geistlichen Diskurs im bayrisch-österreichischen Raum zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert.
Epidemiologische Analysen auf Basis von Aggregat- und Individualdaten
Carlos Watzka aktualisiert und vertieft die Forschung zu Risikofaktoren für Selbsttötungen auf individueller und kollektiver Ebene mittels multivariater quantitativer Analysen und schließt damit an seine Pilotstudie „Sozialstruktur und Suizid (2008)“ an. So kann ein neu erstelltes Erklärungsmodell auf Basis von Bezirksdaten der Jahre 2001-2009 mehr als 60 % der regionalen Schwankungen der Suizidraten in Österreich auf den Einfluss von 11 Parametern zurückführen, zu denen Alters-, Familien-, Wohn- und Erwerbsstruktur, Einkommens- und Bildungsniveau, aber auch der Grad der medizinischen, psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung sowie Topographie und Landschaftsstruktur zählen. Hochrisikopopulationen für Suizide werden damit präziser identifizierbar und so auch die Wissensbasis für gezieltere Präventionsaktivitäten bedeutend erweitert.