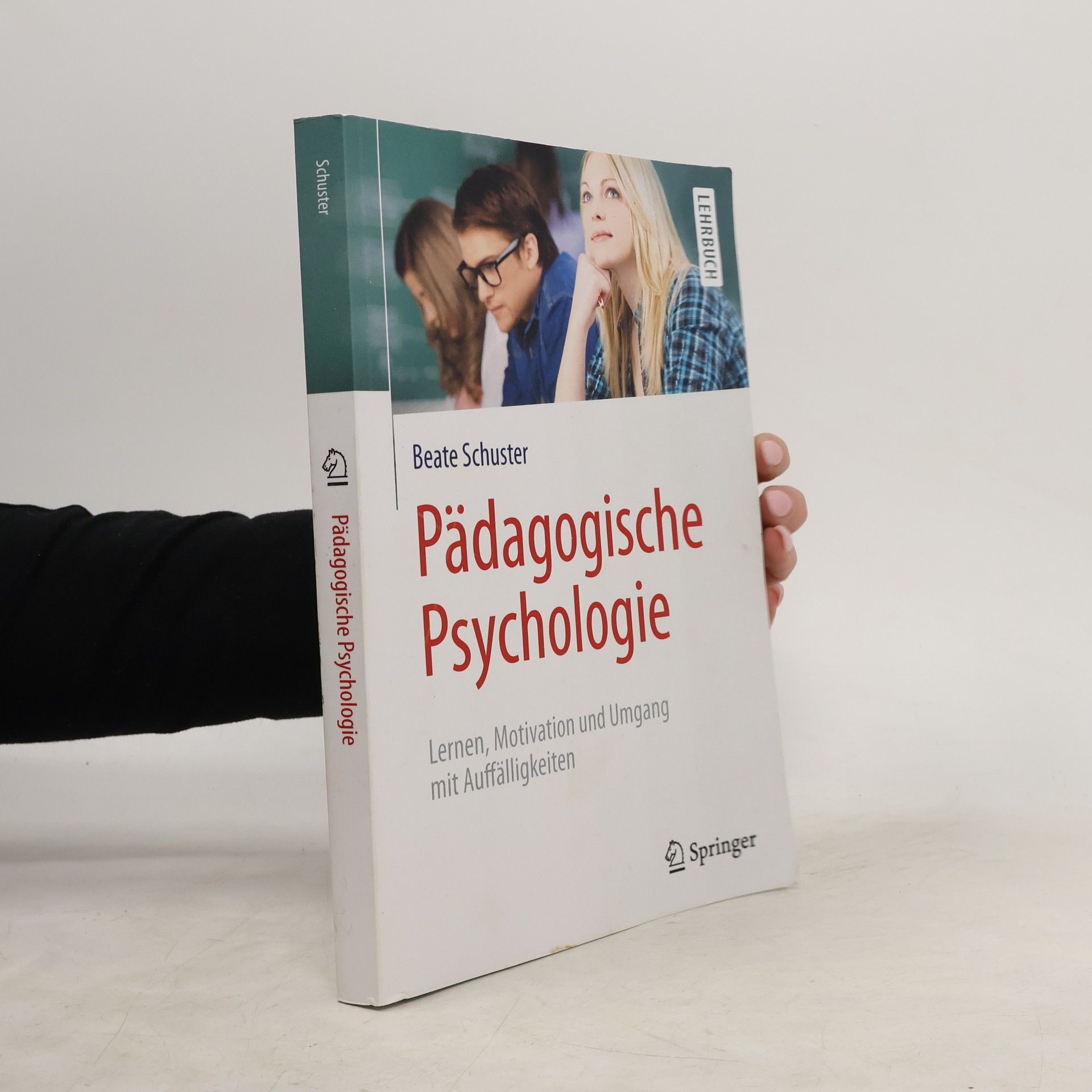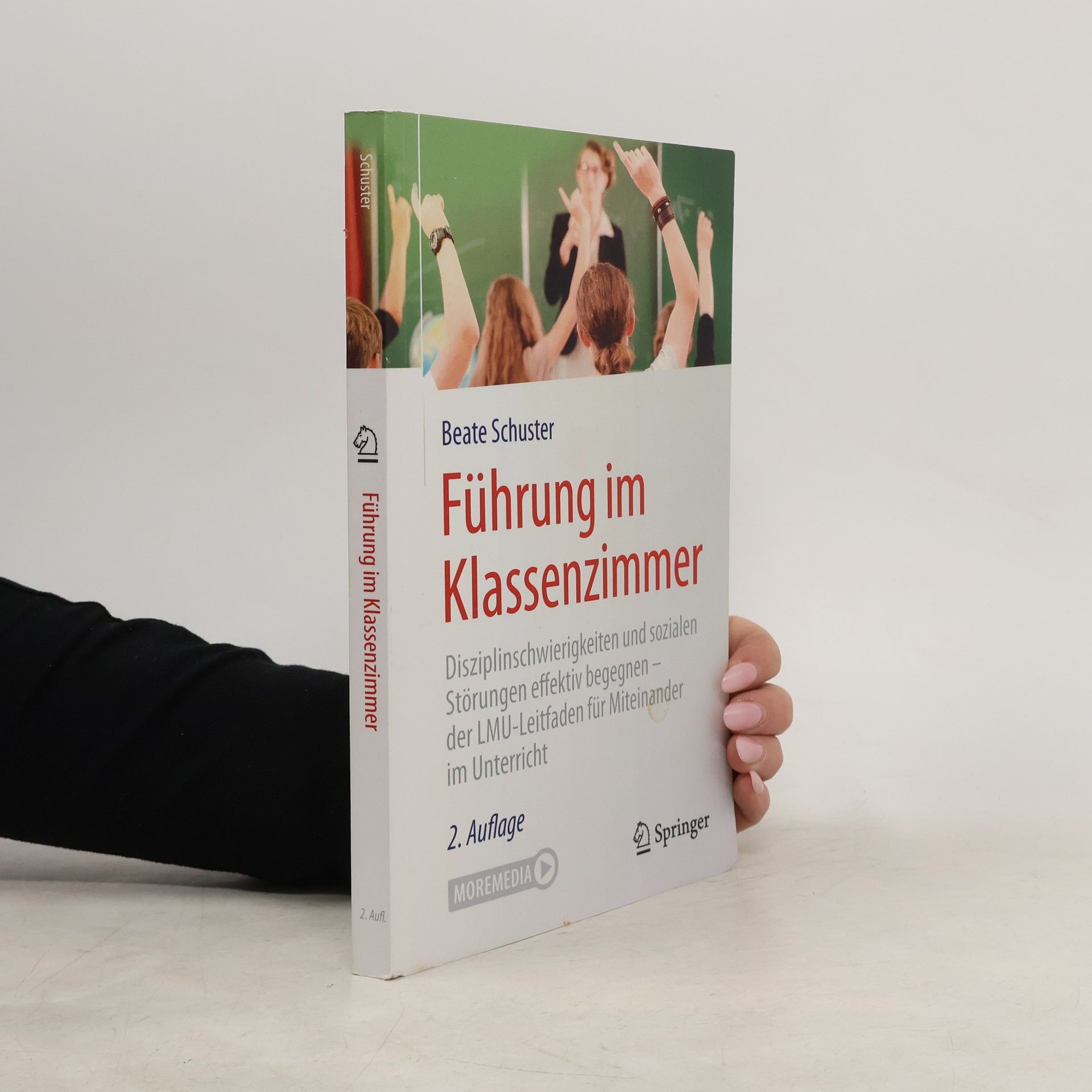Führung im Klassenzimmer
Disziplinschwierigkeiten und sozialen Störungen effektiv begegnen - der LMU-Leitfaden für Miteinander im Unterricht - 2. Auflage
- 375 Seiten
- 14 Lesestunden
Disziplinprobleme, unmotiviertes Lernverhalten und soziale Störungen stellen ein zentrales Problem an Schulen dar. Der LMU-Leitfaden für Miteinander im Unterricht schlägt auf der Grundlage etablierten psychologischen Wissens konkrete, praxistaugliche Maßnahmen für typische Alltagssituationen (und mögliche Albtraumszenarien) vor, um die Dynamik hinter diesen Phänomenen besser verstehen, und diesen gezielter vorbeugen und begegnen zu können. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Ideen, die sehr „klein“ erscheinen und die Sie selbst umsetzen können, ohne dass Sie eine „geborene Lehrkraft“ sein oder mehr Engagement zeigen müssen, sondern indem Sie an den handhabbaren Stellschrauben ansetzen und so Ihren Einsatz zielführender gestalten.