Brigitte Reutner Doneus Bücher

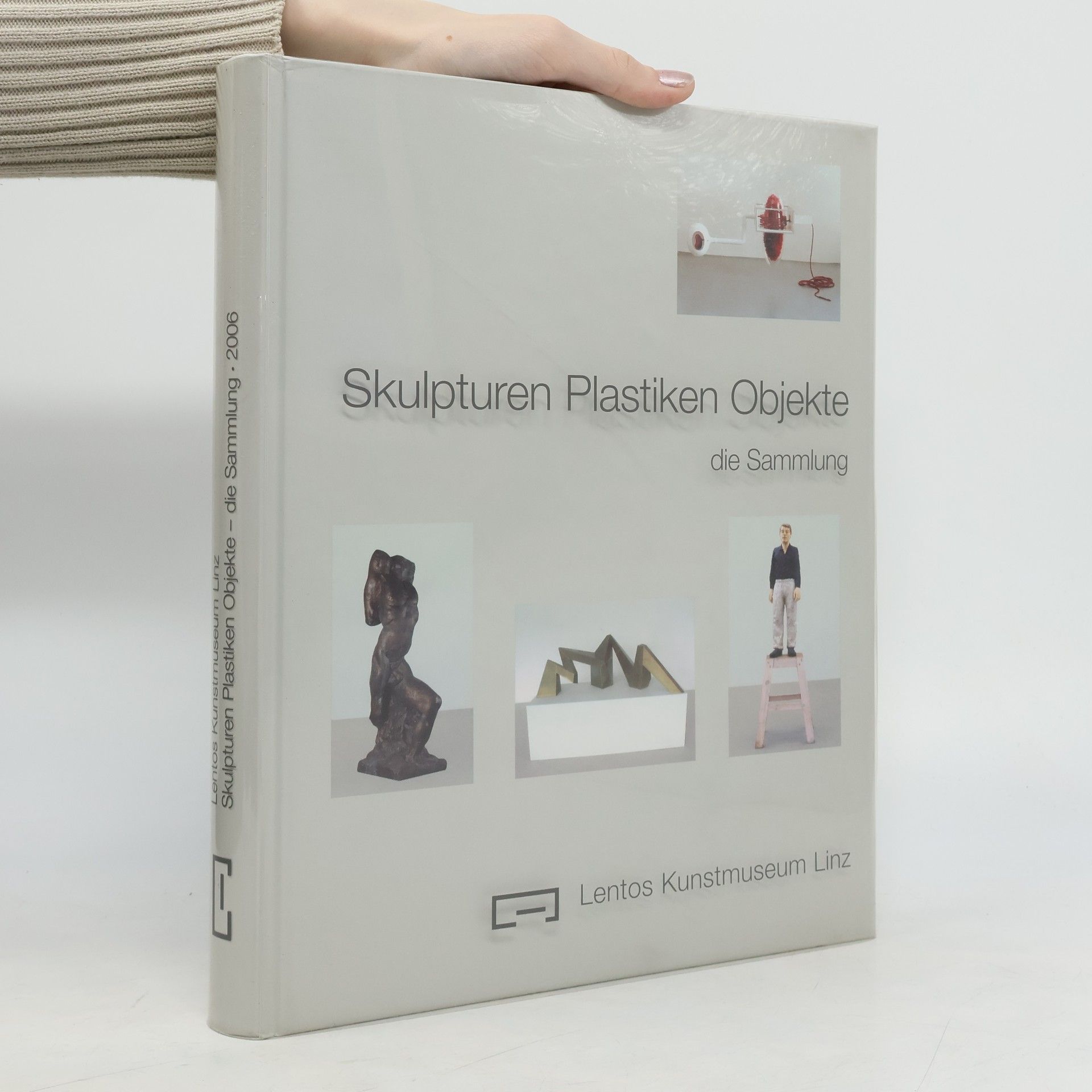
Die umfangreiche Publikation zeigt Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Kunst und Wahn aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Neben Werken Gugginger Art-brut-Künstler wie Johann Hauser, Oswald Tschirtner und August Walla werden Arbeiten von Arnulf Rainer, Peter Pongratz, Adolf Frohner, Hermann Nitsch, Franz Ringel und Alfred Hrdlicka präsentiert. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg waren die österreichischen KünstlerInnen auf der Suche nach dem von der Geschichte unberührten, authentischen Ausdruck in der Kunst. Die 1960er und 1970er waren auch in Österreich von Grenzüberschreitungen zwischen Kunst und Leben, neuen Kunstsparten, Drogenexperimenten und von neuen integrativen Gesellschaftsmodellen geprägt. Abstrakte Kunst, Werke indigener Völker, Arbeiten von Kindern und von psychisch beeinträchtigten Menschen galten als unverbildet und unverfälscht. Auch unabhängig von jenen Einflüssen fanden manche Künstlerinnen zeitgleich oder früher zu formalen Lösungen, die an Art brut erinnern. In der Publikation werden Art-brut-Arbeiten und psychisch durchdrungene Arbeiten österreichischer Künstler gemeinsam präsentiert und vermitteln jenes vom Zeitgeist geprägte Kunstwollen, mit dem eine Generation überkommene Strukturen endgültig hinter sich lassen wollte.