Nietzsche und Beziehungsdilemma! Was könnte besser passen und sich gleichzeitig mehr ausschließen als die pathetisch-ironische Philosophie des großen Unzeitgemäßen und die verwegenen Erwartungen sowie trübenden Niederungen, die sich ereignen, wenn zwei aufeinandertreffen? Der Erzähler Franz schlittert in eine fiktional-reale Dreiecksbeziehung, als die Beziehung zu Rebecca zu erodieren beginnt: Immer mehr steigert sich Franz in einen Monolog mit dem Diagnostiker und Überwinder des Nihilismus hinein, driftet zwischen Selbstauflösung und Bestimmung. Nietzsche als Brennpunkt von Rastlosigkeit. „Je verlotterter das Leben, umso ergiebiger das Denken“, könnte das Motto von Franz sein, einem sich an seinem Übervater wundreibenden modernen Menschen, der seine Identität findet, indem er sich verliert.
Alexander Peer Bücher




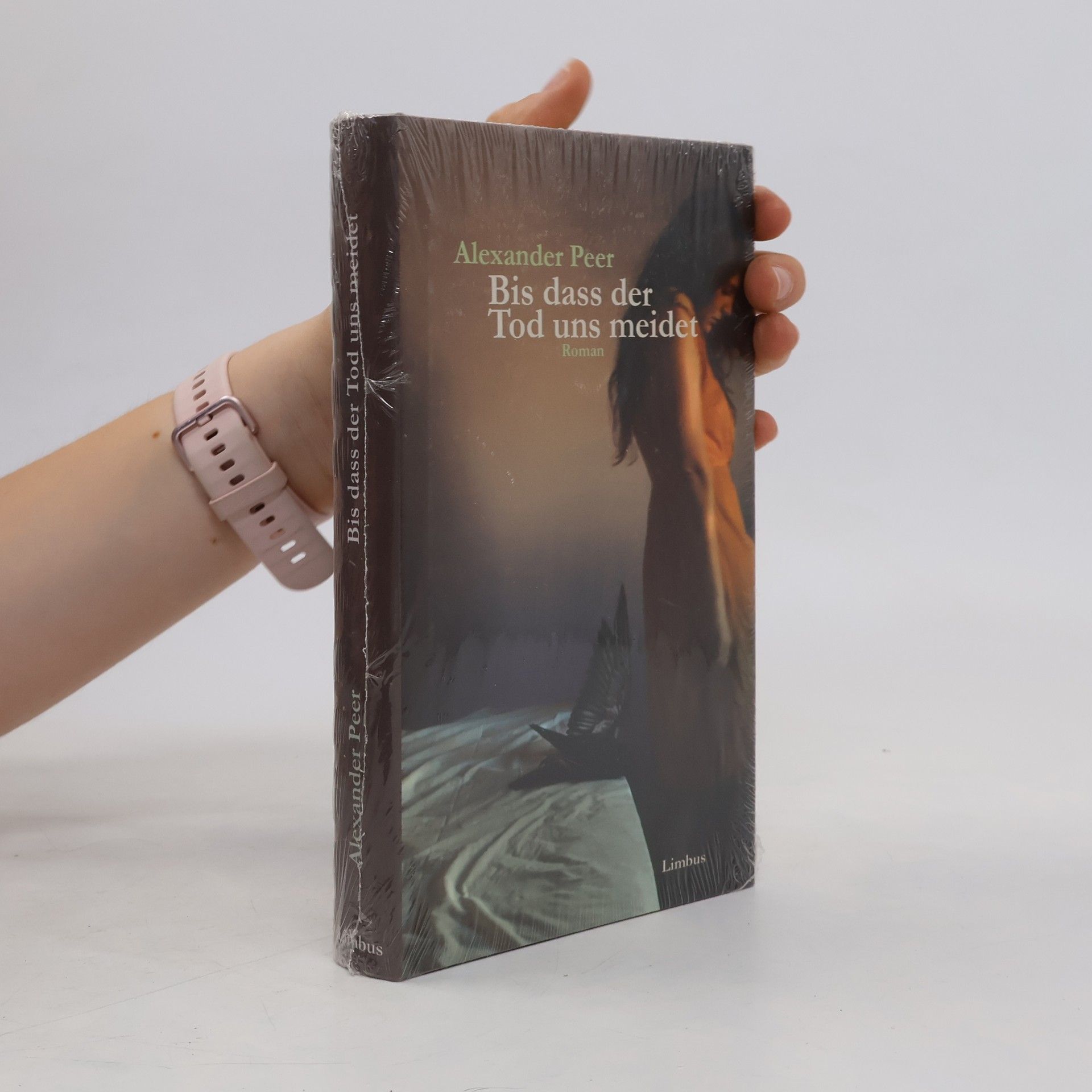
Gin zu Ende - achtzehn Uhr
Gedichte
Fabelhafter Pinzgau Wir schreiben das Jahr 15 vor Christus. Ganz Noricum ist von den Römern besetzt … Ganz Noricum? Nein, ein von unbeugsamem Abisonten besetztes Gebiet bei Salzach und Saalach hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Der Pinzgau hat viel mehr Geschichte zu bieten, als man vermuten würde. Dank abenteuerlicher Fügungen und dramatischer Entscheidungen steckt das Land voller Entdeckungen. Dass es mit einer fabelhaften Bergwelt, saftigen Almen und malerischen Tälern und Wäldern zu berühren weiß, spürt man sofort.
Land unter ihnen
Novelle
Als Hernando Cortés im Jahre des Herrn 1519 vor der Küste von Mexiko landet, ändert sich die Geschichte eines ganzen Volkes. Der mächtige Aztekenherrscher Moctezuma beschwichtigt den „weißen Gott“ mit Gold, entfachte dadurch dessen Gier und Mordlust und befestigt bei den Spaniern den Wunsch, das Land unter ihnen zu unterwerfen. Packend und einfühlsam zugleich erzählt Alexander Peer von der Eroberung Mexikos, vom Streben nach Macht und Reichtum, nicht ohne Bezug auf die Schattenseiten des – modernen – Kolonialismus.
Klappentext Uhrmann: „Mein Name ist verschwunden, weil ich die Zeit hatte, ihn zu vergessen.“ Erwin Uhrmann setzt in seinen Erzählungen verlorene Personen im Baltikum aus. Ein Reisender, der seine sexuelle Identität nicht findet und sich in die synchrone Anwesenheit einer verstorbenen Freundin flüchtet. Orte, die nur in der Vorstellung existieren, bis sie bereist werden. Der Nordosten Estlands mit vereisten und rostigen Zäunen, an denen ein Grenzbewohner zerbricht. Die gestörte Beziehung einer Frau zu ihrer Familie im Spiegel der Geschichte, zurückreichend bis zum Trauma, das der Krieg verursacht hat. Eine über ein Leben gedehnte Trennung, deren Ursprung in der Illusion einer baltischen Kindheit in Österreich liegt.