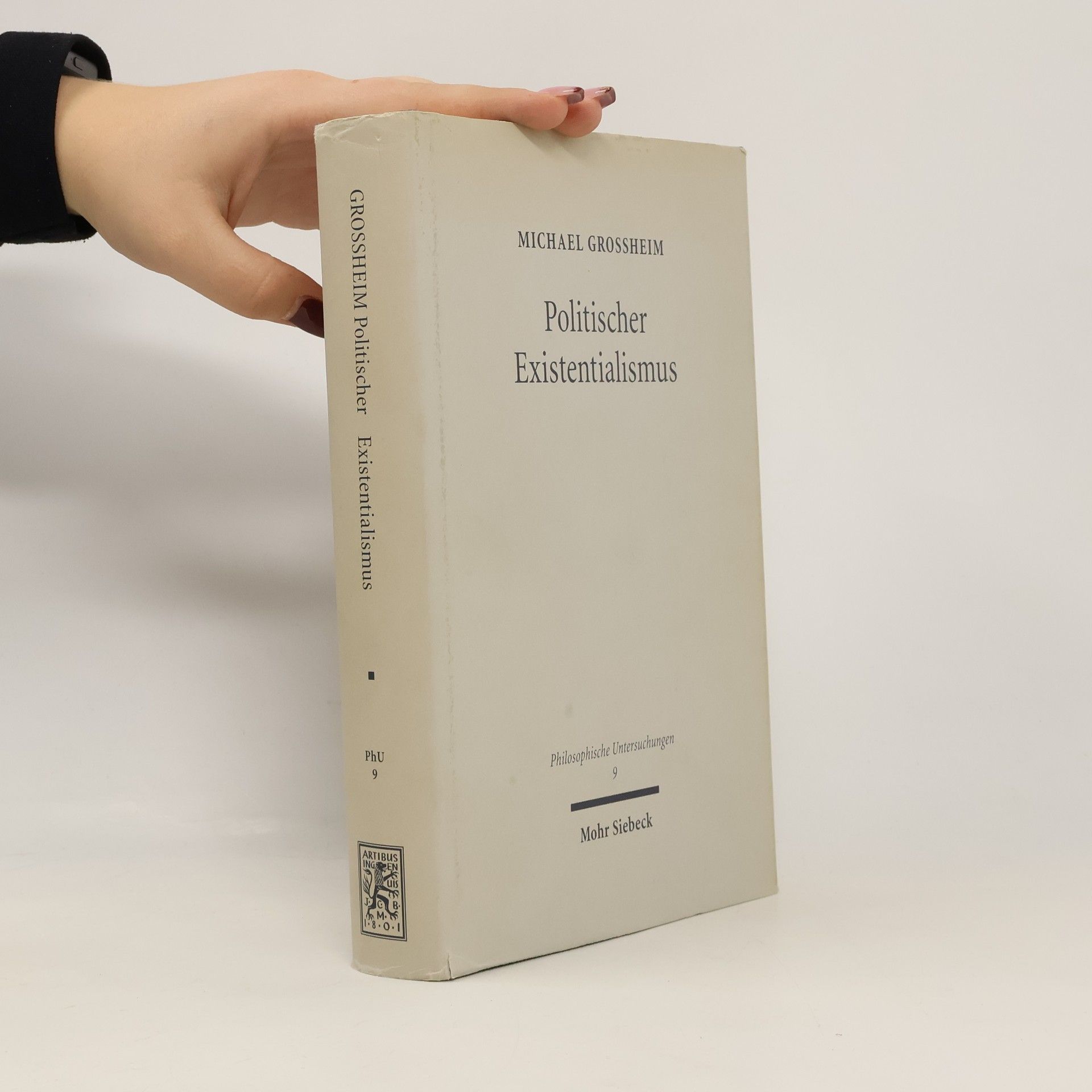Politischer Existentialismus
Subjektivität zwischen Entfremdung und Engagement
Die in der gegenwärtigen Diskussion allein auf den Islam projizierte Haltung des amoralischen Selbsteinsatzes muß in einen größeren Kontext gestellt werden. Was neuerdings Befremden und Ratlosigkeit auslöst, ist als politischer Existentialismus ein Bestandteil unserer eigenen Kultur, der auf eine zweihundertjährige Tradition zurückblicken kann. Michael Großheim stellt die philosophischen Wurzeln dieser „unheimlichen Welt absoluter Selbstlosigkeit“ (Hannah Arendt) dar, indem er Texte und Ideen von Friedrich Schlegels Konzept der „Selbstvernichtung“ über Hegels Gedanken der „Abstraktion von sich selbst“ und Georg Lukács' Ideal einer „völligen Aufgabe der Persönlichkeit“ bis hin zu Gudrun Ensslins opferbereiter „heiliger Selbstverwirklichung“ analysiert. Der Autor bietet eine historisch breit angelegte, materialreiche Studie über Phänomene der Selbstentfremdung und Formen ihrer Bewältigung. Sein Ziel ist nicht eine bloße Kulturkritik, die das Problem etwa als Verfallsphänomen der Moderne kennzeichnet, sondern die philosophisch fundierte Entzauberung der „unheimlichen Welt absoluter Selbstlosigkeit“.