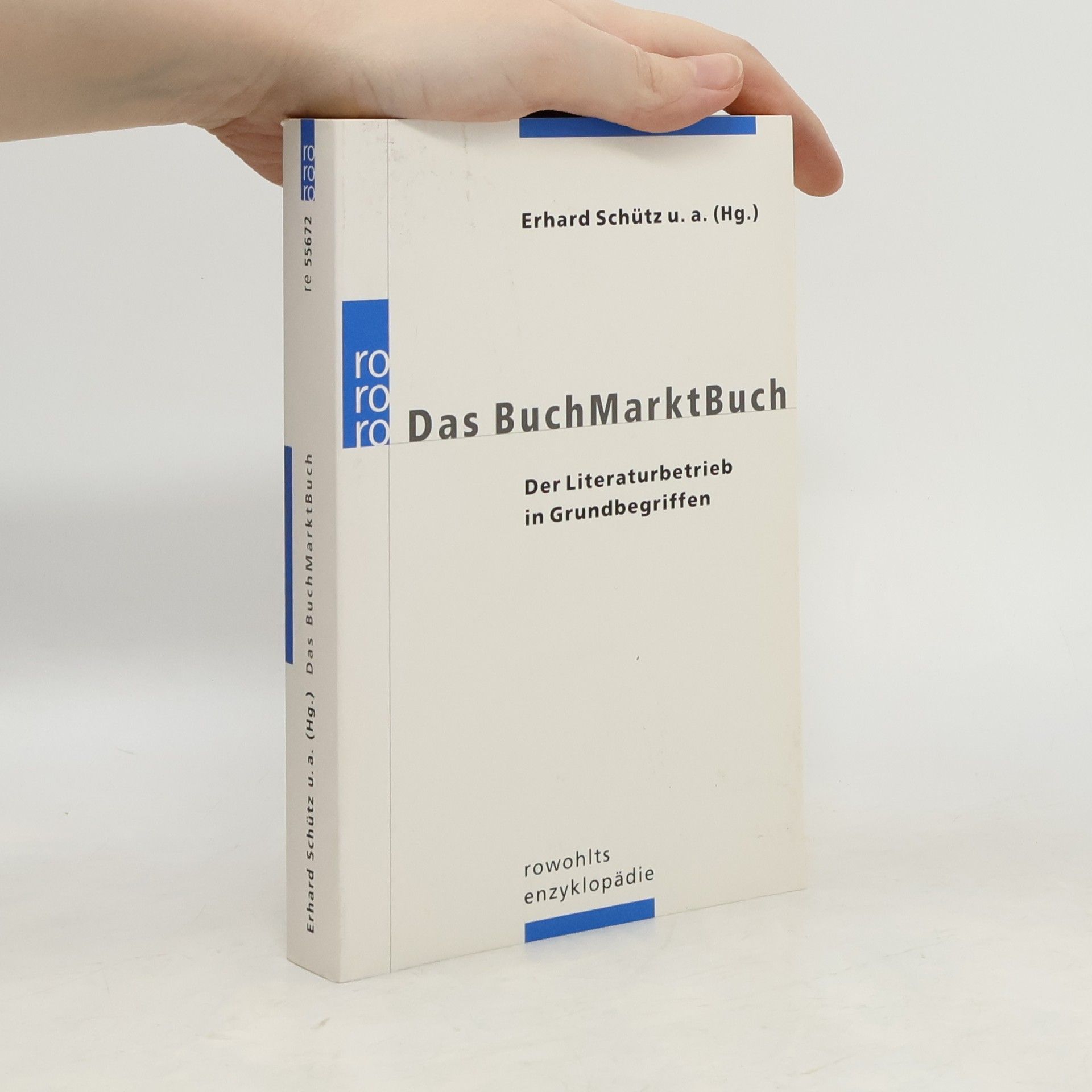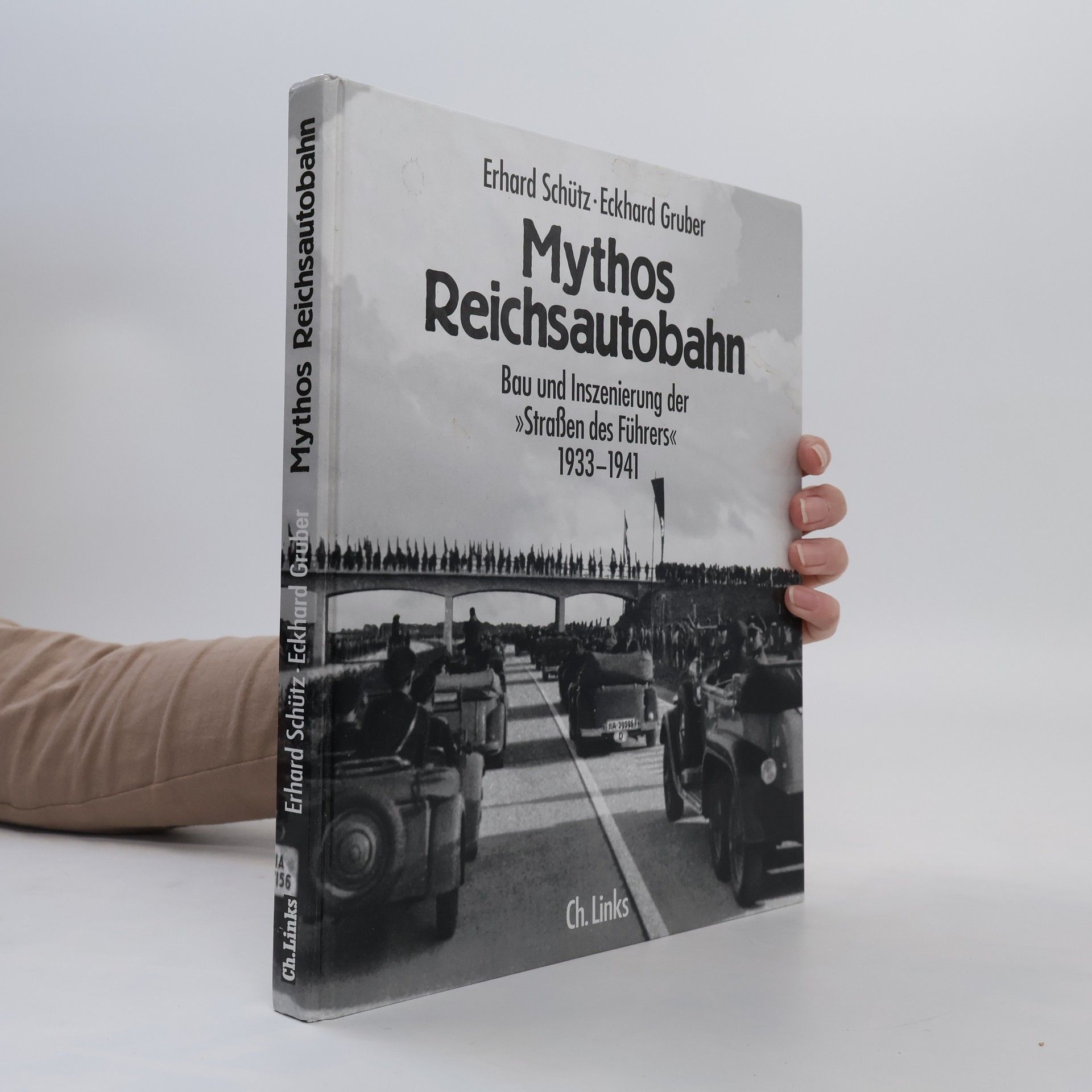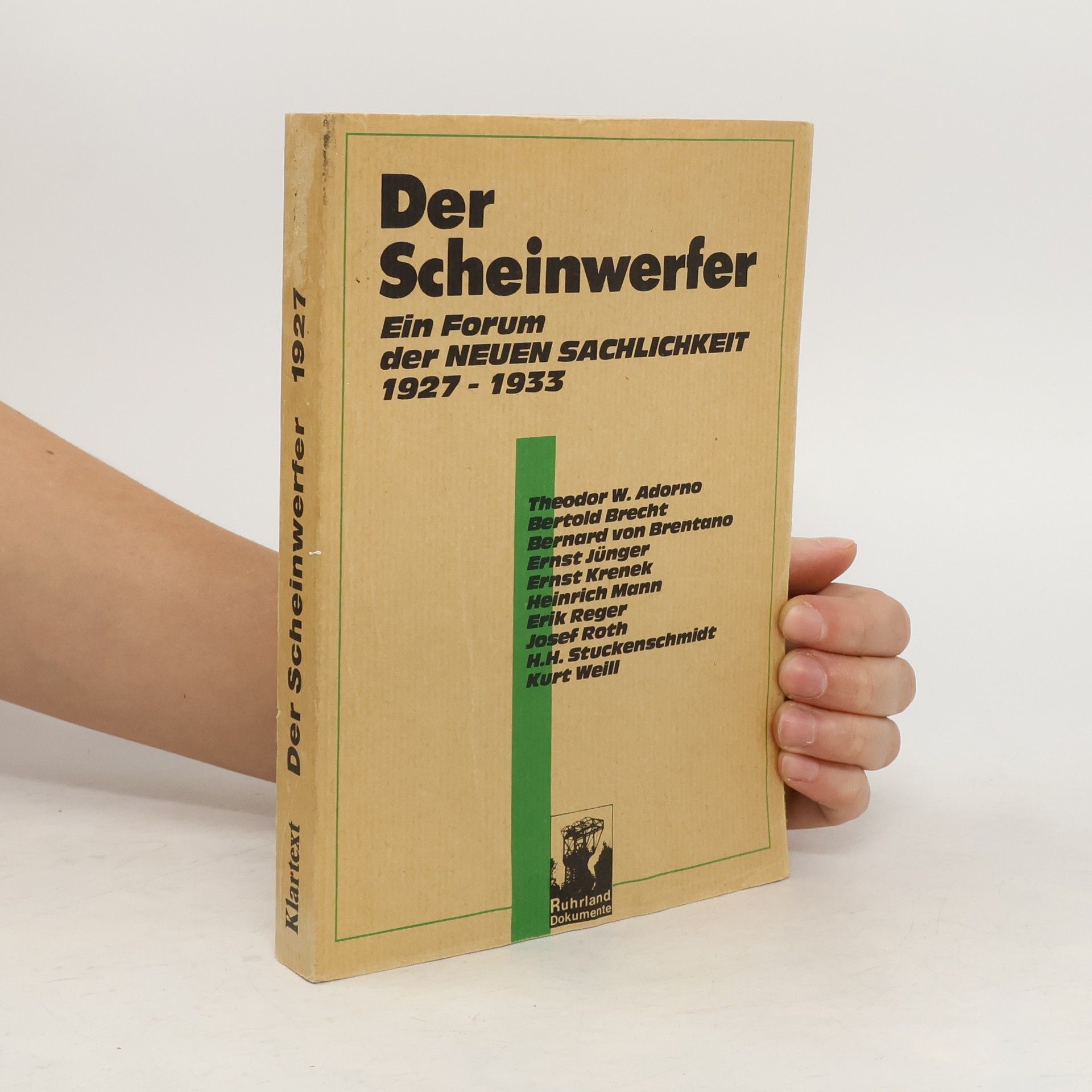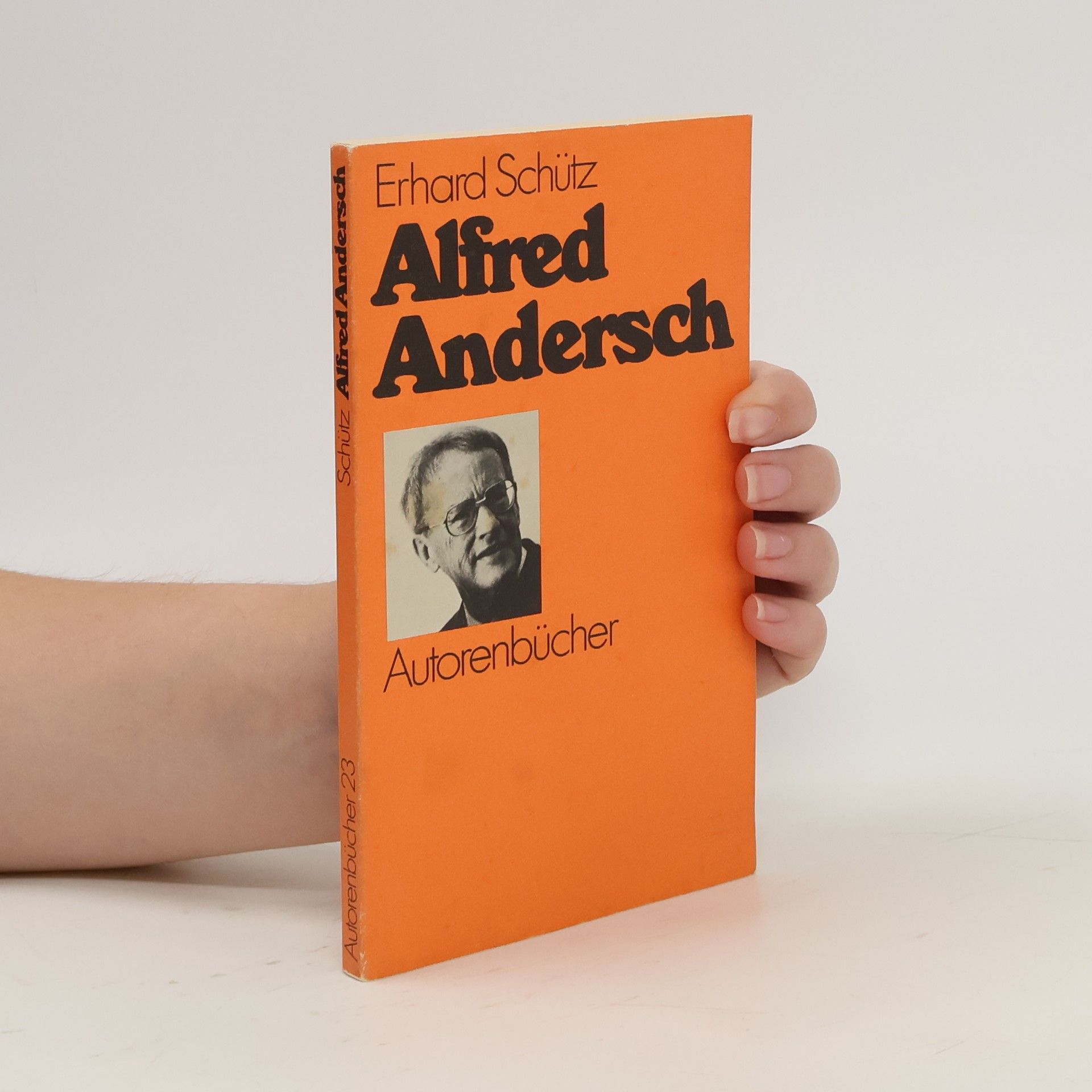100 Billionen
Eine historisch-literarische Zeitreise durch die Inflation
Geld regiert die Welt. Zwar ist das so, auch in Deutschland – auch in Deutschland. Nur gehört es hierzulande zum guten Ton, sich nicht allzu detailliert über Finanzen auszulassen. Doch es gab einmal eine Zeit, da redeten und schrieben alle vom Geld. Es lag buchstäblich auf der Straße und es war tagtäglich in allen Zeitungen: die große Inflation 1923. Die hier versammelten Texte geben einen unmittelbaren Eindruck in das Verhalten und die Mentalität jener Zeit. Chronologisch angeordnet, lassen sie erahnen, was alles gleichzeitig in den Köpfen vorging – denen der Autorinnen und denen der Menschen, an die sie sich wandten –, die sie erheitern oder beschwichtigen wollten, um ihnen die Situation zu illustrieren, anekdotisch zu erläutern oder zumindest kurzfristig gute Laune zu machen. Der Sog, der immer schneller kreisende Wirbel lässt sich auch heute noch nachvollziehen. Andererseits die Erleichterung und dann die Wut, als der „Spuk“ vorüber war. IN den Geschichten von Profiteuren, Verlierern oder glimpflich Davongekommenen entsteht damit ein Sitten- und Gesellschaftsbild ganz besonderer Art.
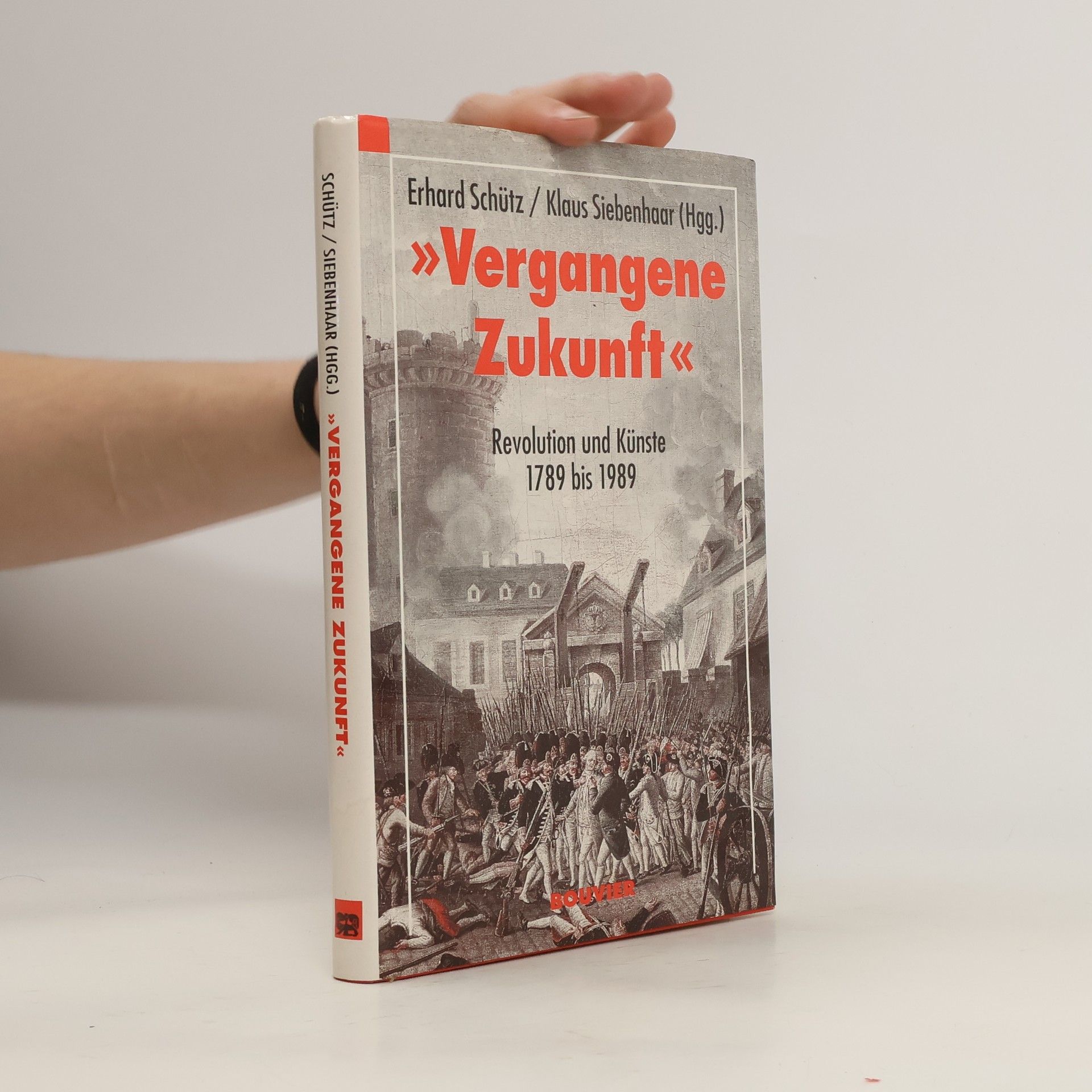

![Einführung in die deutsche Literatur des 20. [zwanzigsten] Jahrhunderts](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/37972700.jpg)