Anwendungsfelder der Verkehrspsychologie
- 846 Seiten
- 30 Lesestunden

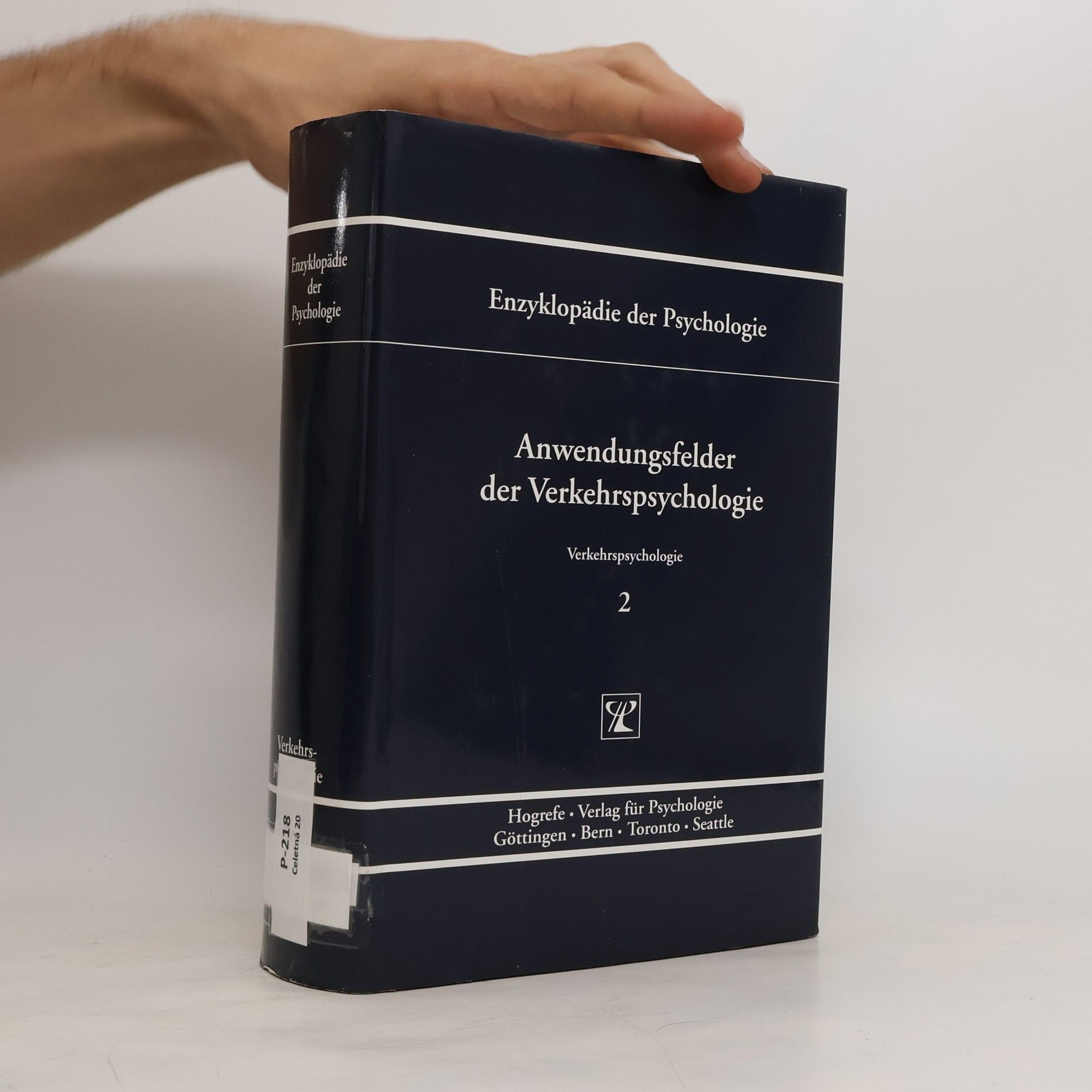
Wahrend seit einiger Zeit im Feuilleton ein Kulturkampf zwischen Vertretern des "Gehirns" und des "Geistes" ausgefochten wird, haben fuhrende Neurobiologen und Philosophen unter Beteiligung einer Soziologin, eines Mathematikers und zweier Physiker - in der "Deutschen Zeitschrift fur Philosophie" eine Sachdiskussion zu den Grenzfragen der Hirnforschung gefuhrt. Neben der hier vorgelegten vollstandigen Neuedition dieser Auseinandersetzung umfasst ca. ein Drittel des Bandes samtliche Beitrage einer bisher unveroffentlichten Schlussrunde, die eine vorlaufige Bilanz zieht, die strittig bleibt. Alle Diskussionsteilnehmer sind sich in der Intention einig, dass weder der reduktive Naturalismus noch der ontologische Dualismus von Gehirn und Geist uberzeugen konnen. Uneins bleiben aber nicht nur die Neurobiologen und Philosophen gegen einander, sondern auch die Philosophen und die Neurobiologen jeweils untereinander. Der Dissens betrifft die Frage, wie ihre schwache Gemeinsamkeit methodologisch und geschichtlich, ontologisch und ontisch so durchgefuhrt werden kann, dass keine Selbstwiderspruche eintreten: Fur die Erfullung des eigenen Anliegens wird noch etwas Anderes in Anspruch genommen, als man selbst zugleich zu erklaren vermag. Personale Lebewesen bzw. lebende Personen vollziehen sich anders, als dualistisch konzipiert werden kann."