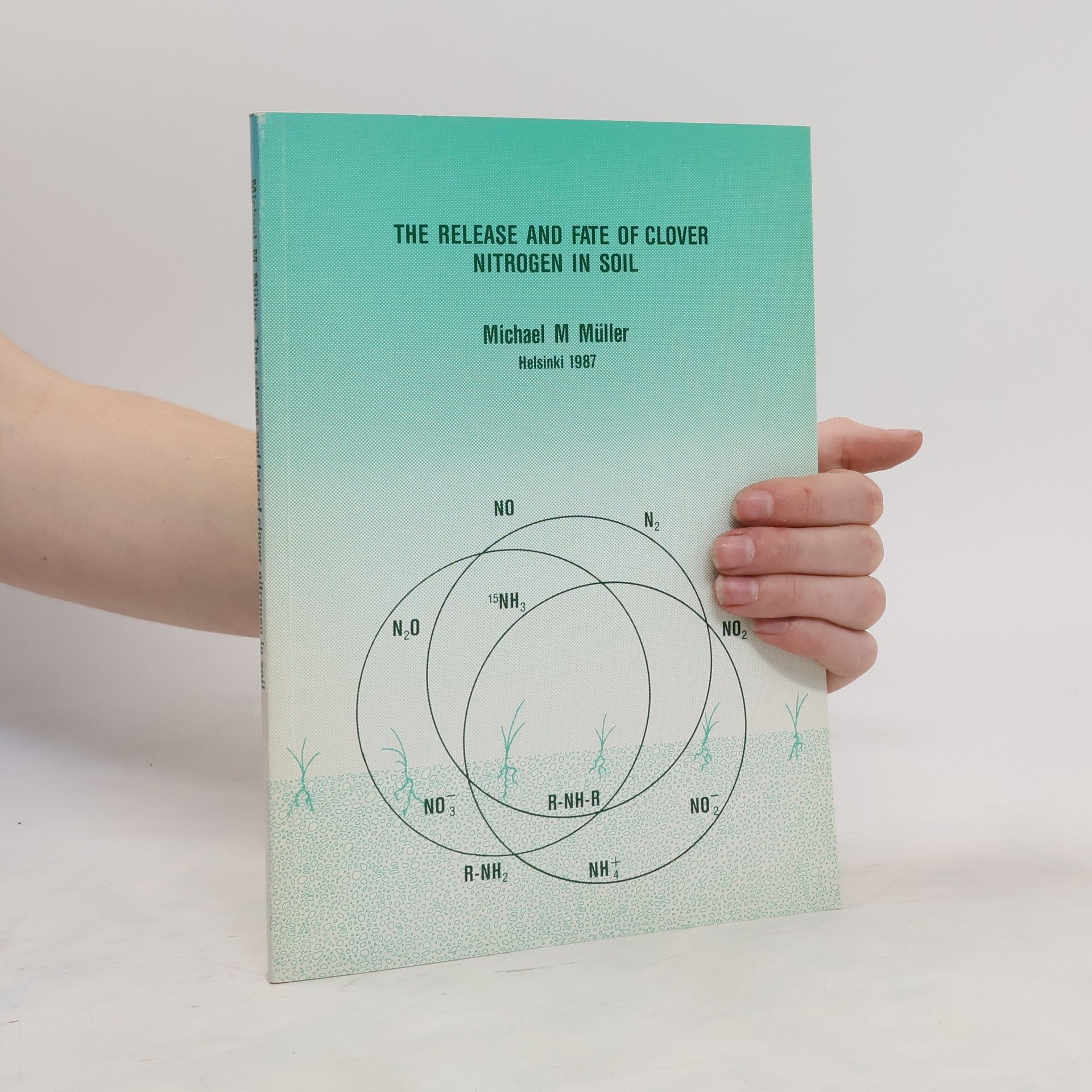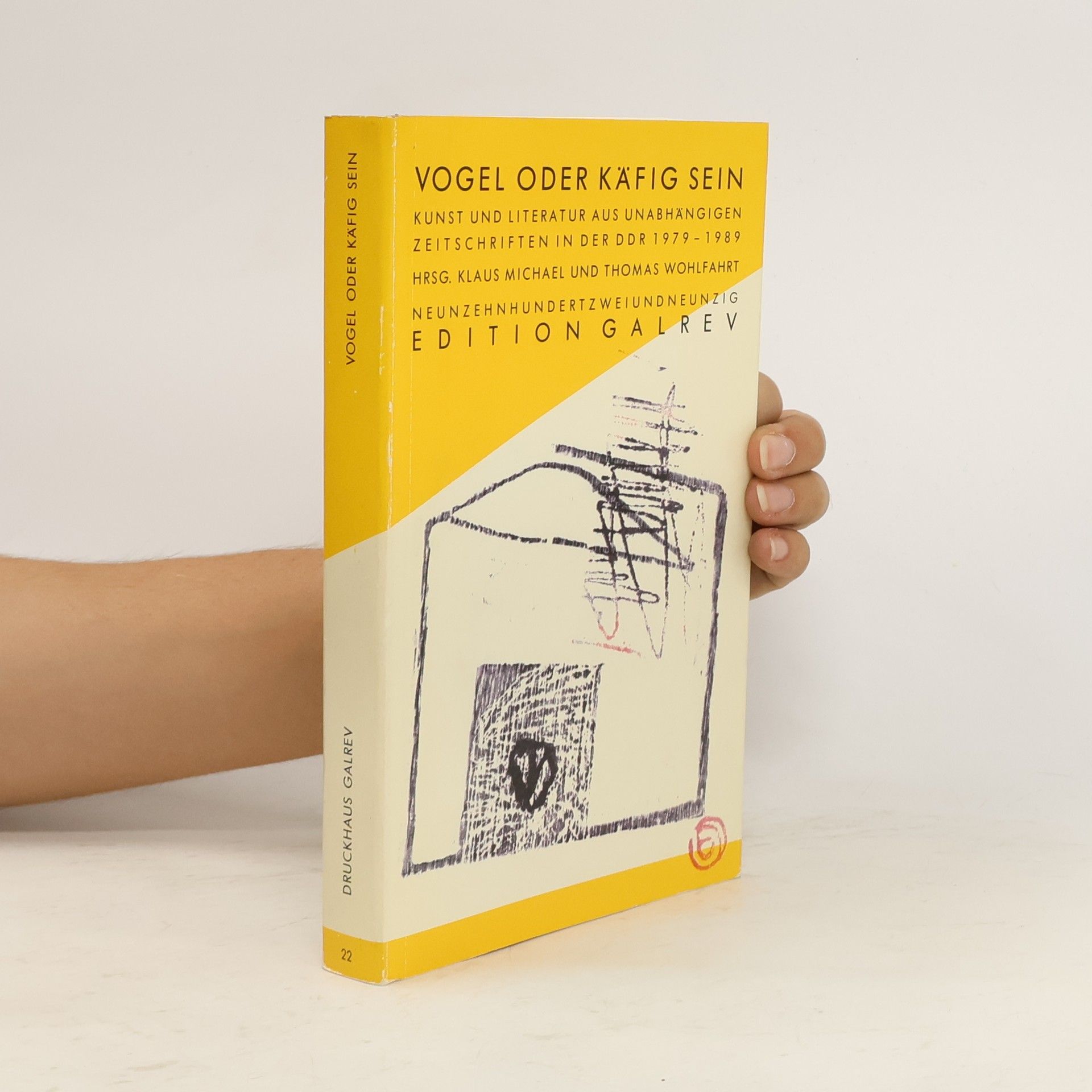1933 - Die Versuchung der Theologie.
- 150 Seiten
- 6 Lesestunden
Der zeitliche Abstand zu einer Epoche schwerer Krisen erschwert es, die Ambivalenzen des geschichtlichen Augenblicks zu erkennen. Die geisteswissenschaftliche Theoriearbeit nach 1933 reflektiert den Druck, dem kollektiven Wunsch nach Neuorientierung zu entsprechen. Der Autor konzentriert sich auf anspruchsvolle Texte der evangelischen Theologie und analysiert, wie vertraute Denktraditionen mit der Aufgeschlossenheit für den autoritären Führerstaat vereinbar waren. Das moralische Urteil über den Nationalsozialismus als System des Verbrechens ist eindeutig. Diese Distanznahme und das Gefühl moralischer Überlegenheit gegenüber früheren Generationen mindern die Energie, die geistigen Konstellationen in den Fachgebieten zu untersuchen, in denen eine Neuorientierung vom demokratischen Pluralismus zur Führer-Diktatur vorbereitet wurde. Diese Vorbereitung fand auf hohem Reflexionsniveau statt, sodass von einer Primitivität der Diskurse nicht die Rede sein kann. Der Autor zeigt, wie Heiliger Geist und Zeitgeist in dem Bemühen um Orientierung miteinander verwoben sind, insbesondere an Texten der evangelischen Theologie, die von der Führervollmacht Jesu zur Führervollmacht Adolf Hitlers führen.