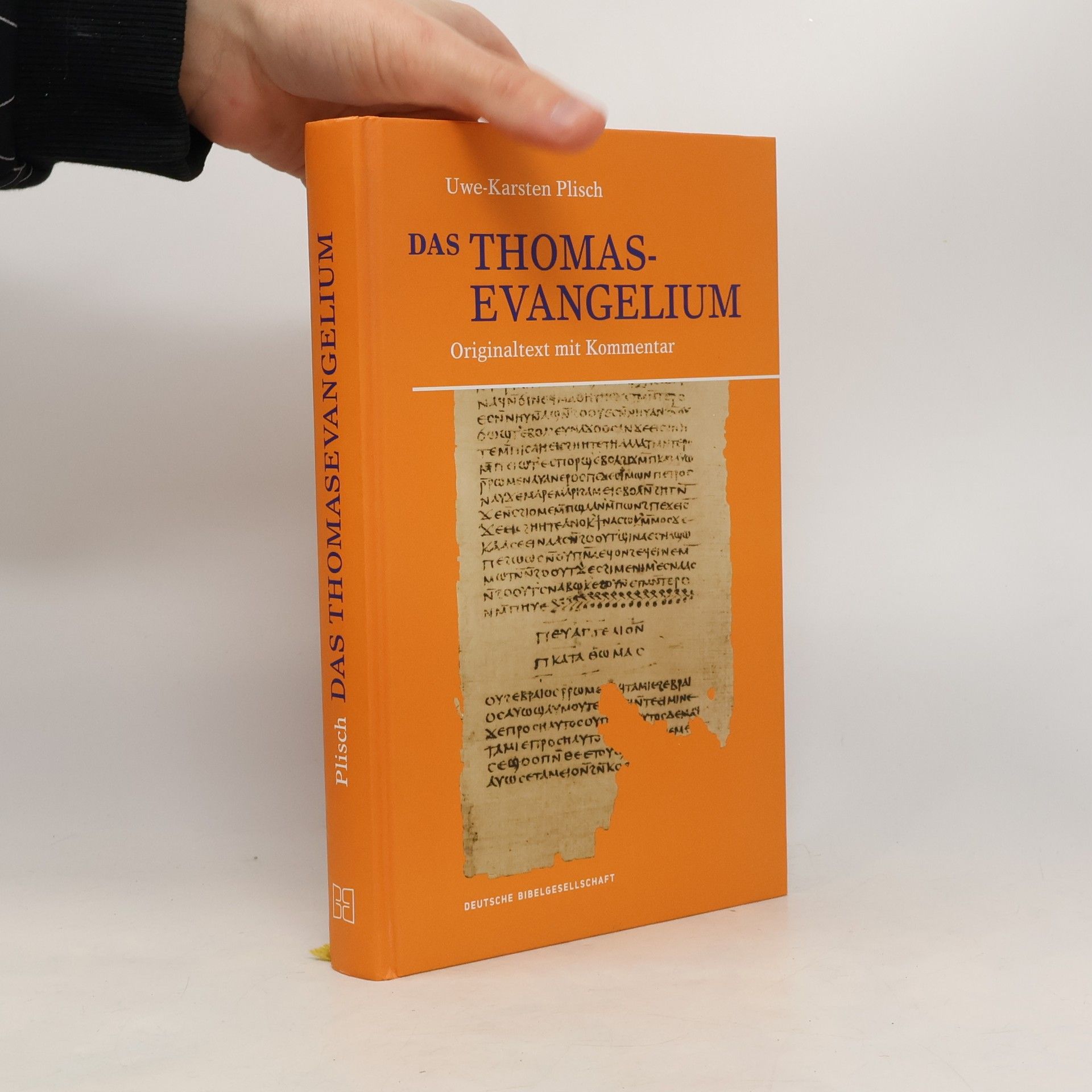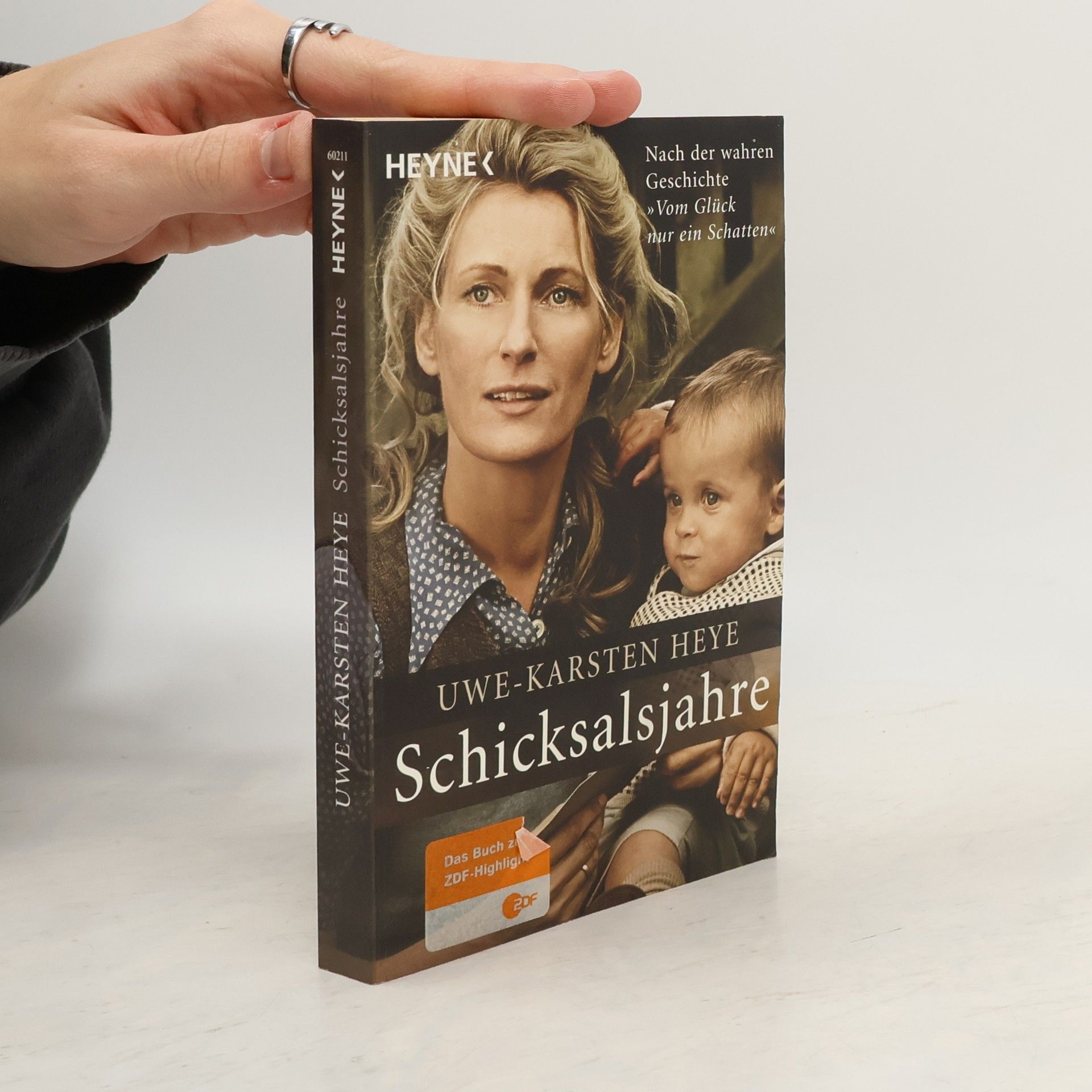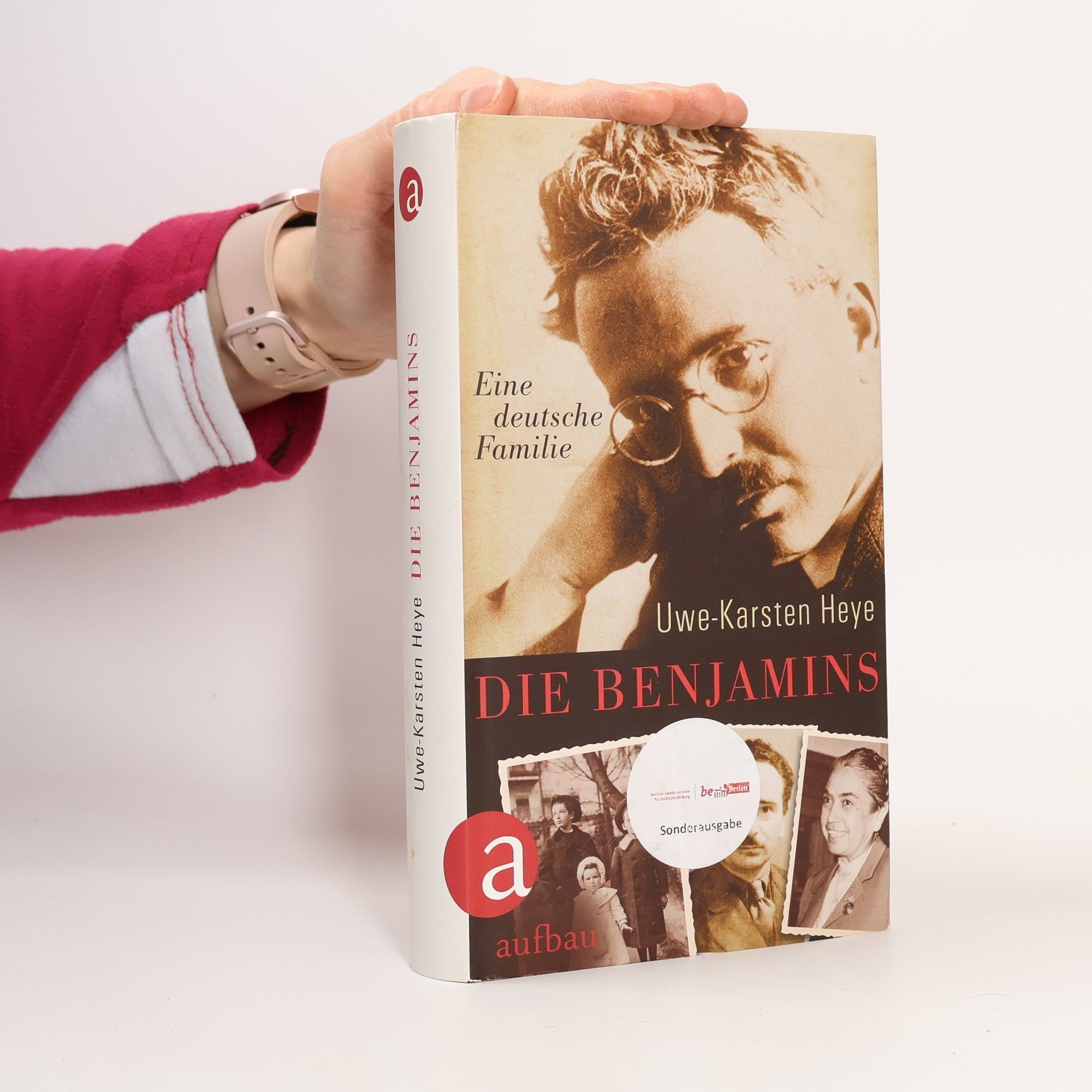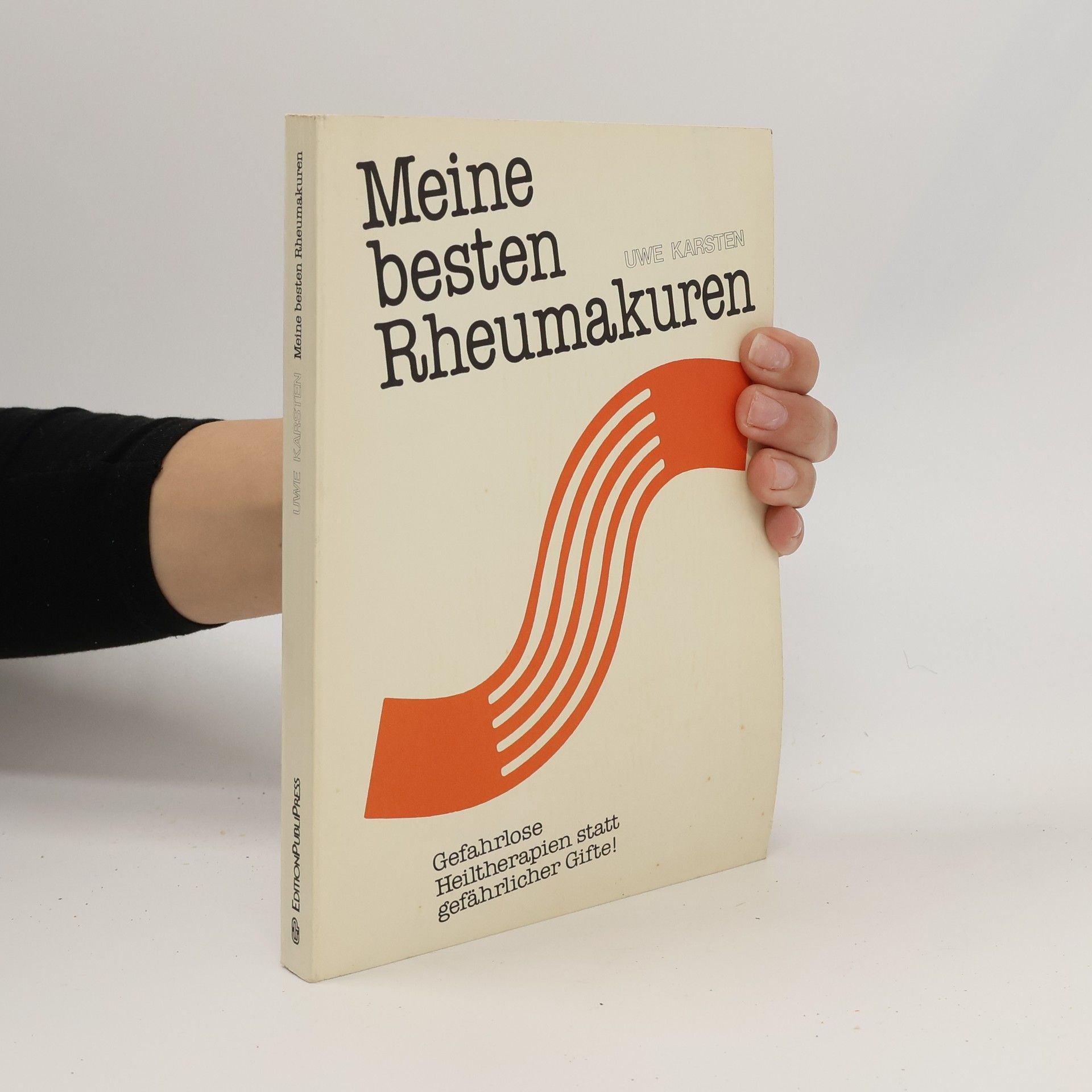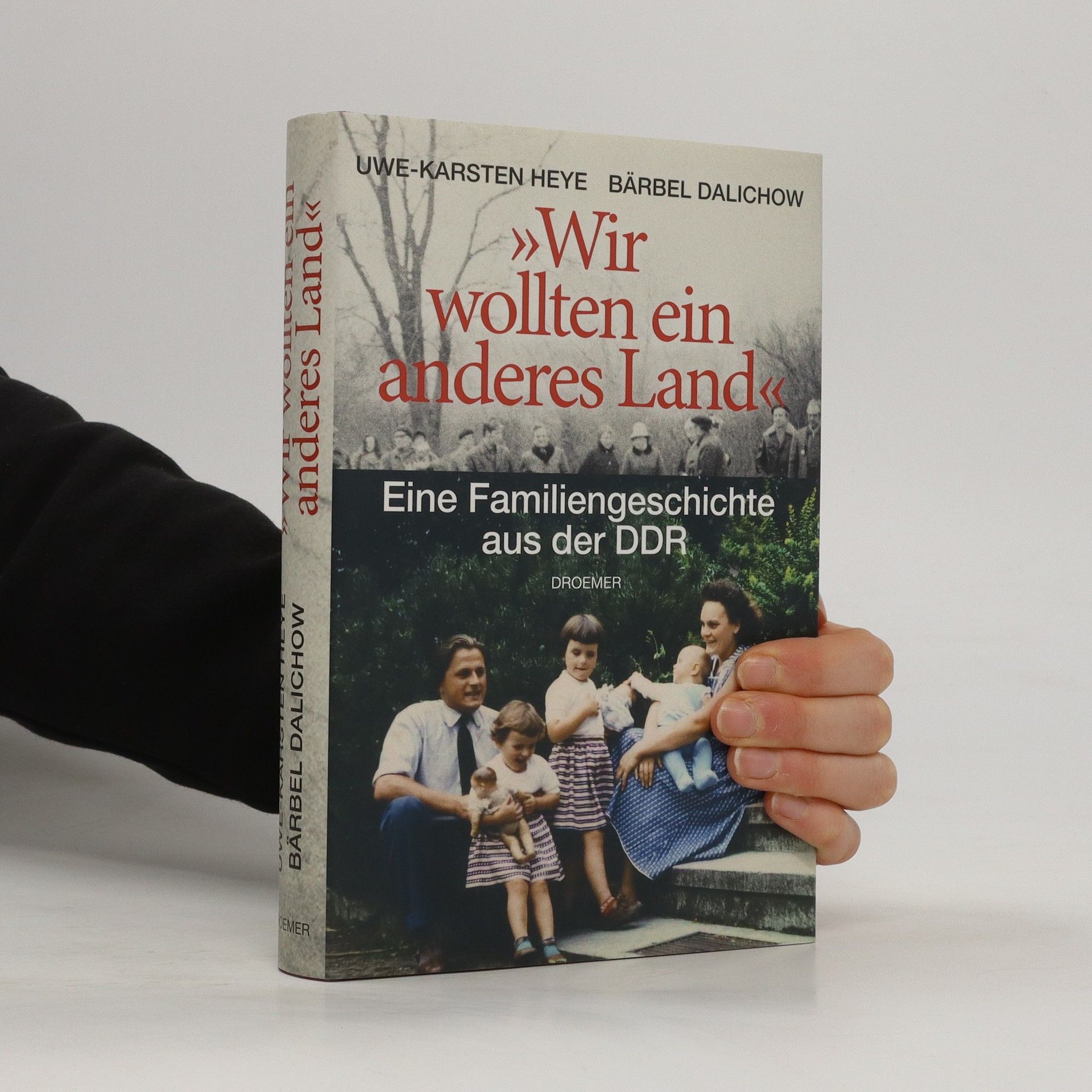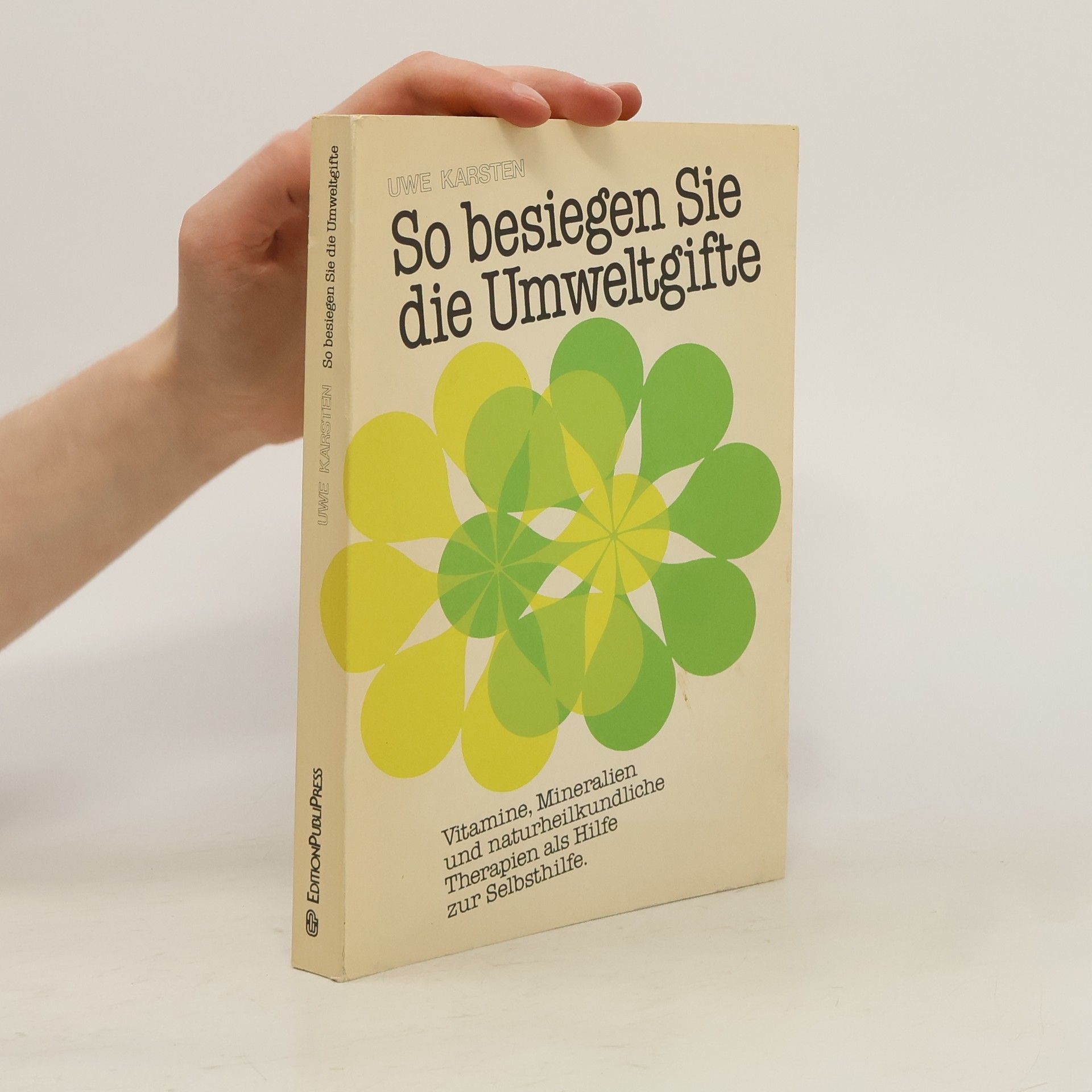Einführung in die koptische Sprache
Sahidischer Dialekt
Diese Einführung in die koptische Sprache stellt alle Grundzüge und Grundbausteine des Koptischen anhand des sahidischen Dialektes dar. Bei der Gestaltung wurde darauf Wert gelegt, auch nicht-standardisierte Formen zu erfassen und darzustellen, damit sich das Buch als begleitendes Hilfsmittel etwa zur Lektüre von Nag-Hammadi-Texten eignet. Diese Funktion wurde bereits bei der Auswahl der im Anhang gebotenen Übungstexte berücksichtigt. Ein Glossar mit der Erklärung sprachwissenschaftlicher Termini und ein ausführliches Sachregister am Schluß des Bandes erleichtern die Handhabung. Der Aufbau des Buches ermöglicht rasches Wiederfinden einmal erlernter Formen und Satzmuster. Damit ist es insbesondere als Begleitbuch zum Koptischunterricht und als Nachschlagewerk für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Interessierten, die bereits Erfahrungen im Erlernen alter Sprachen haben, kann es darüber hinaus auch zum Selbststudium dienen.