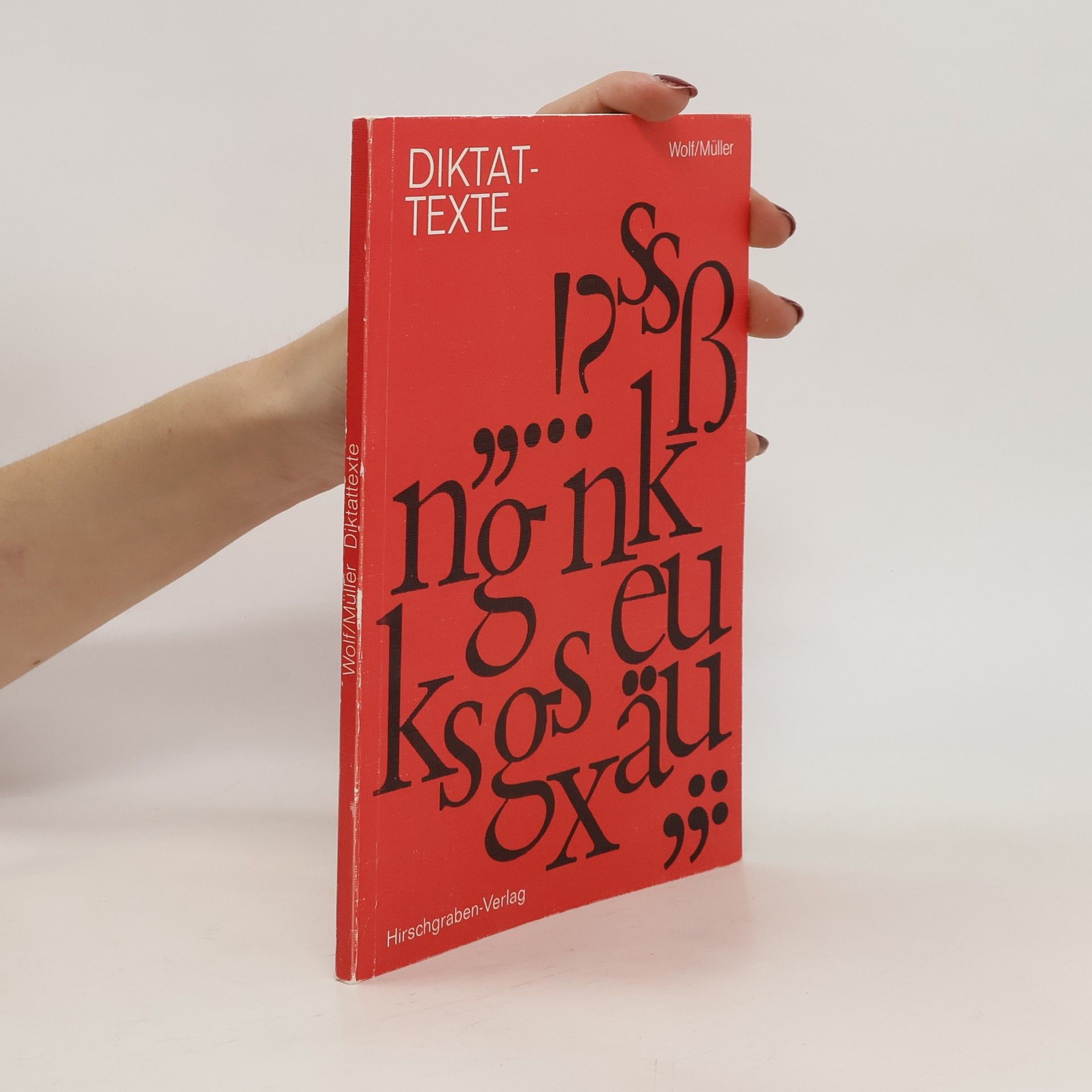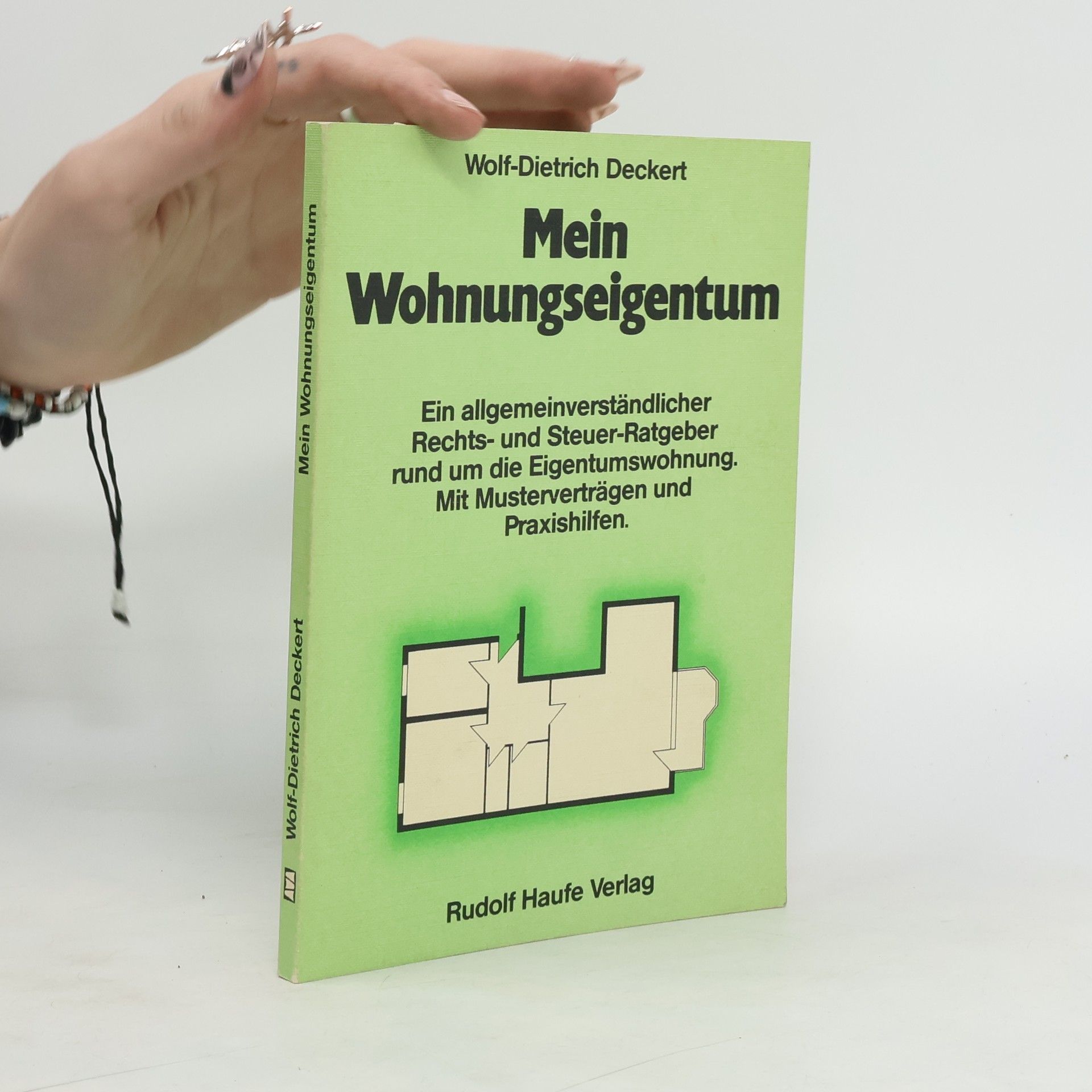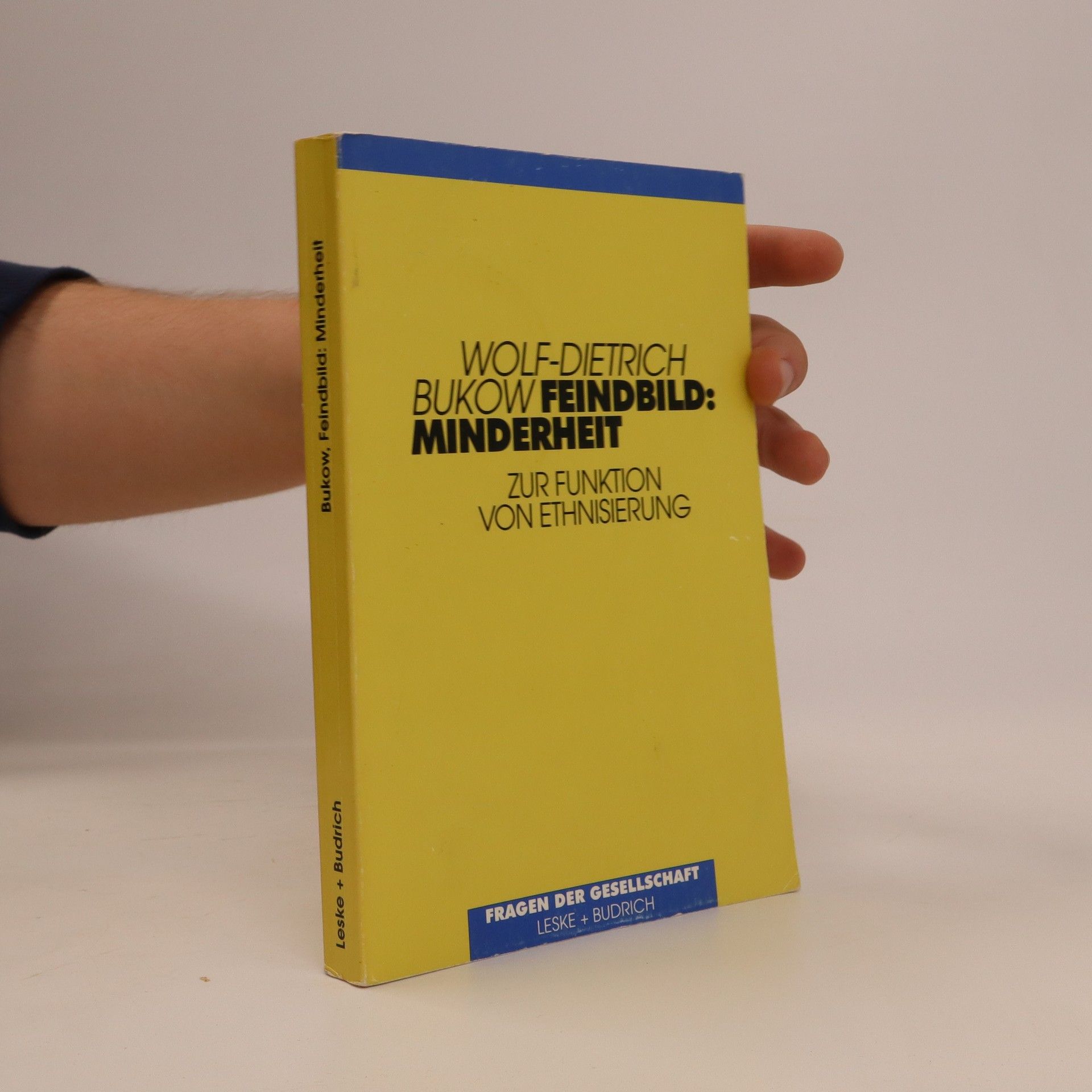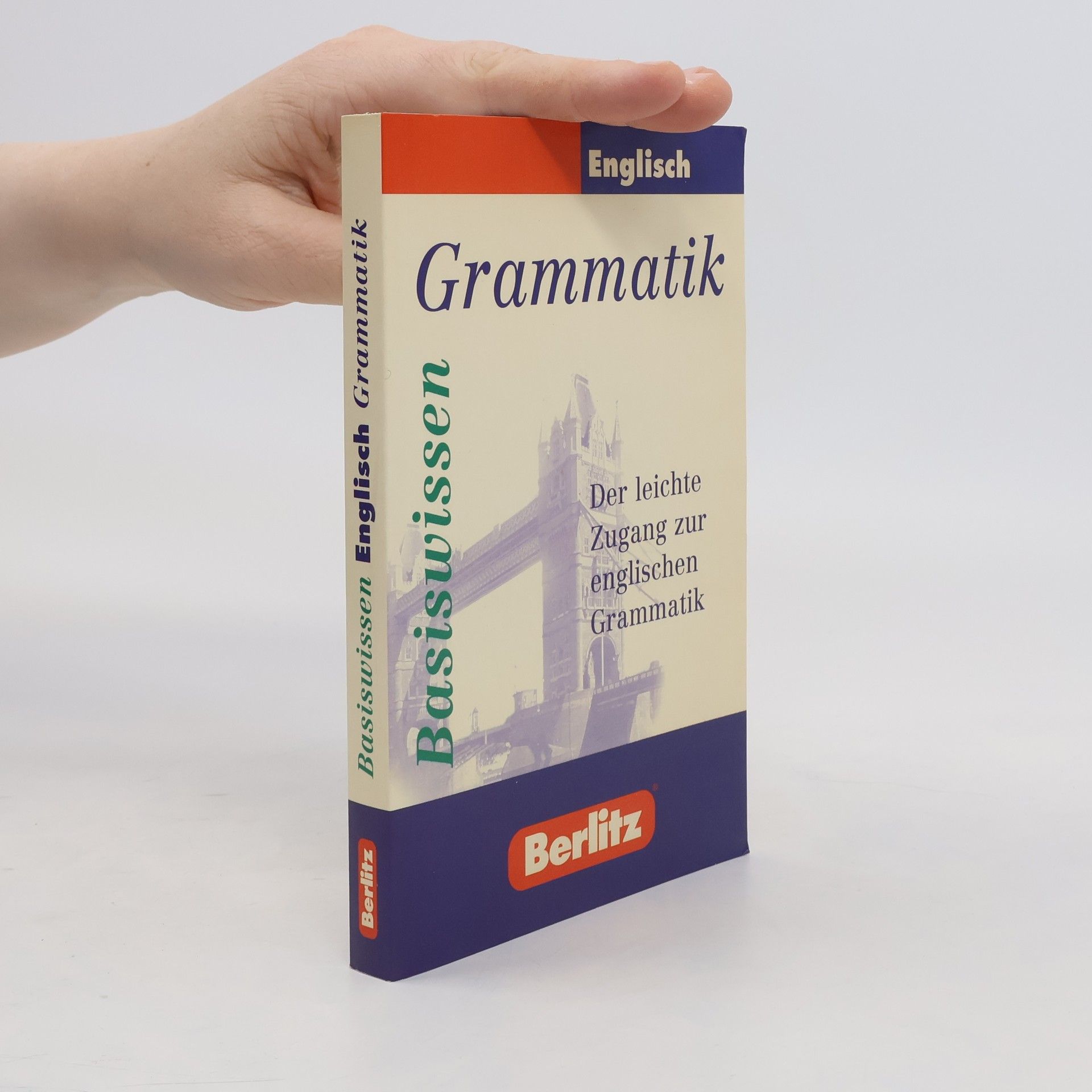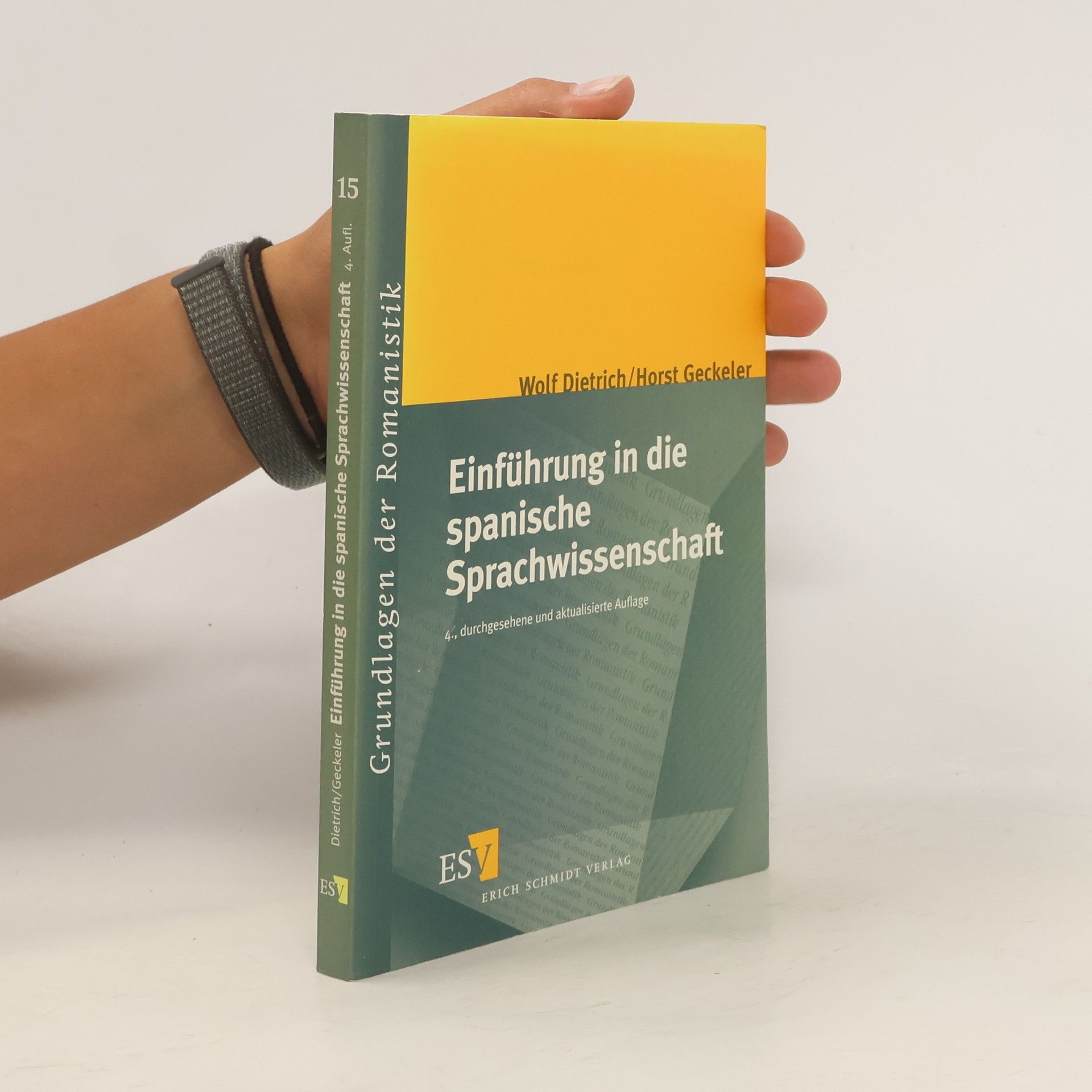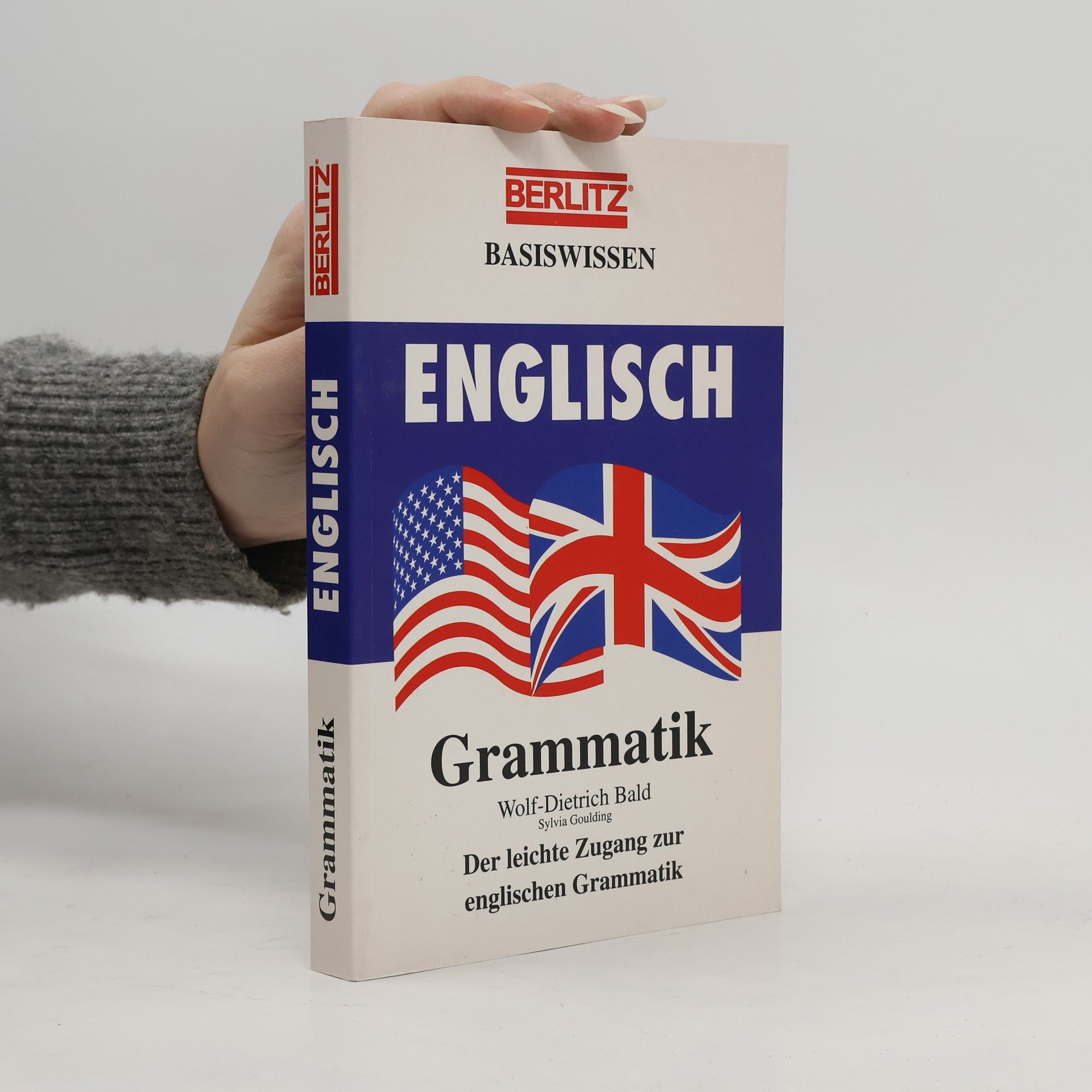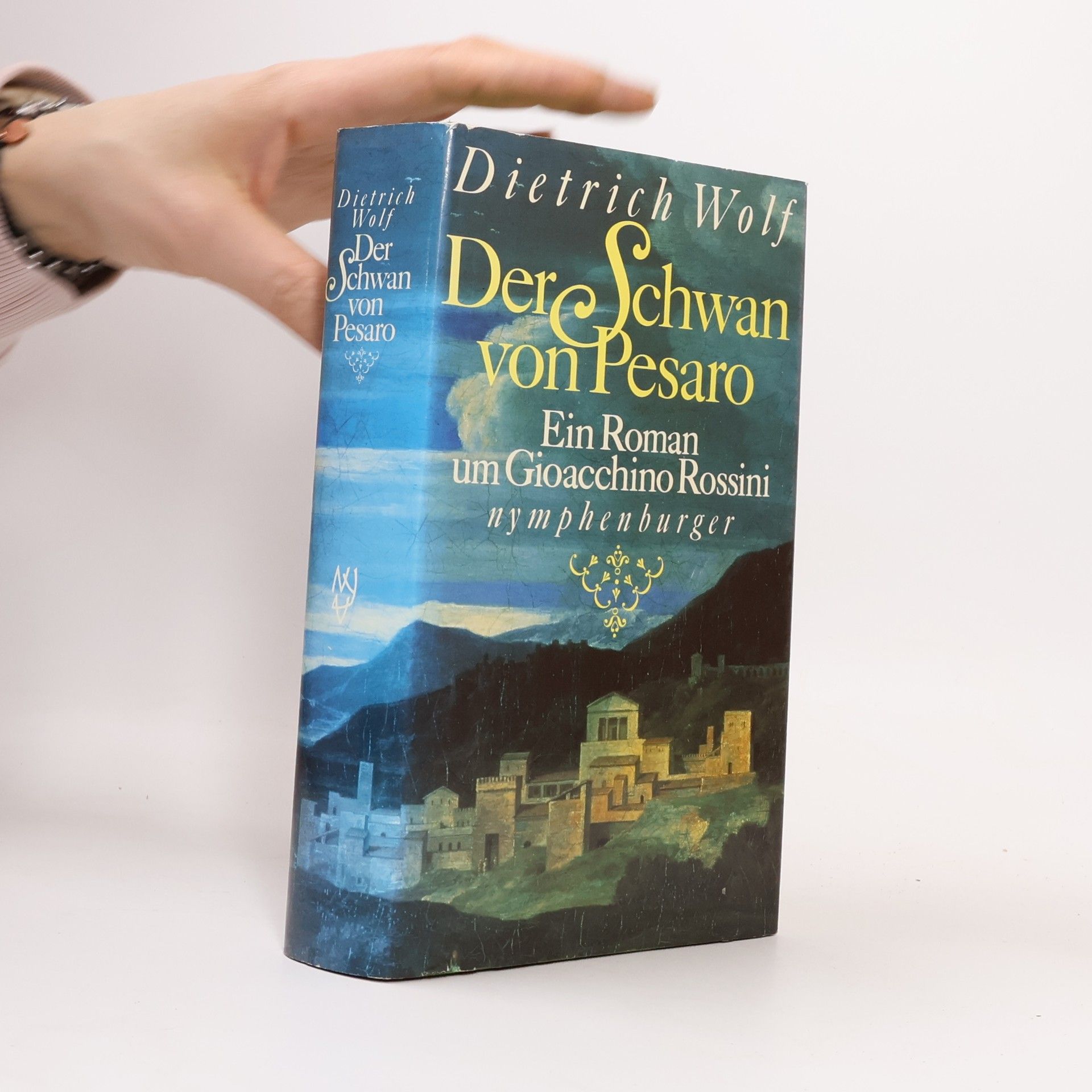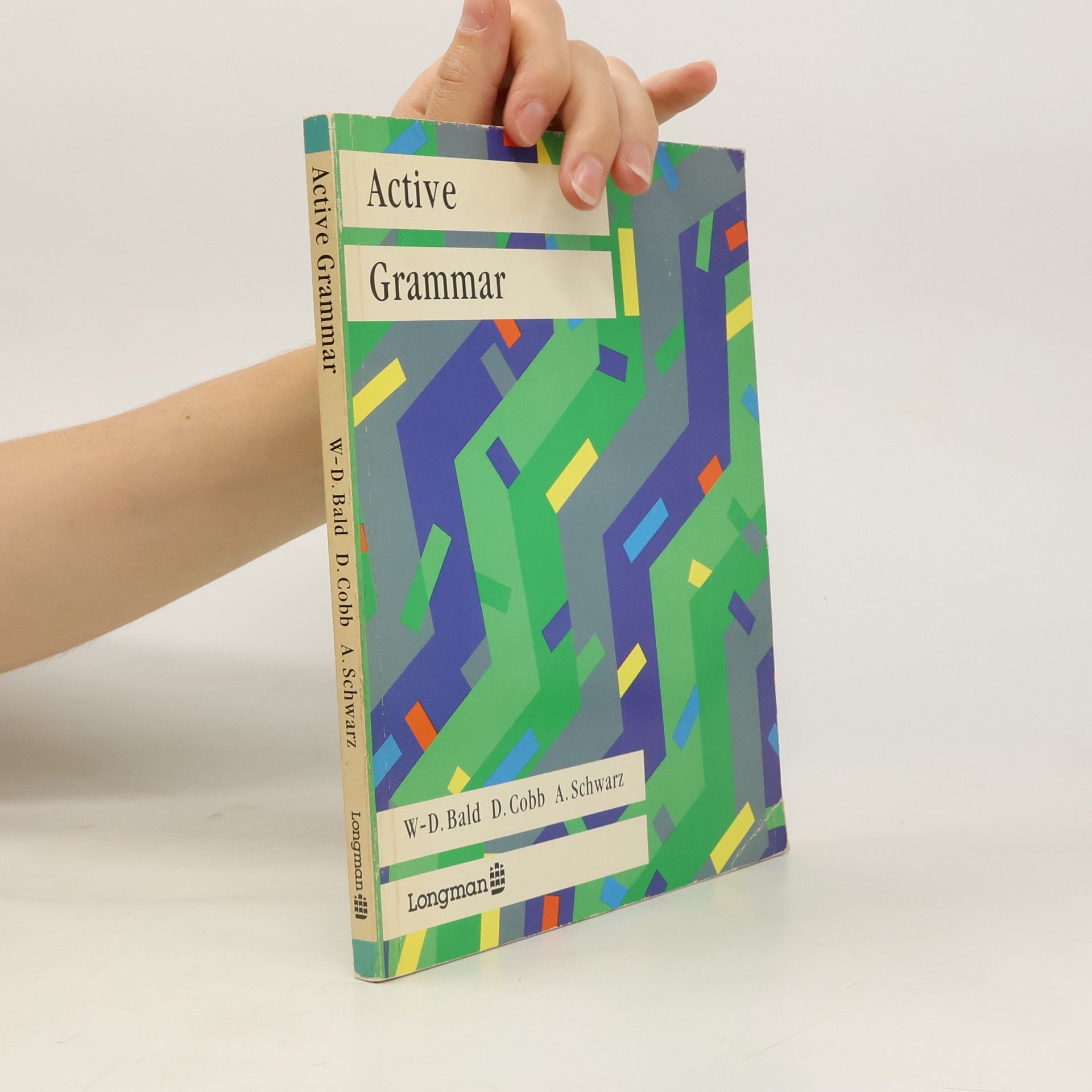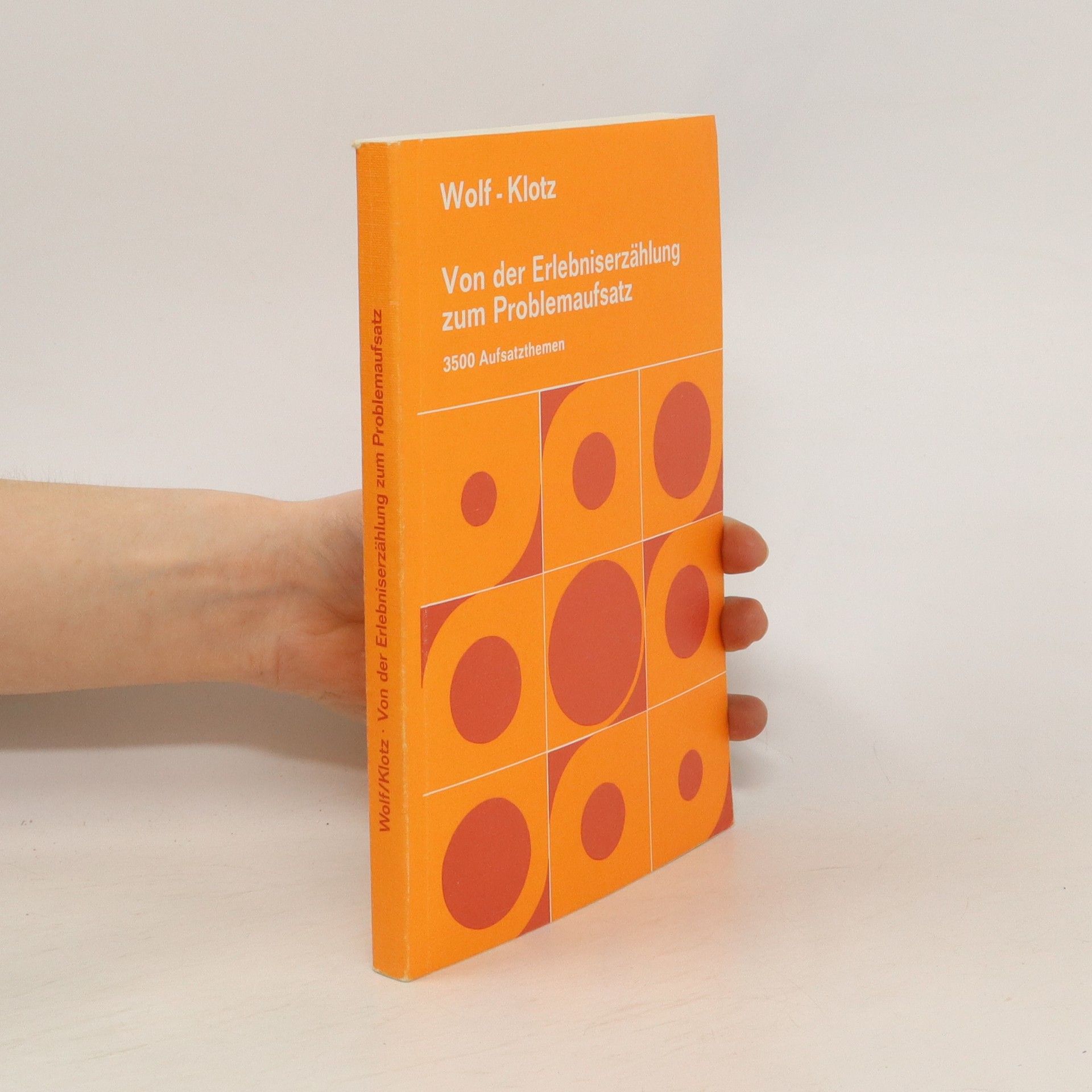(Re-) Konstruktion von lokaler Urbanität
- 328 Seiten
- 12 Lesestunden
Die städtische Lebensweise ist für viele selbstverständlich und weltweit attraktiv. Studierende, Singles, Familien und Geflüchtete streben nach urbanem Leben, das mit Erwartungen an ein besseres Leben und neue gesellschaftliche Möglichkeiten verbunden ist. Gleichzeitig zeigt sich der urbane Raum jedoch auch in Form von Segregation, überteuerten Mieten und Gentrifizierung. Es gibt einen Mangel an wohnortnahen Arbeitsplätzen sowie das Verschwinden lokaler Geschäfte und Dienstleistungen, was zu einem erheblichen Konfliktpotential führt, das durch den Klimawandel weiter verstärkt wird. Anstatt den Alltag zu hinterfragen, werden technologische Lösungen propagiert oder die Verantwortung an profitorientierte Investoren abgegeben. Oft wird der Status quo beschworen und nach Sündenböcken für Fehlentwicklungen gesucht. In dieser angespannten Situation ist es entscheidend, Klarheit über die Merkmale und das nachhaltige Potenzial einer Stadtgesellschaft zu gewinnen und die gesellschaftlichen Herausforderungen kreativ anzugehen. Die (Re-)Konstruktion von lokaler Urbanität könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein.