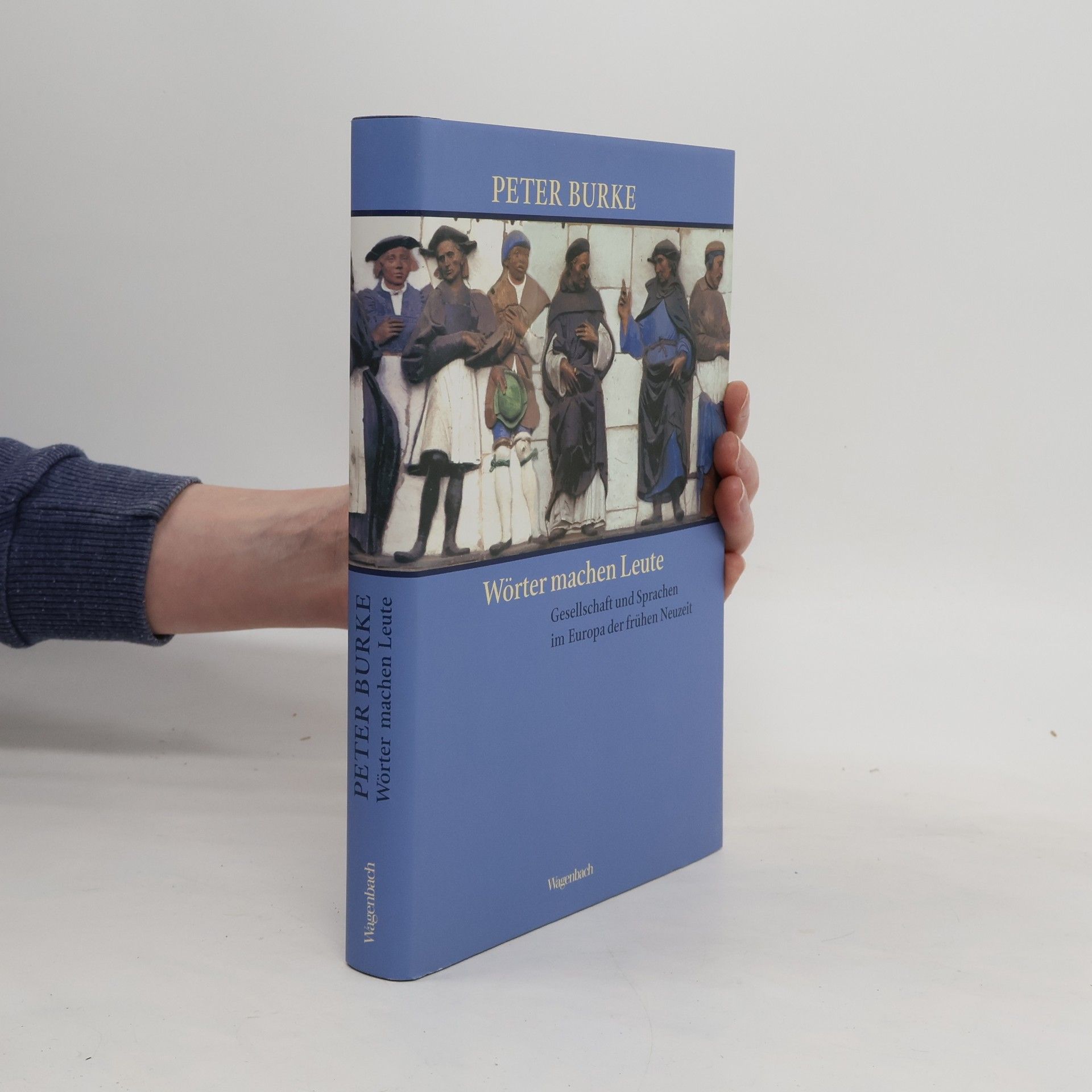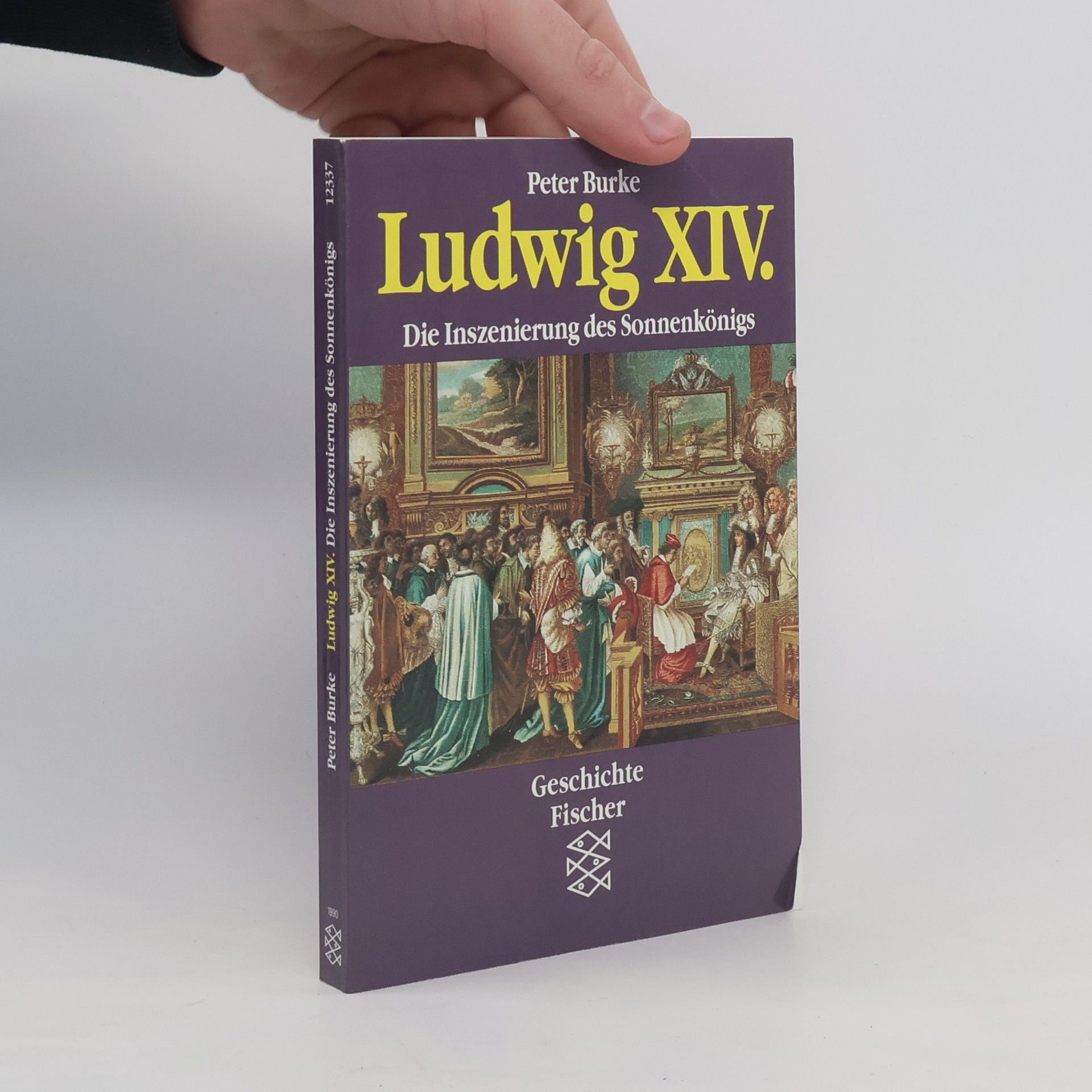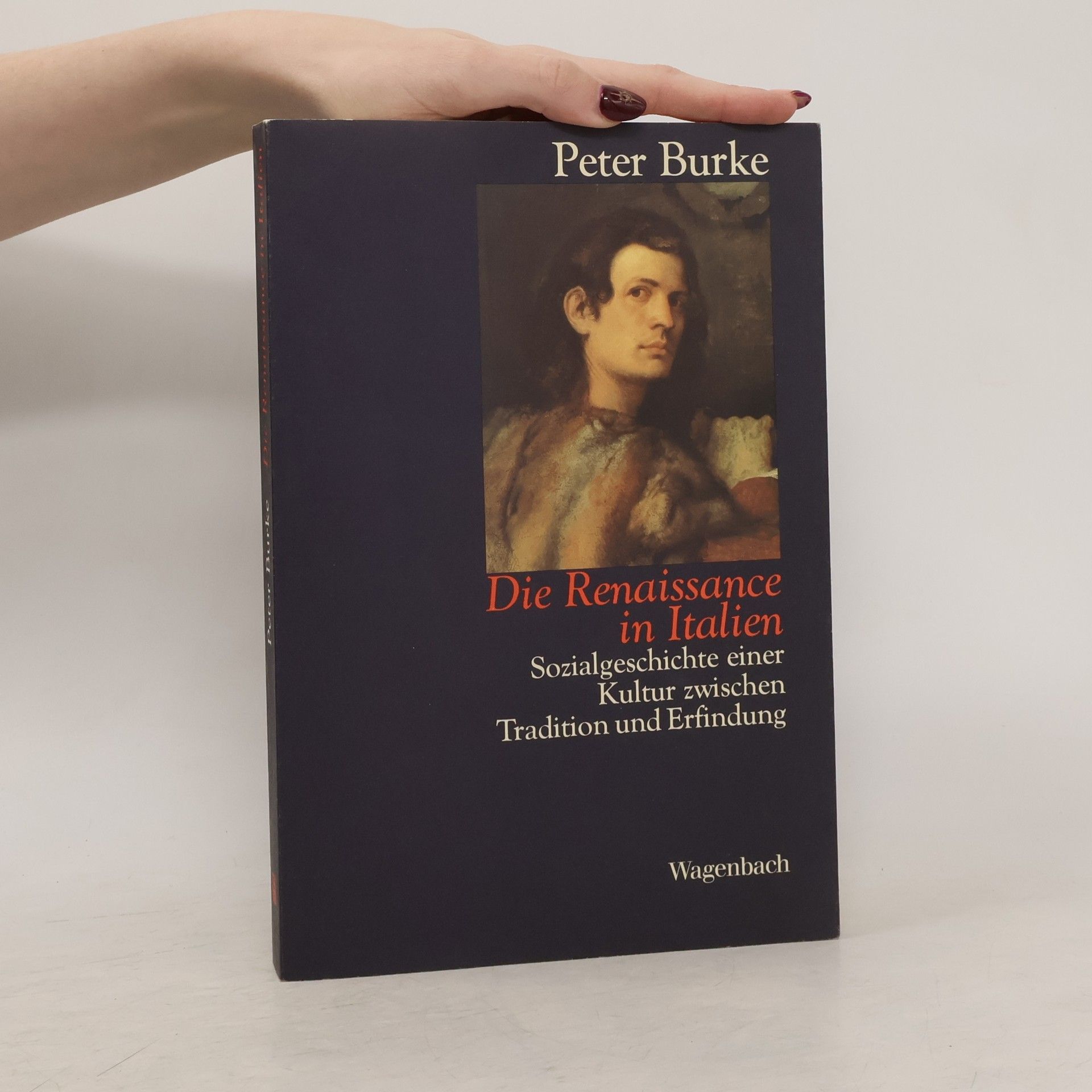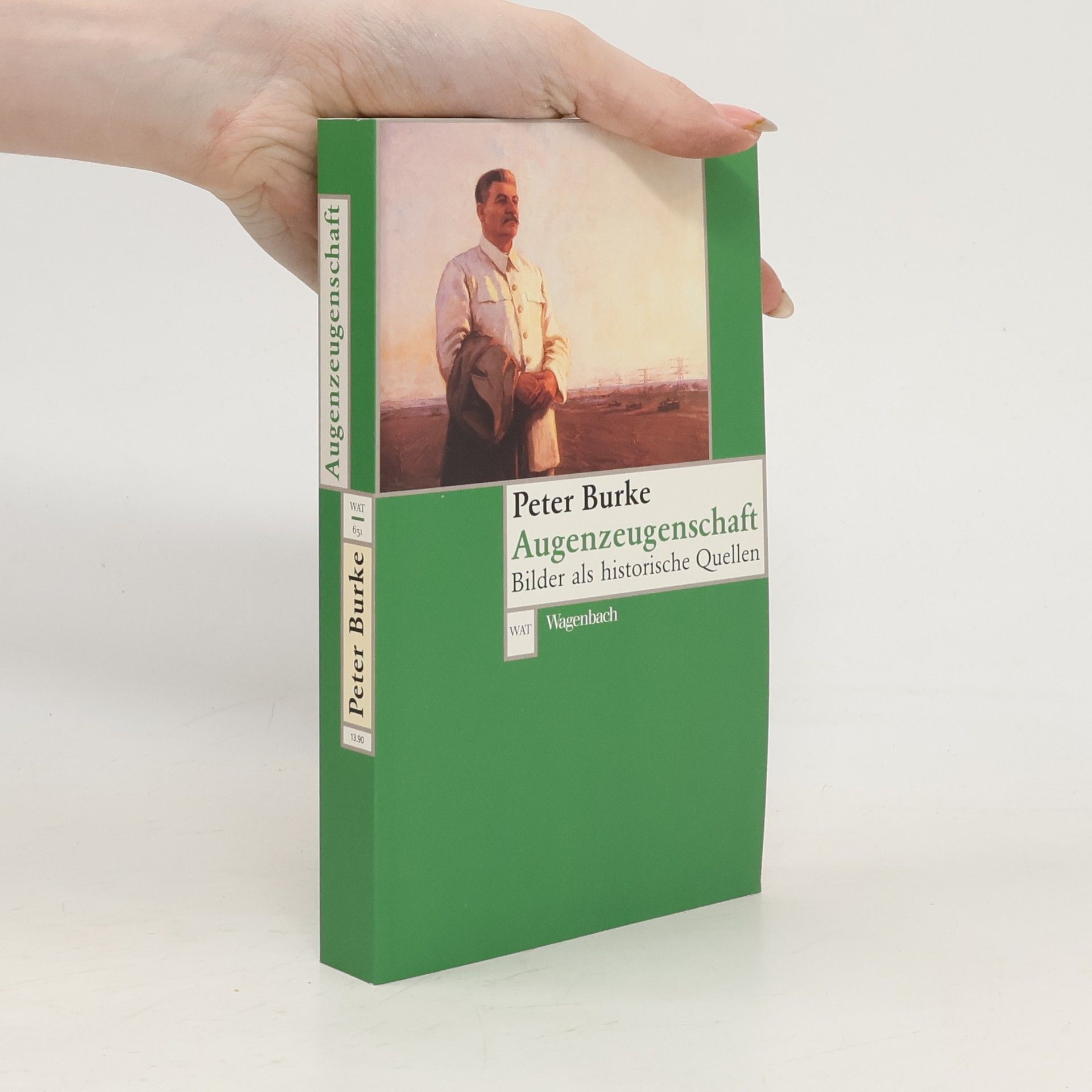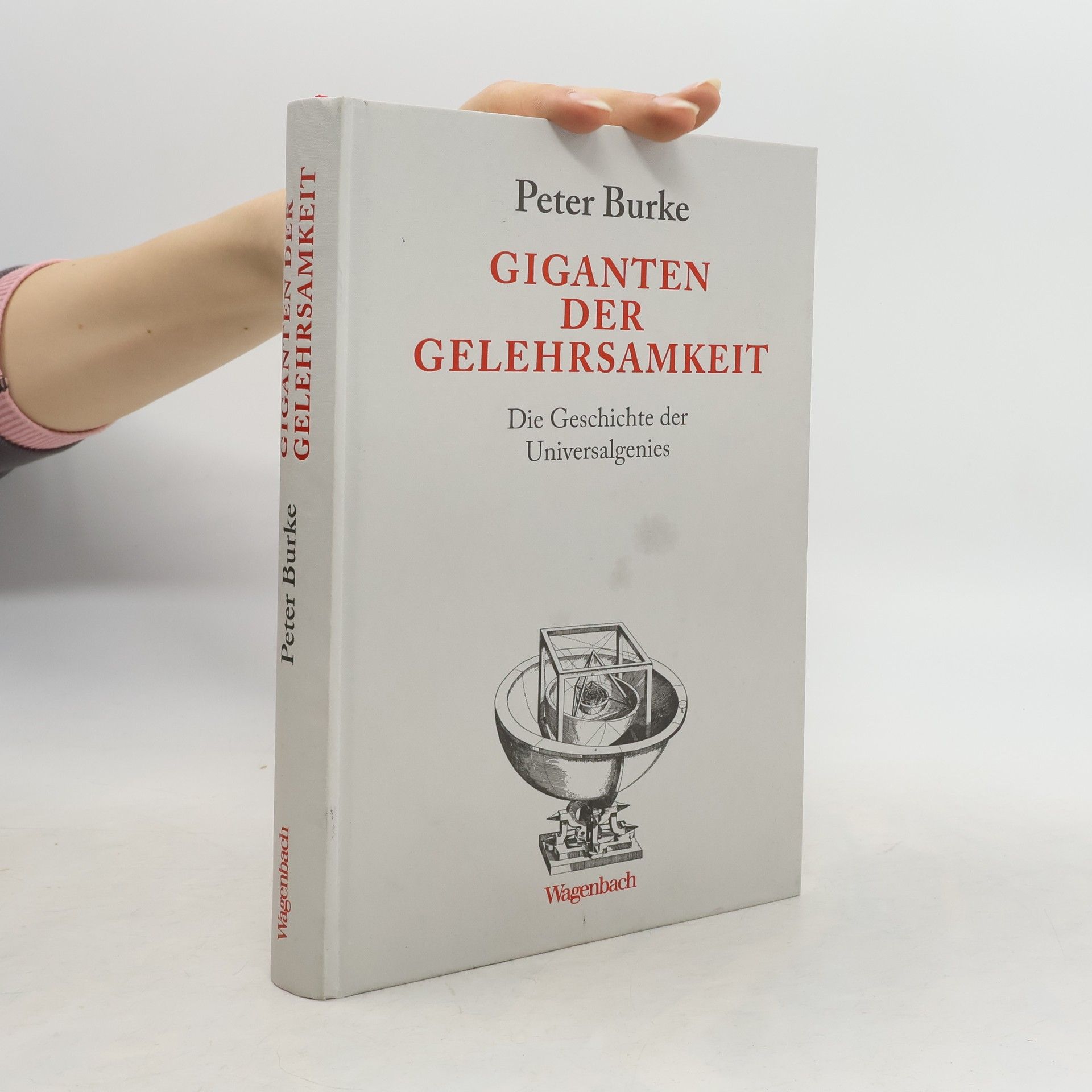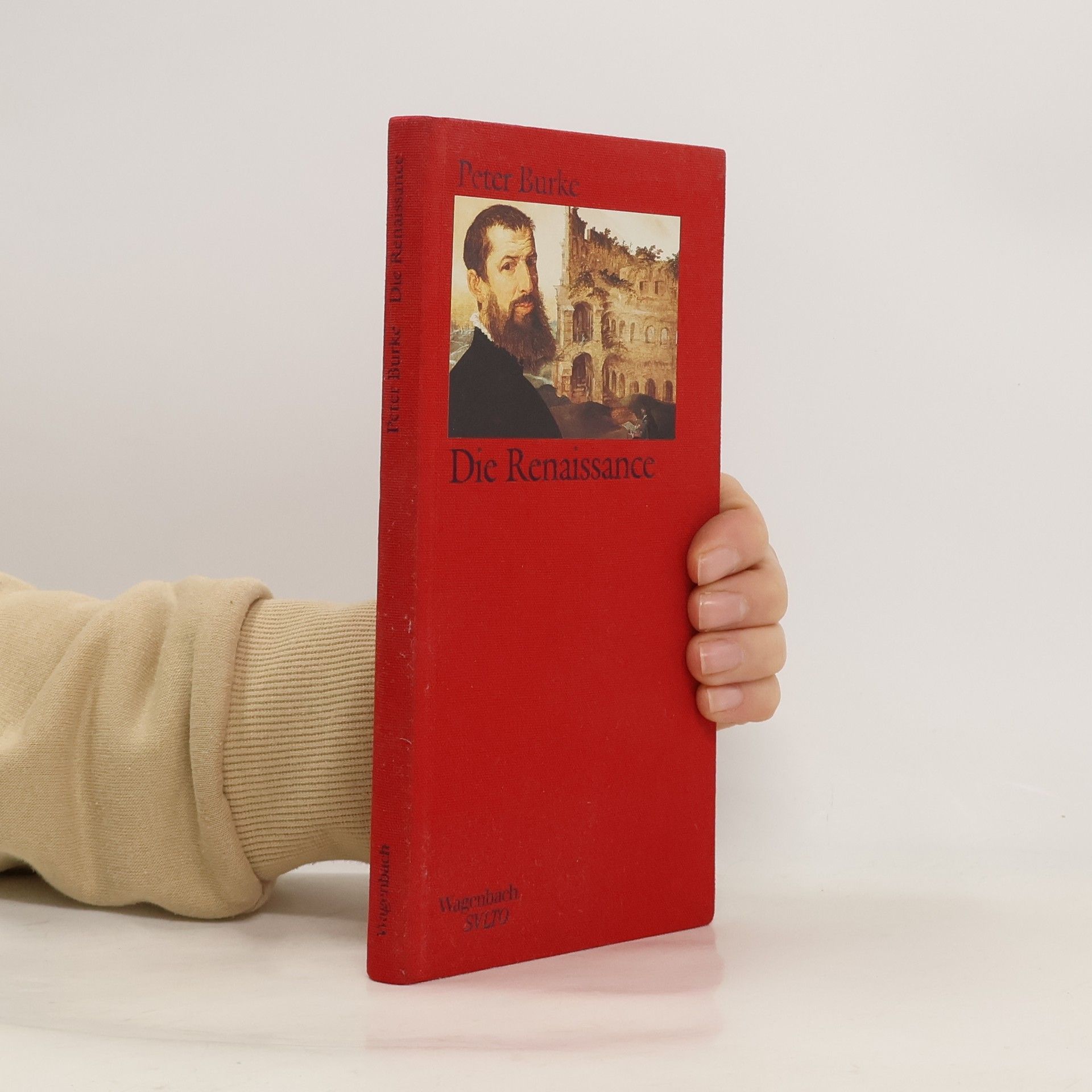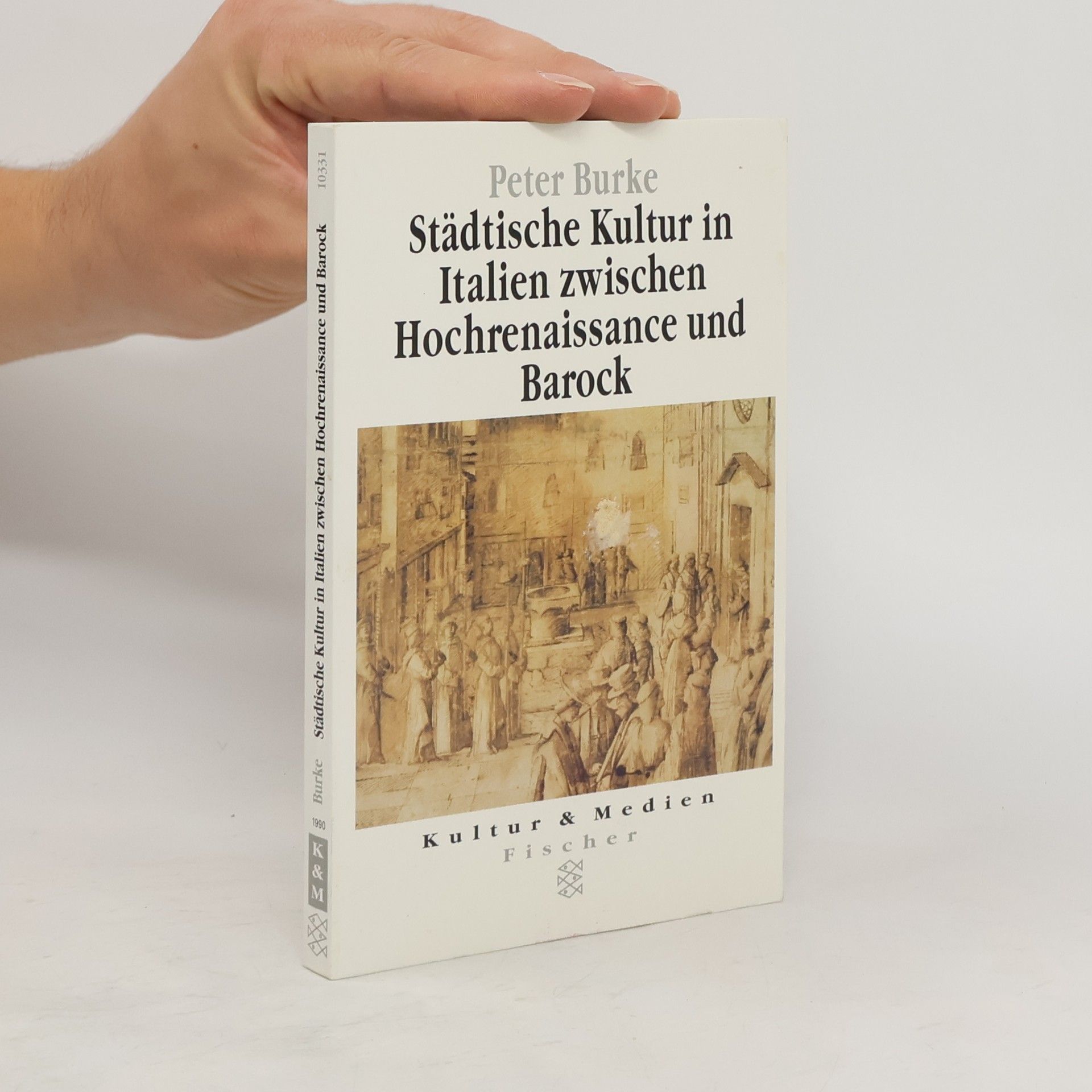Giganten der Gelehrsamkeit
Die Geschichte der Universalgenies
Universalgelehrte wurden oft vergessen, verkannt, verniedlicht oder als Schwindler verunglimpft. Peter Burke unternimmt eine Ehrenrettung dieser Ausnahmetalente und folgt ihrer Geschichte über 500 Jahre in verschiedenen Ländern bis ins 21. Jahrhundert. Er stellt in vielen Porträts die verbindenden Eigenschaften heraus: ein Übermaß an Neugier, Gedächtnisleistung, Phantasie, Energie, Konzentrationsfähigkeit und nicht selten Ehrgeiz bis hin zur ruhelosen Arbeitssucht. Für Schlaf, Pausen oder gar die Liebe bleibt keine Zeit. Aber dafür ist das Einarbeiten in ein neues Thema in Carlo Ginzburgs Worten wie Skifahren in frischem Schnee. Wandelnde Enzyklopädisten gab es schon in der Antike. Ausnahmeerscheinungen wie Pythagoras wurde nachgesagt, alle Fragen beantworten zu können. Doch erst im 17. Jahrhundert kamen Universalgelehrte in Mode – allen voran der Autodidakt Leonardo da Vinci: Der Musiker, Maschinenbauer, Maler, Bildhauer, Militärexperte, Anatom, Fossiliensammler, Erfinder, Botaniker, Zoologe, Geologe und Kartograph wurde nicht zufällig Namensgeber des »Leonardo- Syndroms«, das für die Unfähigkeit zur Auswahl und Beendigung von Projekten steht. Heute, im Zeitalter der Hyper- Spezialisierung und der grassierenden Oberflächlichkeit, brauchen wir die Universalgelehrten dringender denn je. In diesem ebenso lehrreichen wie amüsanten Buch kann man ihnen nachspüren. Ein Meisterstück Burke’scher Geschichtsschreibung.