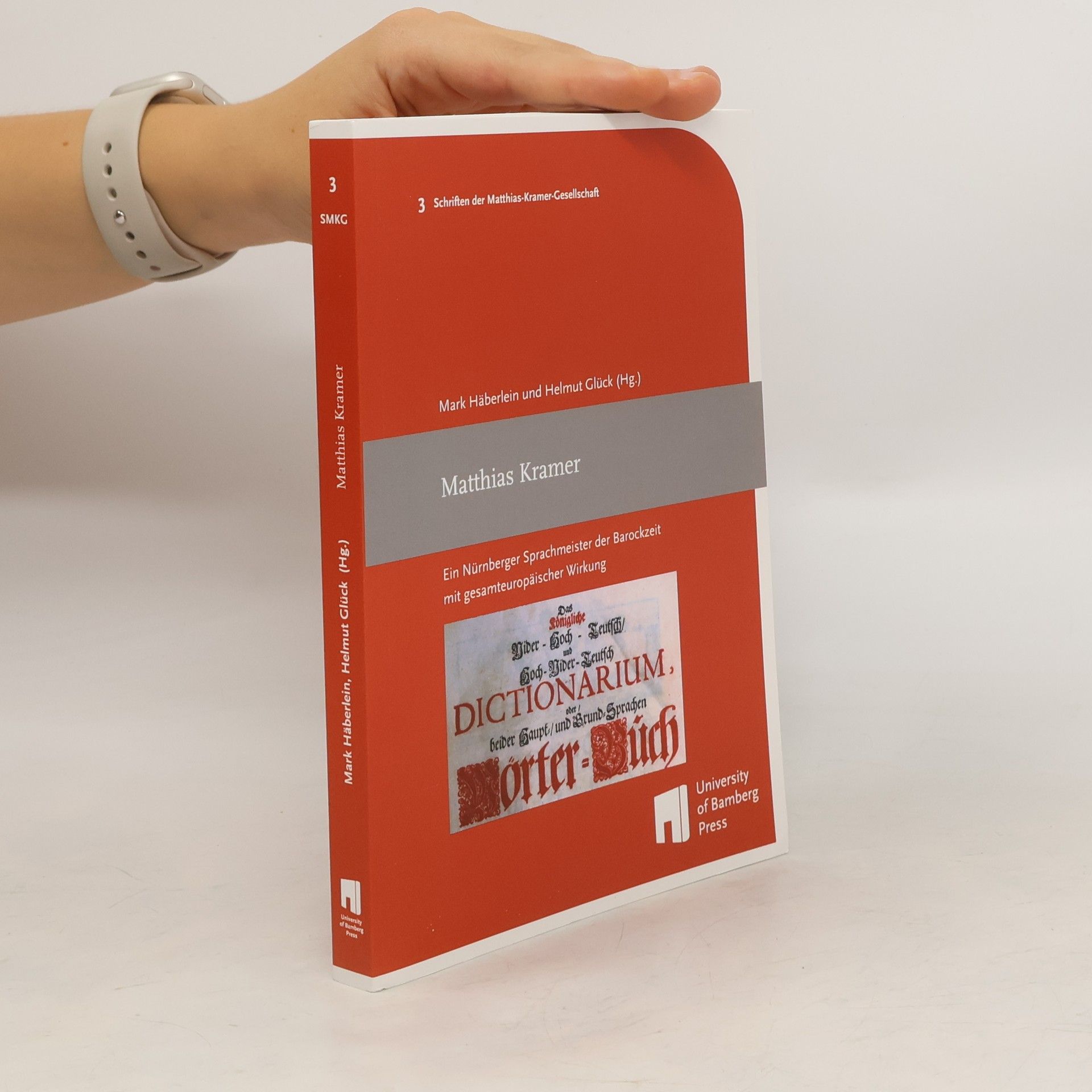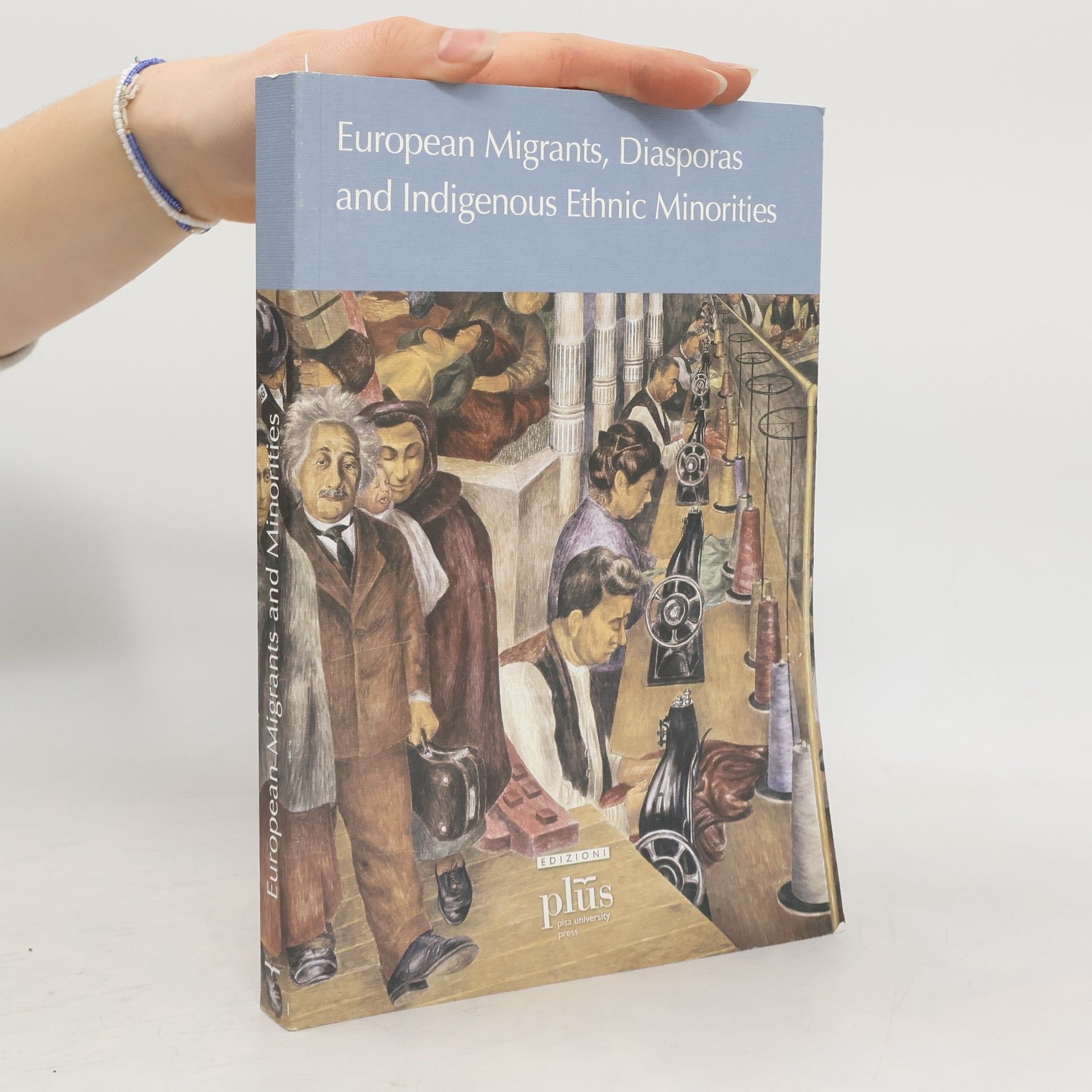Die Marokkaner in Wien
Interkulturelle Diplomatie und städtische Öffentlichkeit im Zeitalter Josephs II.
Im Jahre 1783 reiste eine Gesandtschaft des Sultans von Marokko nach Wien, um mit Kaiser Joseph II. einen Friedens-, Freundschafts- und Handelsvertrag zu schliessen. Diese diplomatische Initiative war in ein aufwendiges hofisches Zeremoniell eingebettet; sie fand zudem grosse Resonanz in der Wiener Offentlichkeit und wurde in unterschiedlichen Medien visuell, textuell und materiell verarbeitet. Mark Haberlein stellt Vorgeschichte, Verlauf, Ergebnisse und Nachwirkungen dieses interkulturellen Ereignisses erstmals auf breiter Quellengrundlage dar und verortet es in seinen politischen, sozialen und kulturellen Kontexten. Durch die prazise Rekonstruktion der marokkanischen Gesandtschaft leistet sein Buch zugleich einen Beitrag zur globalen Mikrogeschichte.