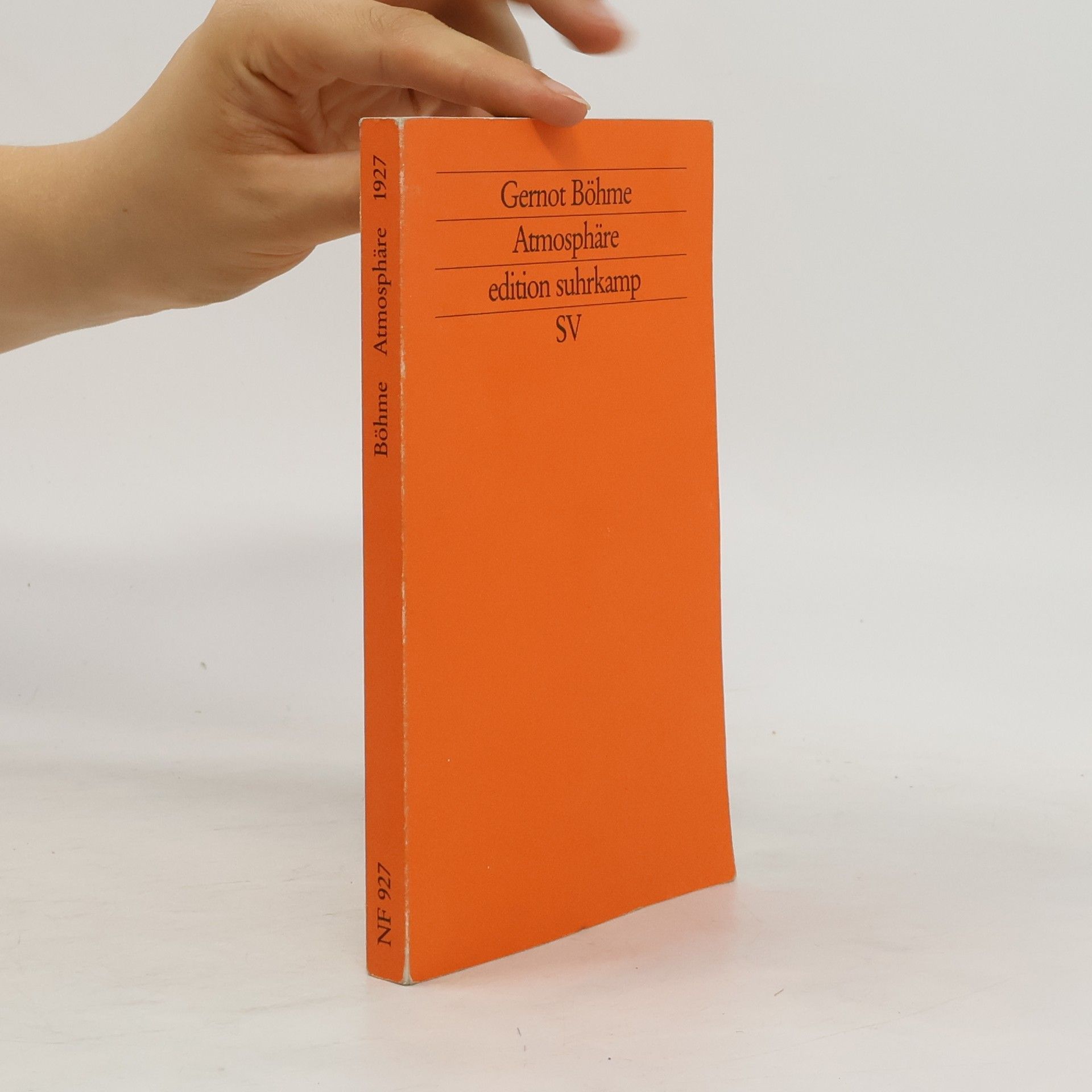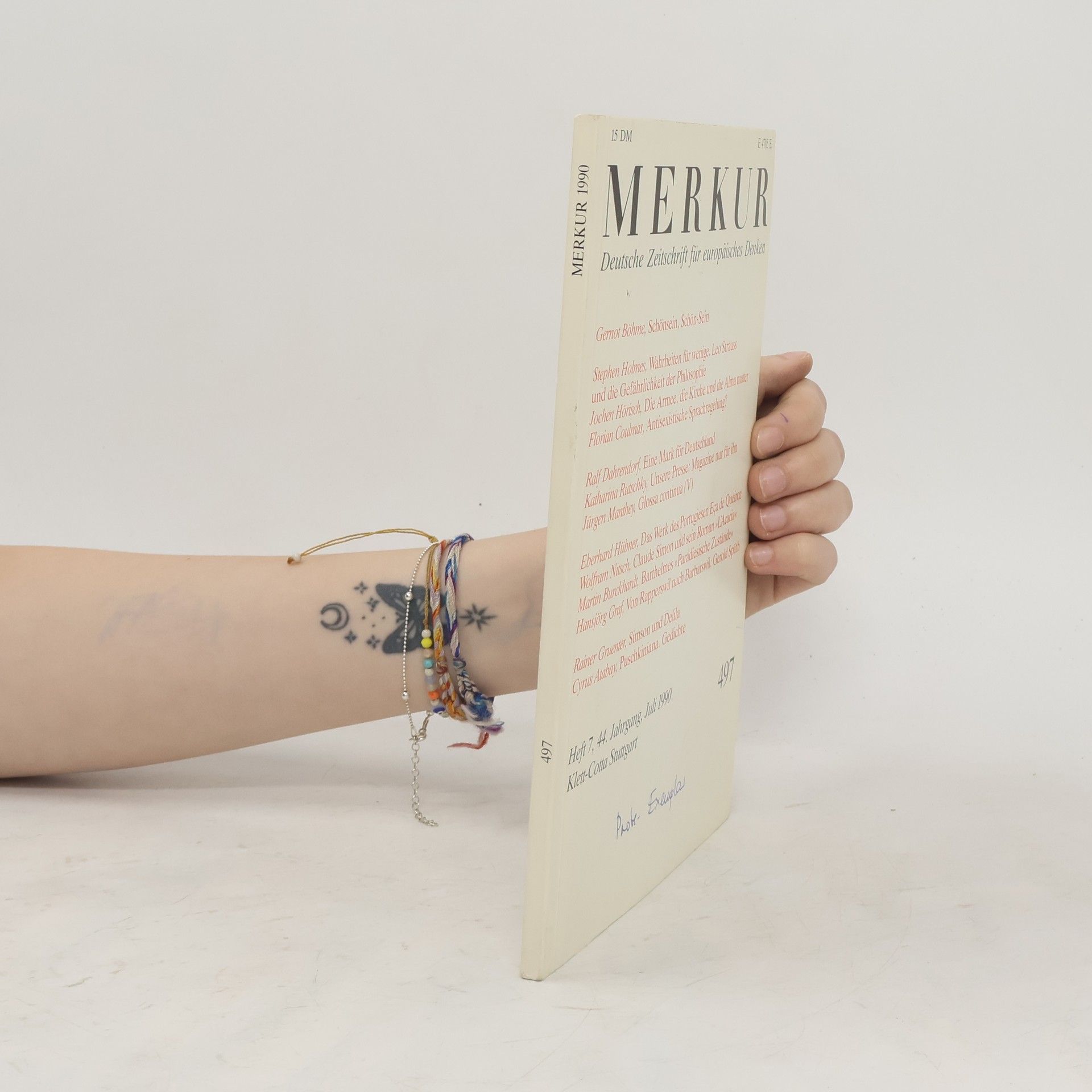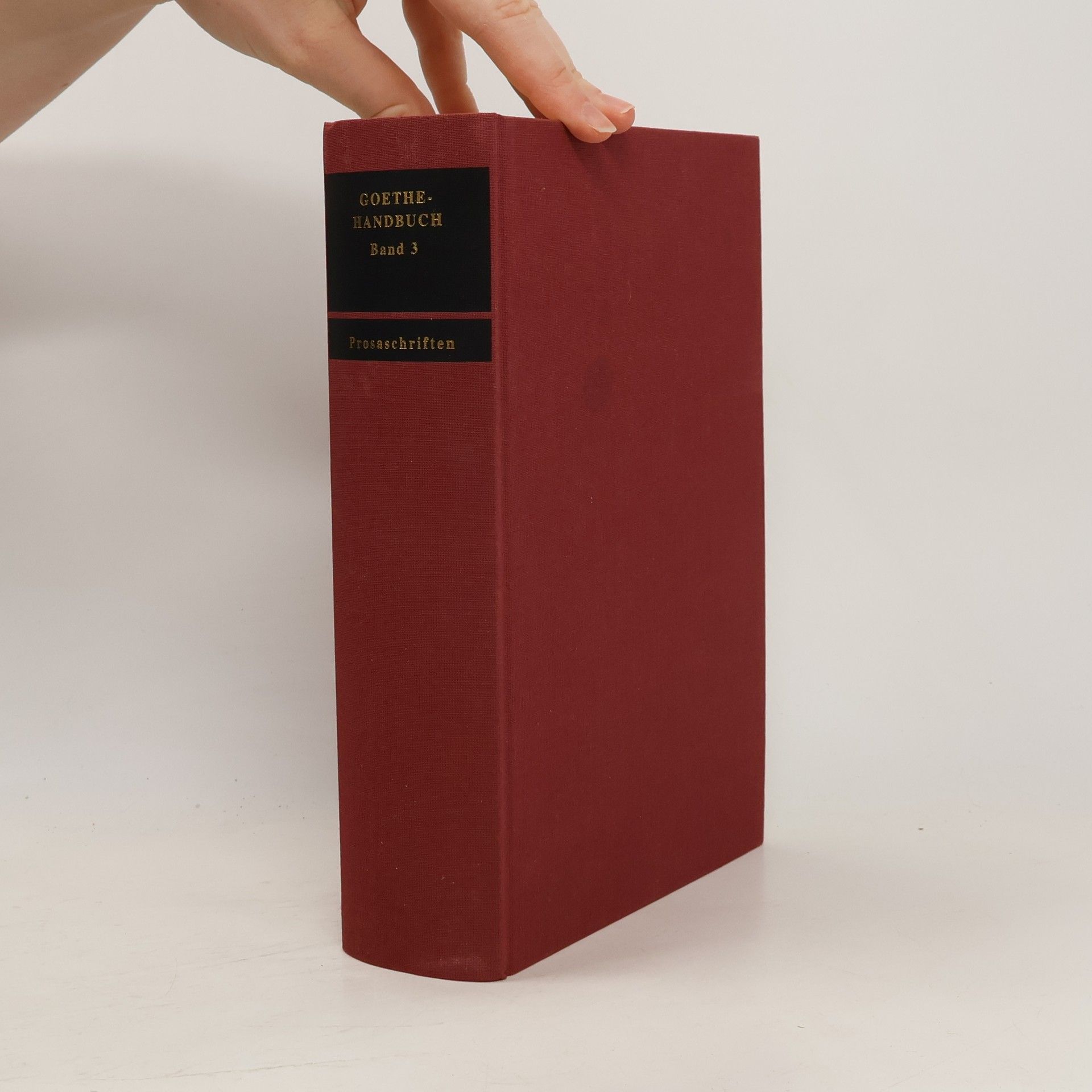Weltweisheit, Lebensform, Wissenschaft
- 387 Seiten
- 14 Lesestunden
Diesem Buch geht es nicht um die Mitteilung elementarer philosophischer Wissensbestände, sondern um eine Einleitung und Ermunterung zum Philosophieren. So gliedert es sich nicht nach philosophischen Disziplinen wie Metaphysik, Ethik, Ästhetik, Politische Philosophie usw., sondern nach Weisen des Philosophierens.