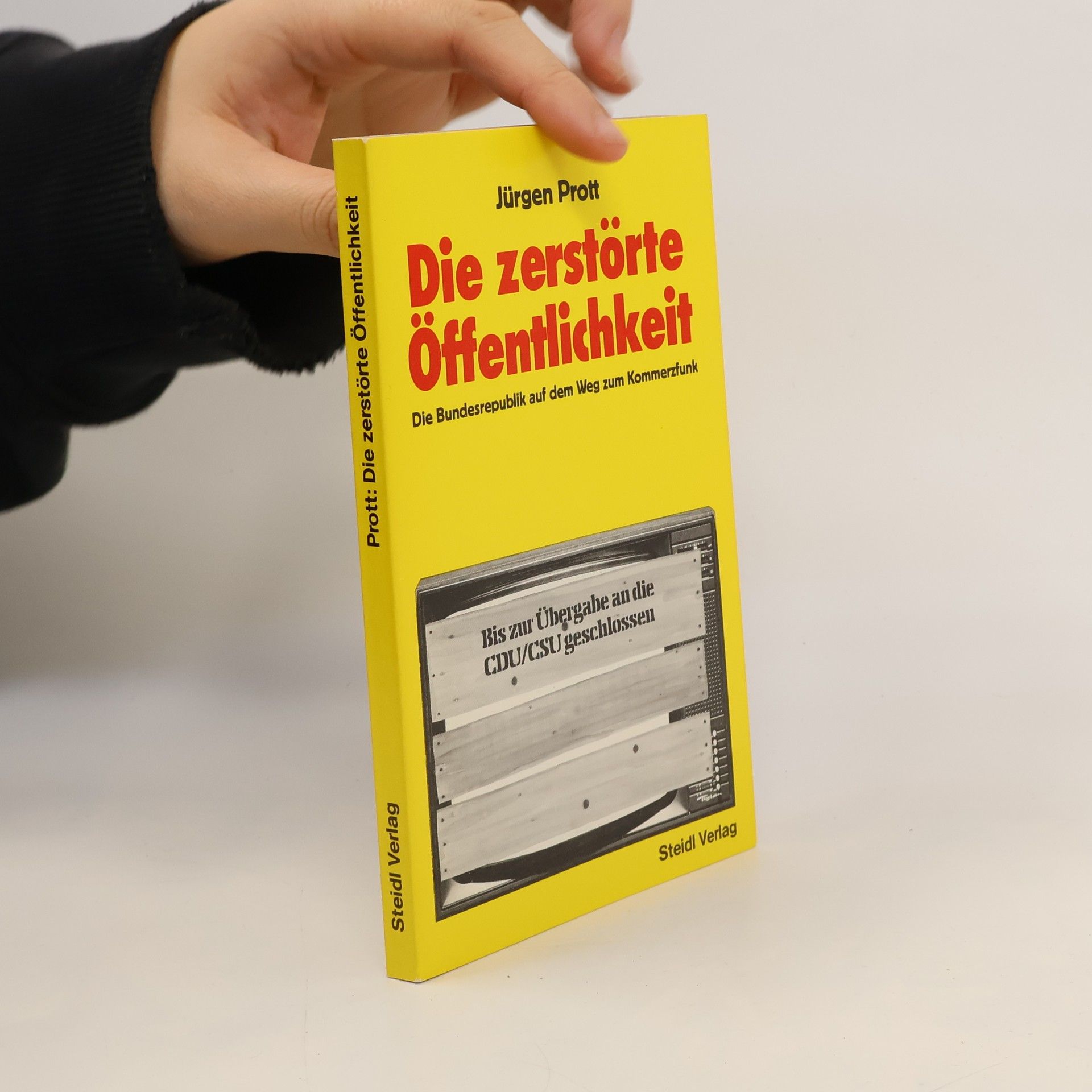Solidarisch lernen
Zum Wechselverhältnis der Hochschule für Wirtschaft und Politik mit den Gewerkschaften
- 285 Seiten
- 10 Lesestunden
Der soziale Aufstieg über den zweiten Bildungsweg stellt für gewerkschaftlich engagierte Arbeitnehmer eine Herausforderung dar, da sie ihre politischen Überzeugungen in Frage stellen müssen. Die Suche nach besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen führt oft zu einem Wettkampf um akademische Erfolge, der als belastend empfunden wird. Der Autor analysiert in seiner empirischen Studie, wie verschiedene Generationen von Stipendiatinnen und Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik mit diesem Dilemma umgehen.