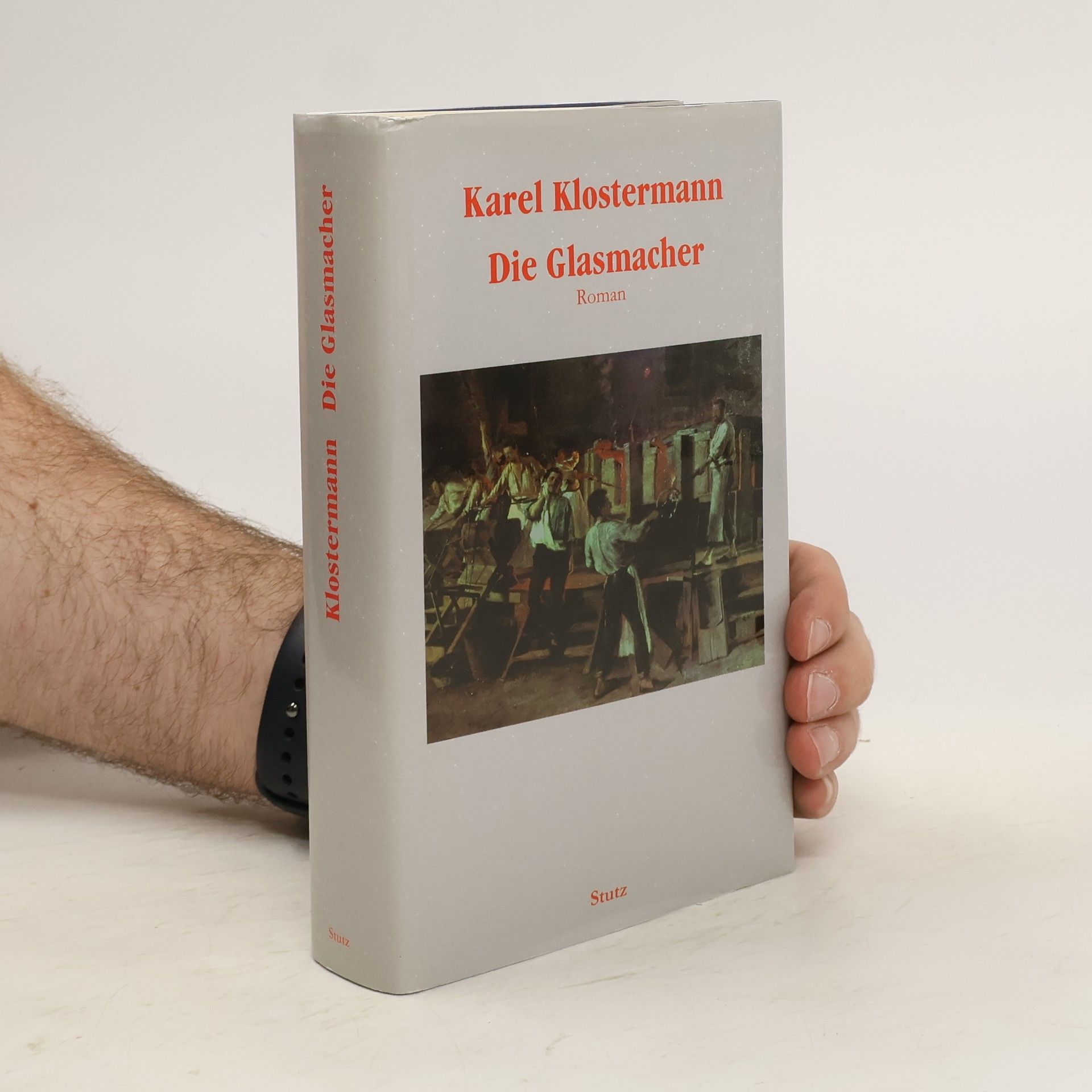Die Böhmerwaldskizzen von Karel Klostermann bieten einen eindrucksvollen Einblick in die Natur und das Leben im Böhmerwald. Durch lebendige Beschreibungen und detailreiche Beobachtungen fängt der Autor die Schönheit der Landschaft und die Eigenheiten der Menschen ein. Klostermann verbindet persönliche Erlebnisse mit historischen und kulturellen Aspekten der Region, wodurch ein vielschichtiges Bild entsteht. Die Erzählungen sind geprägt von einer tiefen Verbundenheit zur Heimat und reflektieren die Herausforderungen und Freuden des Landlebens.
Karel Klostermann Bücher
Karel Klostermann ist als tschechischer Schriftsteller bekannt, dessen Werk sich intensiv auf die raue Schönheit und das Leben in der Region des Böhmerwaldes konzentriert. Als Schlüsselfigur des Realismus und der Landprosa hielt er meisterhaft die Realitäten des Landlebens fest. Seine umfangreichen gesammelten Schriften, die sich über vierzig Bände erstrecken, umfassen Romane, Kurzgeschichten und Skizzen und bieten den Lesern einen tiefen Einblick in die Gesellschaft und Landschaft seiner Zeit.







Z pozůstalosti Karla Klostermanna v Archivu města Plzně připravili Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský. Překlad do němčiny Gerda Eckelt.
Ferien im Böhmerwald
Erinnerungen von Karl Klostermann aus der Zeitschrift „Politik“
"Ferien im Böhmerwald" ist eine Sammlung von Feuilletons, die der Böhmerwalddichter Karl Klostermann (1848 - 1923) gegen Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Obertitel "Faustins Erzählungen" in der deutschsprachigen Zeitschrift "Politik" veröffentlicht hat."Ferien im Böhmerwald" enthält eine Reihe von Erinnerungen, "Ferialreminiszenzen" Karl Klostermanns, der schon zu seiner Schulzeit sämtliche schulfreien Tage in seinem geliebten Böhmerwald zugebracht hat.Der Autor schildert eine Fahrt mit der Transversalbahn von Schüttenhofen nach Winterberg, Ausflüge nach Pürstling und zum Lusen, von Innergefild über Haidl nach Bergreichenstein, zu den künischen Freibauern nach Stachau/Stachy und nimmt den Leser mit zu den einfachen Leuten, mit denen er sich oft unterhält und bei denen er häufig einkehrt.Die Erinnerungen Klostermanns gewähren uns einen Blick in eine vergangene Zeit aus der Sicht eines einfachen Böhmerwaldkindes, dem das Schicksal eine neue Welt eröffnet hat.
„Paradies“ nennt Karel Klostermann (1848-1923) den zentralen Böhmerwald der Siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Aber er meint das sehr bitter, ja sarkastisch. Durch den großen Orkan von 1870 und die darauf folgende Borkenkäferplage war zunächst eine nie da gewesene Fülle von Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten in der Holzwirtschaft entstanden. Doch viele Leute konnten mit dem plötzlichen Geldsegen nicht richtig umgehen. Der Mammon verdarb Sitten und Moral. Dieses Paradies ist nach Klostermann der Hölle sehr viel näher als dem Himmel. Wie die nachfolgende Generation, die Kinder, mit dieser Hinterlassenschaft zurechtkamen, schildert er am Beispiel der eigenen Verwandtschaft in seinem Buch „Kam speji deti“, wörtlich übersetzt: „Was aus den Kindern wird“. Zum ersten Mal überhaupt liegt dieser Roman nun in deutscher Sprache vor. Gerold Dvorak, der sich lange Jahre mit dem „Böhmerwalddichter“ beschäftigt hatte, hat ihn aus dem Tschechischen übersetzt.
Der Herr Professor
- 234 Seiten
- 9 Lesestunden
„Weiß Gott, wie das gekommen ist, aber der Herr Professor schaute nur mehr ein ganz klein bißchen finster drein, und noch ehe er es selbst gedacht hätte, war er mit dem Fräulein Sophie des Finanzamtsvorstands auf der Tanzfläche.“ Klostermann schildert in dieser Erzählung einige Jahre aus dem Leben des „Professors“ Jan Chlumák in einer böhmischen Stadt, die unschwer als Bergreichenstein/Kašperské Hory zu erkennen ist. Was sich zu Beginn wie eine Kleinstadtsatire liest, wird mehr und mehr zu einem Bericht von der Enge und Einsamkeit des Lebens unter Menschen, die alles über einen zu wissen meinen.
Karl Faustin Klostermann, ein bedeutender tschechischer Schriftsteller, wurde am 13. Februar 1848 in Haag am Hausruck geboren und starb am 16. Juli 1923 in Štěkna. Neben zahlreichen Romanen und Erzählungen in tschechischer Sprache veröffentlichte er zwischen 1884 und 1907 auch Novellen in deutscher Sprache in der Prager Tageszeitung „Politik“. Diese Werke thematisieren den Böhmerwald, die Heimat seiner deutschen Vorfahren, und schildern nüchtern die Lebensrealität der dort lebenden Menschen. Klostermann beschreibt die Herausforderungen der einfachen Leute, Kleinbauern und Holzarbeiter, sowie die bürgerliche Welt der wohlhabenden Glas- und Resonanzholzfabrikanten, Lehrer und Bürokraten. Er fungiert als Vermittler zwischen den zunehmend auseinanderdriftenden Volksgemeinschaften Böhmens. In seinen eigenen Worten drückt er die Hoffnung aus, dass gemeinsame materielle Ziele und Bedürfnisse die Menschen wieder zusammenführen können. Klostermann erinnert das heutige Publikum an eine Welt, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg Heimat für die Bewohner des Böhmerwaldes war, und betont, dass diese Erinnerungen nicht in Vergessenheit geraten sollten.
Der nun in deutscher Übersetzung vorliegende Roman „Dem Glück hinterher“ zählt mit den bekannten Böhmerwaldromanen (wie „Aus der Welt der Waldeinsamkeiten“, „Im Böhmerwaldparadies“) zu den literarischen wertvollsten Werken Karl Klostermanns. Im Mittelpunkt stehen junge Tschechen, die im Wien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Arbeitssuchende oder Studenten ihr Glück versuchen. Doch mit dem Glück ist es so eine Sache! Den einen gelingt es, in der Großstadt Fuß zu fassen, aufzusteigen, die anderen erfasst der Strudel der Donaumetropole, stürzt sie in den Abgrund. Bisweilen ist es Menschen gegönnt, eine Facette des Glücks zu erhaschen; sie finden es in der Liebe, in einem ruhigen Familienleben, in der Berühmtheit, in Kunst, Wissenschaft, in guten Taten Realistisch bis drastisch schildert der Autor die Schicksale der Romanfiguren und zieht den Leser in deren Bann. Mit zeitgeschichtlichem Kolorit und milieukritischer Analyse verleiht er dem Stoff aus der Endperiode des Habsburgerreiches belebend frische Farbigkeit. Wie in allen seinen Werken, sind es auch hier im Grunde die Liebe zum Menschen, das Verständnis für ihn, der Glaube an die Kraft des menschlihcen Strebens, die Toleranz gegenüber Nationalitäten des Vielvölkerstaates, die den bleibenden Wert von Karl Klostermanns Prosa ausmachen.
In Pürstling, einer entlegenen, unfruchtbaren und kalten Einöde in Böhmen, nördlich des Lusen, spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieser klassische Roman. Kurze Sommer und lange, kalte Winter, in denen die Bewohner eingeschlossen und monatelang auf sich allein gestellt sind, prägen die Menschen. Öde und Langeweile sind der Fluch und das Schicksal derer, die es in diese Einsamkeit verschlagen hat. Die Anstrengungen, sich gegen Unglücke, Naturkatastrophen und die Mitmenschen zu behaupten, um in einer untwirtlichen Gegend überleben zu können, bestimmen das Leben. In diesem beständigen, fast alles überlagernden Kampf gelingt es nur wenigen, ihrem Leben einen Inhalt, Sinn und Zukunft zu geben und glücklich zu sein. Vor diesem Hintergrund schildert Karl Klostermann sensibel aber in packenden, realistischen Bildern die kurze, heftige Liebe zweier junger Menschen. Der nach Pürstling versetzte, unerfahrene Forstadjunkt und Kathi, die Tochter des Hegers, finden und verlieren sich. „Freund, ich begreife, das Ihnen diese Sache nahe geht. Sie sind, nach meinem Gefühl, aus einem anderen Holz geschnitzt als wir hier. Doch überlegen Sie. Es ist gut, daß es so gekommen ist. Das Mädchen hat nicht zu Ihnen gepaßt, was hätten Sie dort mit ihm angefangen? Sie wären beide unglücklich geworden. Der Sinnrausch wäre bald verflogen, dann wären Leid und Reue gekommen. Und das Mädchen genau so!“