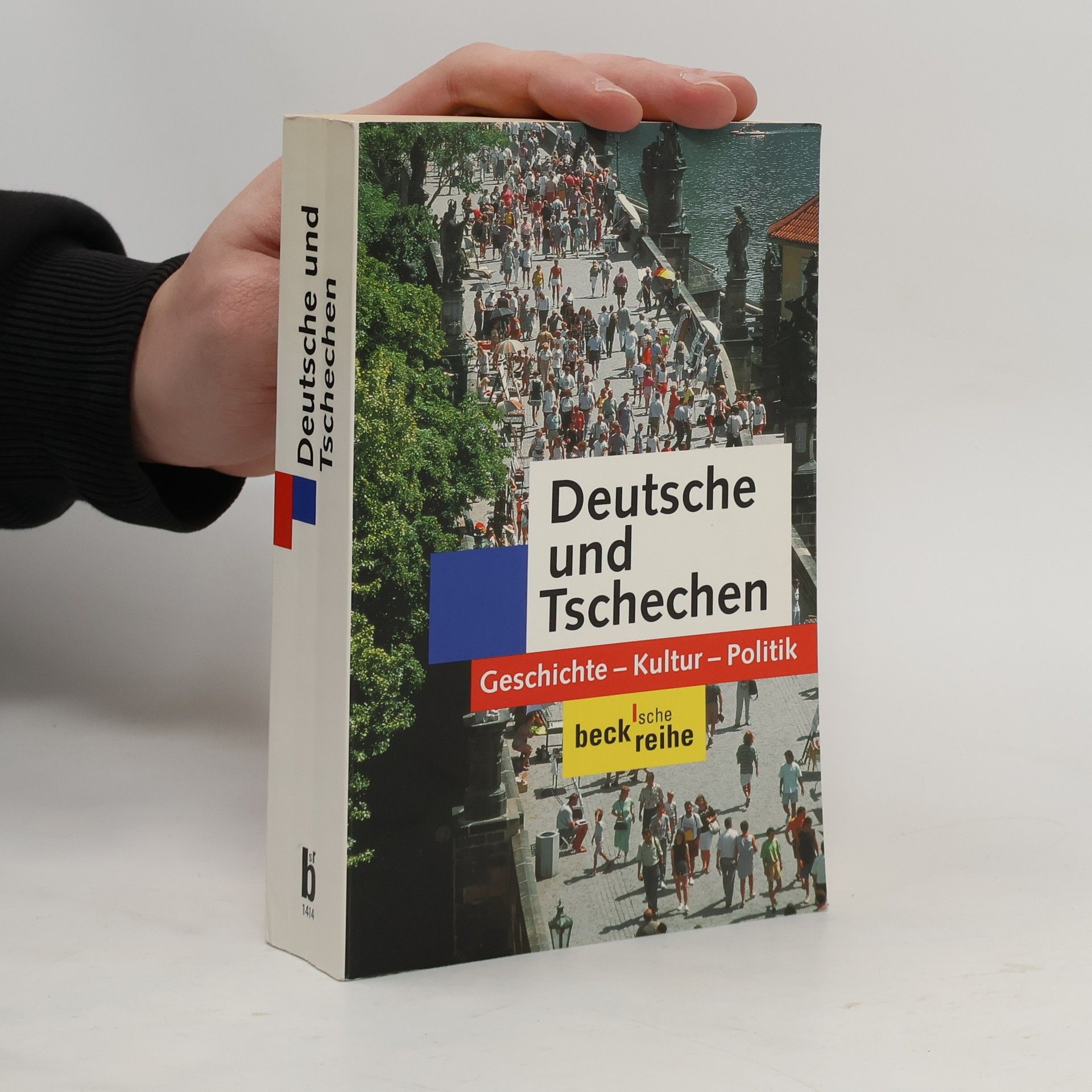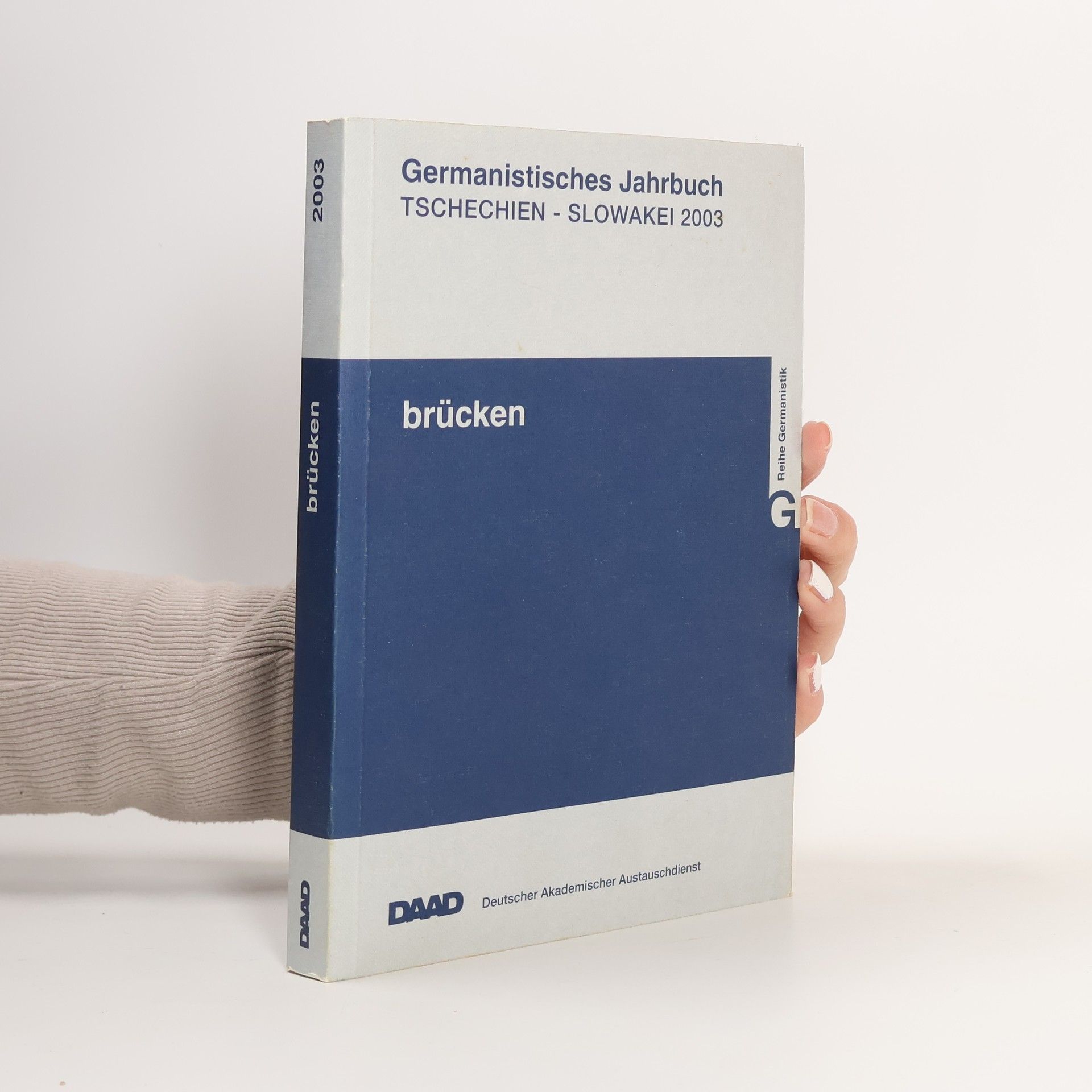Marek Nekula Bücher


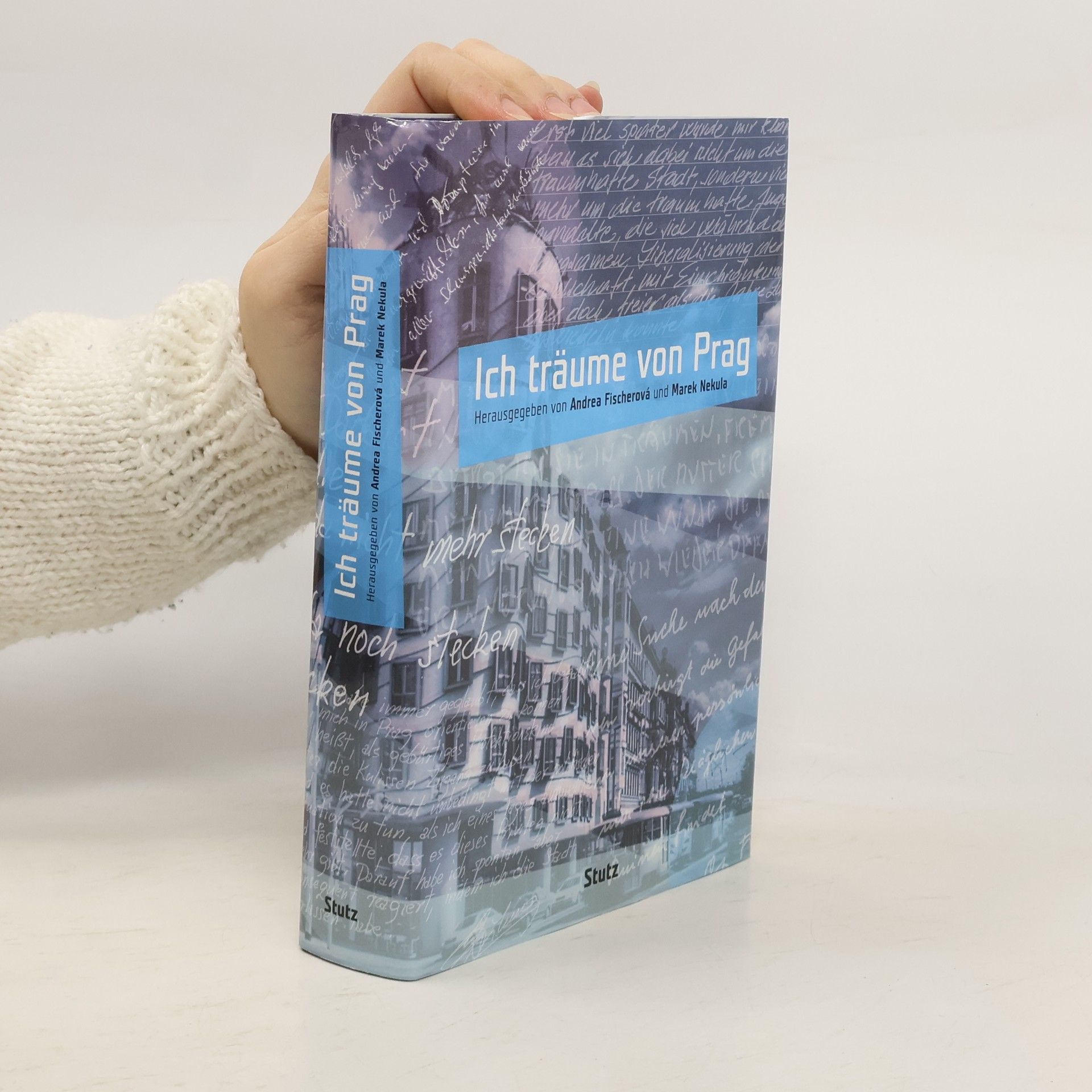

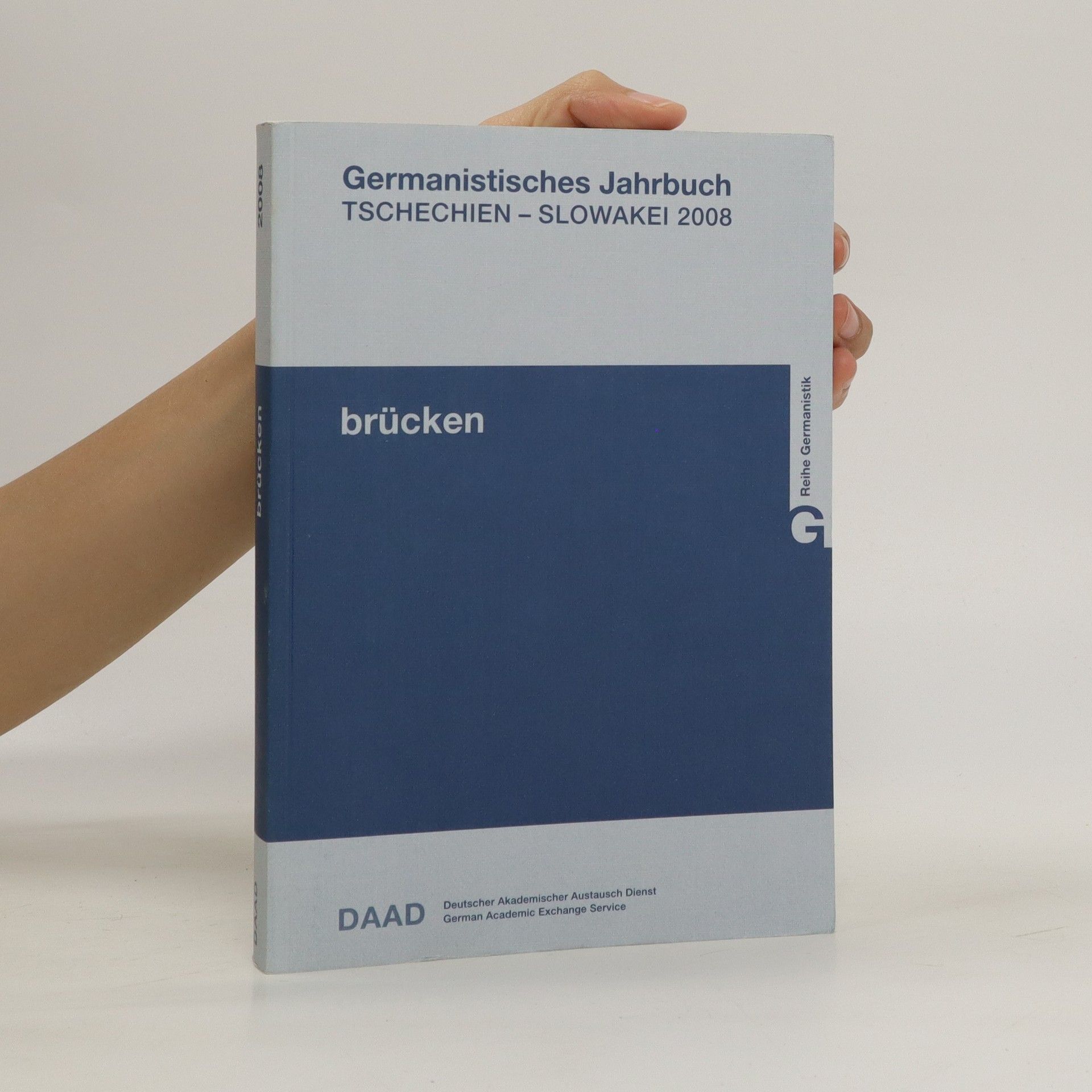

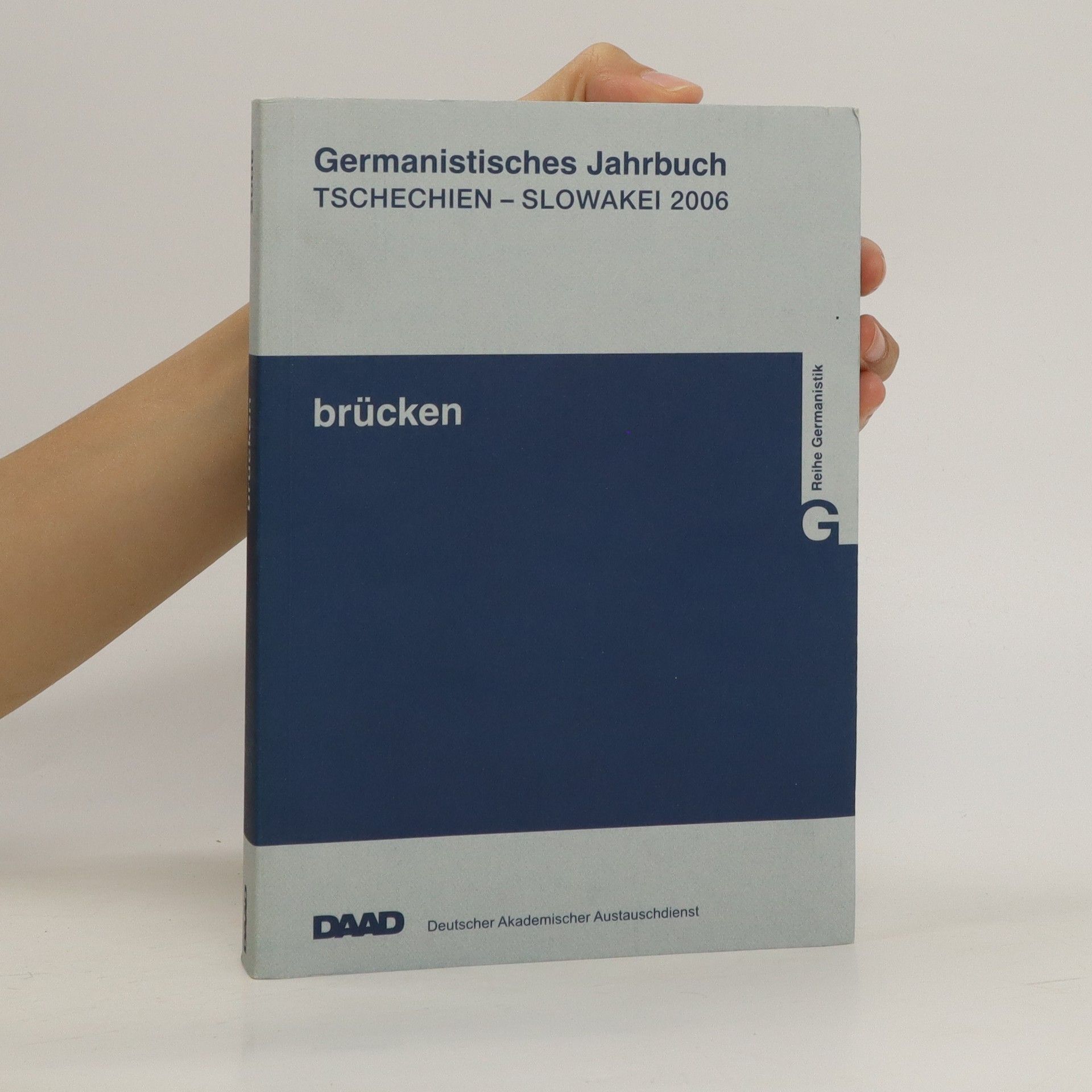
Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n
Prag – Brünn – Wien
Zeitschriften sind ein für die Moderne charakteristisches Medium. Der Band geht der Rolle nach, die sie bei der Selbstverständigung der Moderne spielen, d. h. bei deren kritischer Selbstrepräsentation und der Herausbildung des modernen Publikums. Der Fokus liegt auf Zeitschriften, die um die Jahrhundertwende sowie in der frühen Avantgarde in zentraleuropäischen urbanen Zentren wie Prag/Praha, Brünn/Brno und Wien erschienen sind. Sowohl im Sinne der Konzeptualisierung und Verhandlung der Moderne als auch der Vernetzung und ästhetischen Durchdringung mittels Übersetzungen und Rezensionen, die auf anderssprachige literarische Felder auch jenseits Zentraleuropas abzielen, fungieren sie als Knotenpunkte der Moderne/n. Für Zentraleuropa charakteristisch ist die (zeitweise) Mehrsprachigkeit einiger Zeitschriften wie ‚Moderní revue‘ oder ‚ReD‘, in denen Texte jeweils in Originalsprache abgedruckt werden. Mit Rückgriff auf die Mehrsprachigkeit dieses sprachlich heterogenen und sprachlich vor allem nach Westen offenen Raumes wird eine weltoffene Modernität inszeniert und deren Publikum geformt.
Der Titel kann ab Januar 2013 über die Südost Verlags Service GmbH, Waldkirchen, bezogen werden. Der Band untersucht die sprachlichen, kulturellen und religiösen Identitäten sowie die soziale Stellung der Juden im sprachnational polarisierten Böhmen im 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Thema sind das Alltagsleben jüdischer Familien, die Situation jüdischer Studenten in Prag, für das Judentum relevante politische Parteien sowie jüdische Selbstentwürfe. Eine wichtige Rolle spielen Sprache und Literatur der Prager Dichter Kafka, Brod und Langer sowie das Spannungsfeld von Assimilation, Diaspora und Zionismus.
Ich träume von Prag : deutsch-tschechische literarische Grenzgänge
- 388 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Anthologie Ich träume von Prag versammelt Originaltexte von Autoren mit tschechischem oder tschechoslowakischem Hintergrund, die sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die deutsche Literatur hineingeschrieben haben. So finden sich darin Autoren, die in ihrer Art und Weise des Erzählens sehr unterschiedlich zu verorten sind. Verbunden sind sie durch Prag als Chiffre des eigenen und zugleich auch des anderen Raums. Dabei träumen nicht alle davon, verarbeiten es aber dennoch – im fließenden Übergang zwischen dem fiktionalen Bezug auf den Traum, die Erinnerungen und Erinnerungsträume. In der Anthologie vertreten sind Peter Ambros, Zdenka Becker, Maxim Biller, Eugen Brikcius, Jan Faktor, Ota Filip, Katja Fusek, Jiří Gruša, Katarina Holländer, Tomáš Kafka, Jaromir Konecny, Jindřich Mann, Milena Oda, Eva Profousová, Milan Ráček, Helena Reich, Michael Stavarič, Stanislav Struhar und Tereza Vanek.
Das zweibändige Lehrbuch vermittelt alle grundlegenden Verbal- und Nominalformen, Konjugations- und Deklinationsmuster und die wichtigsten Satzgefüge, die für ein richtiges und erfolgreiches Kommunizieren im Alltag relevant sind. Vermittelt wird ein Grundwortschatz von ca. 2500 lexikalischen Einheiten, mit dem problemlos 80% der geläufigen Texte verstanden und alltagstypische Kommunikationssituationen bewältigt werden können. Das Programm richtet sich also ausdrücklich auch an Nicht-SlawistInnen. Ziel ist es, möglichst schnell und sicher zu kommunizieren und Alltagssituationen in Tschechien zu meistern. Die Grammatik wird im Lehrbuch komplett in deutscher Sprache erklärt, das gleiche gilt für die Einführungen zu Übungen und Texten. Am Ende jeder Lektion steht ein Schlüssel für die Übungen. Sprache und Grammatik werden durch einen fortlaufenden Handlungsstrang mit immer wiederkehrenden Personen vermittelt. Es werden keinerlei Vorkenntnisse vorausgesetzt. Das Lehrbuch erwuchs zunächst auf Grundlage von Lehrmaterialien für Studierende des Bohemicum Regensburg-Passau, d. h. für Studierende überwiegend nichtphilogischer Fächer. Mit seiner Ausrichtung als modernes, kommunikatives Lehrwerk für motivierte NichtphilologInnen steht 'Tschechisch kommunikativ' konkurrenzlos auf dem Buchmarkt.
Deutsche und Tschechen : Geschichte. Kultur. Politik
- 727 Seiten
- 26 Lesestunden
Franz Kafka is by far the Prague author most widely read and admired internationally. However, his reception in Czechoslovakia, launched by the Liblice conference in 1963, has been conflicted. While rescuing Kafka from years of censorship and neglect, Czech critics of the 1960s "overwrote" his German and Jewish literary and cultural contexts in order to focus on his Czech cultural connections. Seeking to rediscover Kafka's multiple backgrounds, in 'Franz Kafka and His Prague contexts' Marek Nekula focuses on Kafka's Jewish social and literary networks in Prague, his German and Czech bilingualism, and his knowledge of Yiddish and Hebrew. Kafka's bilingualism is discussed in the context of contemporary essentialist views of a writer's "organic" language and identity. Nekula also pays particular attention to Kafka's education, examining his studies of Czech language and literature as well as its role in his intellectual life. The book concludes by asking how Kafka "read" his urban environment, looking at the readings of Prague encoded in his fictional and non-fictional texts
Příruční mluvnice češtiny
- 799 Seiten
- 28 Lesestunden
Nová moderní mluvnice současného českého jazyka je určena svým zpracováním učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům, moderátorům a vůbec všem uživatelům jazyka, kteří se chtějí poučit o jazykové správnosti a kultivovaném projevu psaném i mluveném. Vydání druhé,opravené.