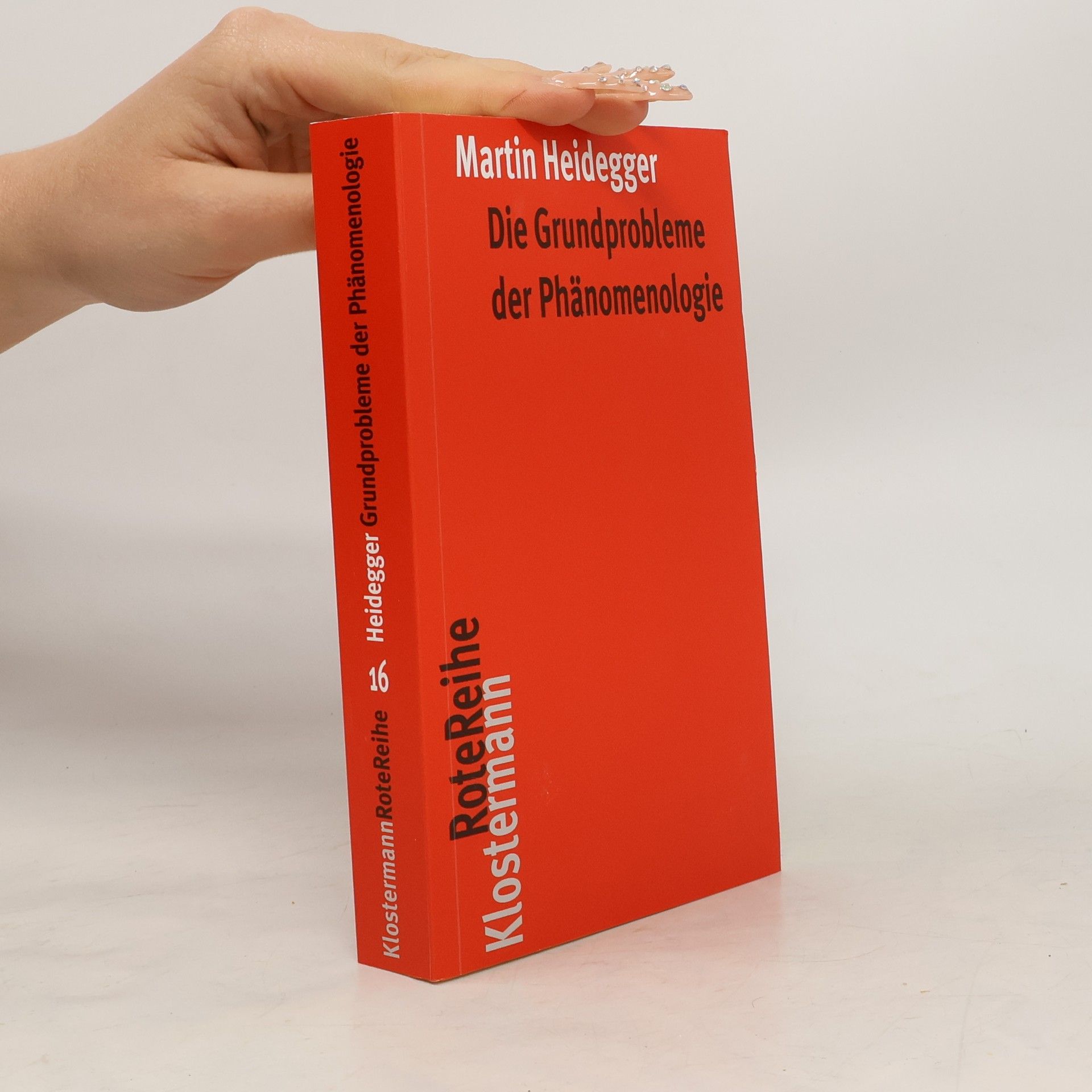Martin Heidegger Bücher
Martin Heidegger war ein deutscher Philosoph, dessen Werk oft mit Phänomenologie und Existenzialismus in Verbindung gebracht wird, obwohl seine Gedanken nur mit äußerster Vorsicht diesen Strömungen zugeordnet werden sollten. Seine Ideen haben die Entwicklung der zeitgenössischen europäischen Philosophie maßgeblich beeinflusst und ihre Wirkung reicht weit über deren traditionelle Grenzen hinaus. Seine Reichweite zeigt sich in Bereichen wie der Architekturtheorie, der Literaturkritik, der Theologie, der Psychotherapie und den Kognitionswissenschaften, was von der Breite und Tiefe seiner philosophischen Beiträge zeugt.

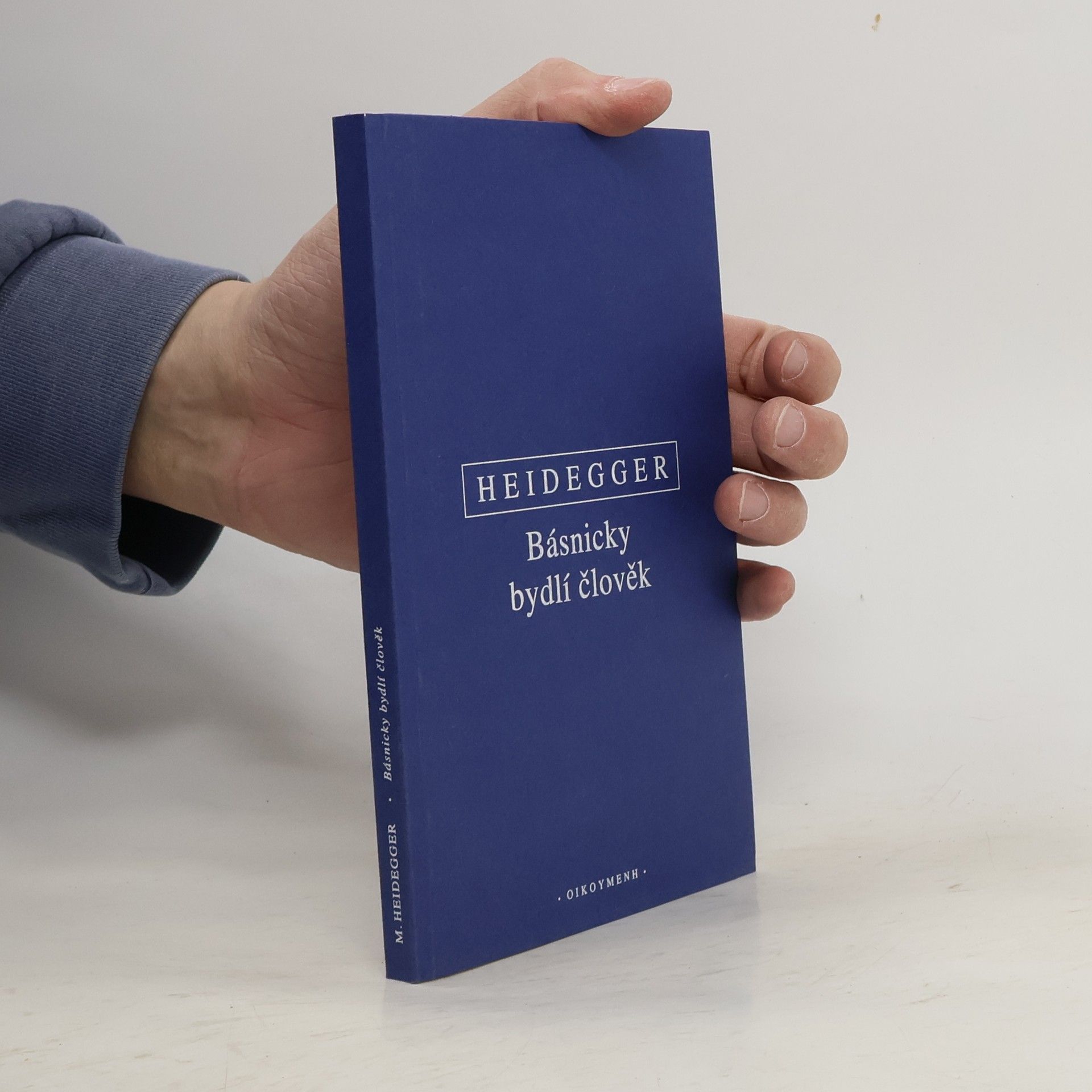




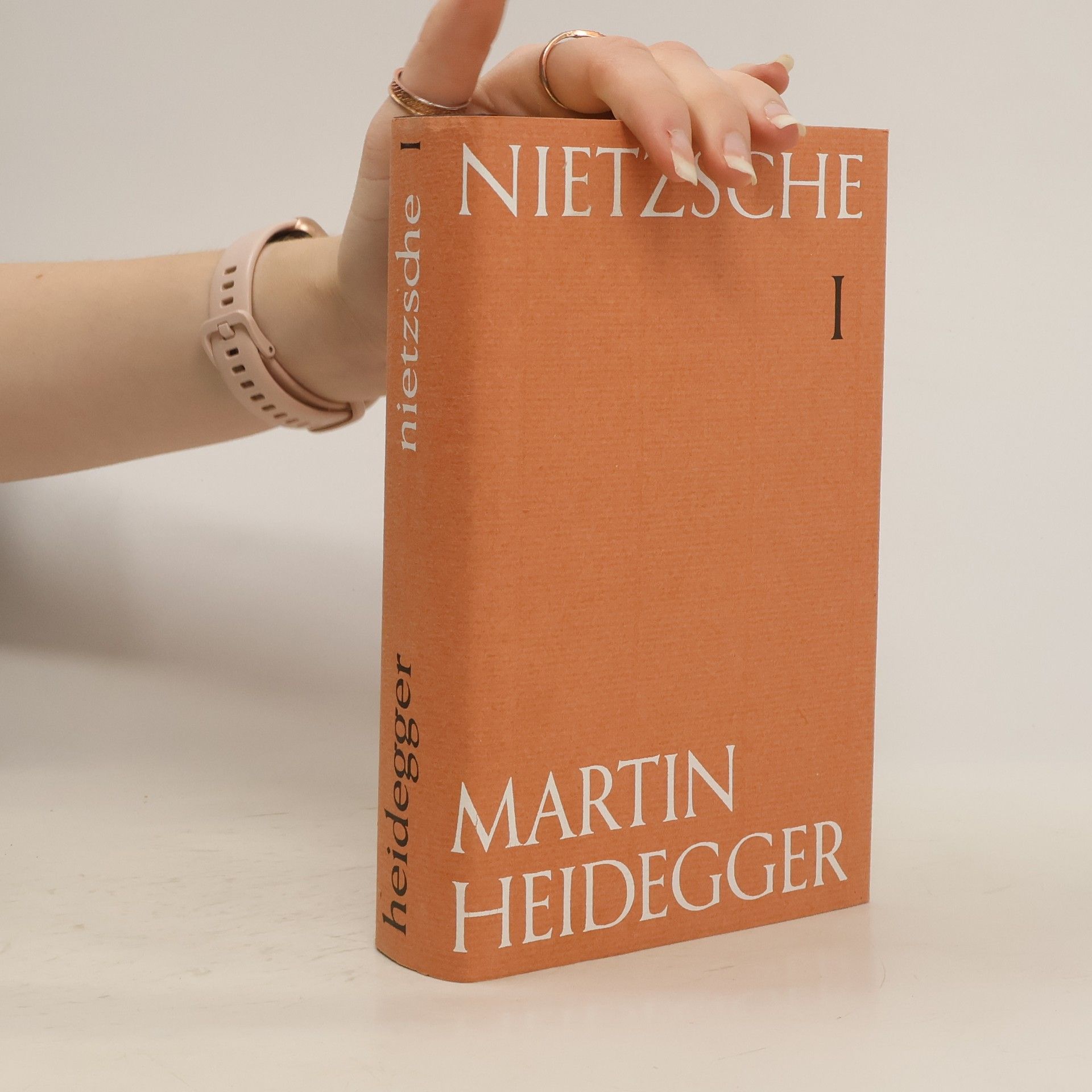
Die "Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)" gelten als Heideggers zweites Hauptwerk nach "Sein und Zeit". Sie bieten eine neue Perspektive auf die Seinsfrage, indem sie das Wesen des Seins im Kontext des ereigneten Entwurfs untersuchen. Diese Arbeit markiert den Übergang von der Metaphysik zur Wahrheit des Seins und vollzieht die "Kehre" im Denken.
Bauen Wohnen Denken
Vorträge und Aufsätze
Heideggers Erörterungen haben in ihrer Vielfalt der Philosophie des 20. Jahrhunderts ungeahnte Perspektiven eröffnet, nachhaltig ist besonders sein Einfluss auf die Theologie.
Heideggers Auseinandersetzung mit Kant zählt zu den bedeutendsten philosophischen Werken des 20. Jahrhunderts. Der Band enthält zahlreiche Randbemerkungen aus Heideggers Handexemplar sowie einen Anhang mit seinen Aufzeichnungen und Texten, die seine philosophische Auseinandersetzung mit Ernst Cassirer und dem Marburger Neukantianismus dokumentieren. Dazu gehört der Bericht über die Davoser Disputation zwischen Heidegger und Cassirer im Frühjahr 1929 sowie der Aufsatz zur Geschichte des philosophischen Lehrstuhls seit 1866, in dem Heidegger die Entwicklung des Marburger Neukantianismus von Hermann Cohen über Paul Natorp bis zu Ernst Cassirer und Nicolai Hartmann prägnant darstellt. In seiner Analyse von Kants „Kritik der reinen Vernunft“ widerspricht Heidegger der neukantianischen Lesart, die das Werk als Erkenntnistheorie und Theorie der Erfahrung interpretiert. Stattdessen sieht er es als Grundlegung der Metaphysik, deren Wiederholung in seiner Fundamentalontologie als Metaphysik des Daseins in „Sein und Zeit“ zu finden ist. Diese Kantauslegung wird als „geschichtlich“ unrichtig, aber als geschichtlich relevant betrachtet, da sie die Grundlage für zukünftiges Denken bereitet, indem sie eine ursprüngliche Fassung des transzendentalen Entwurfs herausstellt.
Zur Sache des Denkens
- 91 Seiten
- 4 Lesestunden
Der Band, erschienen zum 80. Geburtstag von Martin Heidegger (1889--1976), vereinigt vier Stücke: den 1962 im Rahmen des Freiburger Studium Generale gehaltenen Vortrag "Zeit und Sein", das Protokoll eines Seminars zu diesem Vortrag, die deutsche Erstveröffentlichung des Vortrags "Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens" aus dem Jahr 1964 sowie den Beitrag "Mein Weg in die Phänomenologie", 1963 zuerst als Privatdruck erschienen in der Festgabe für den Verleger Hermann Niemeyer zum 80. Geburtstag.
Soubor přednášek významného německého myslitele, představitele filozofie existence, se zaměřuje na vymezení podstaty filozofie.
Gesamtausgabe. 4 Abteilungen / 1. Abt: Veröffentlichte Schriften / Holzwege (1935-1946)
- 382 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Sammlung von sechs Abhandlungen von Heidegger, erstmals 1949/50 veröffentlicht, behandelt zentrale Themen wie die Wesen der Kunst, die Grundlegung des neuzeitlichen Weltbildes, Hegels Erfahrung, Nietzsche und Rilke sowie Anaximander. Sie beleuchtet Fragen des seinsgeschichtlichen Denkens und enthält Randbemerkungen aus Heideggers Handexemplaren.
Parmenides
- 264 Seiten
- 10 Lesestunden
In dieser Vorlesung wird der seinsgeschichtliche Wandel der Unverborgenheit zusammen mit dem Wandel ihrer Gegenüberstellung, der Verborgenheit (Lethe), betrachtet. Der letzte Mythos von Lethe wird anhand der Politeia der Polis (Platon) thematisiert. Der menschliche Gang im Pol der Anwesenheit des Seienden führt zur Frage nach der Anwesung des Seienden nach dem Tod im Bereich der entziehenden Verbergung und zur Frage nach dem griechisch verstandenen Götterwesen. Zentral ist der „Blick“ (thea), der Blick der Götter sowie das Erscheinen des Ungeheuren im Geheuren im Blick des Menschen. Die Vorlesung schließt mit einer Weisung des übersetzenden Wortes Aletheia, das das Offene und Freie der Lichtung des Seins thematisiert, und der Reise des Denkers zum Haus der Göttin (thea).
In dieser Marburger Vorlesung aus dem Wintersemester 1924/25 untersucht Heidegger Platons Spätdialog „Sophistes“ im Kontext von Aristoteles. Der einleitende Teil widmet sich den dianoethischen Tugenden im VI. Buch der „Nikomachischen Ethik“, wo Heidegger eine aufsteigende Stufenfolge des Entbergens erkennt und den Primat der „Physis“ aus dieser Überlegenheit ableitet. So offenbart er die Einheit von Sein und Wahrheit als Horizont des aristotelisch-griechischen Philosophierens und legt den „Boden“ dar, aus dem Platons Seinsforschung im „Sophistes“ hervorgeht. Im Hauptteil der Vorlesung zeigt Heidegger in einer fortlaufenden Interpretation, dass Platons Ontologie aus dem Entbergen entstanden ist. Die Vorlesung belegt, dass Heidegger die Frage nach dem „Sinn von Sein“ und der Un-verborgenheit des Seins in Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition entwickelt hat.
Die Grundprobleme der Phänomenologie
- 474 Seiten
- 17 Lesestunden
In der Vorlesung des Sommersemesters 1927 unter dem Titel "Die Grundprobleme der Phänomenologie" nimmt Martin Heidegger eine "Neue Ausarbeitung des 3. Abschnitts des I. Teiles von 'Sein und Zeit'" in Angriff. Der "Gesamtbestand der Grundprobleme der Phänomenologie in ihrer Systematik und Begründung" besteht in der "Diskussion der Grundfrage nach dem Sinn von Sein überhaupt und der aus ihr entspringenden Probleme". Die so gekennzeichnete Thematik von "Zeit und Sein" wird auf dem "Umweg" einer phänomenologischen Erörterung von vier geschichtlichen Thesen über das Sein behandelt. Die phänomenologisch-kritische Diskussion dieser Thesen führt zu der Einsicht, dass allem zuvor die Grundfrage nach dem Sinn von Sein überhaupt beantwortet sein muss, um die aus den vier geschichtlichen Thesen herausgeschälten vier Grundprobleme in zureichender Weise systematisch ausarbeiten zu können. Wer "Sein und Zeit" als einen Weg zur Ausarbeitung der Seinsfrage überhaupt als dem Ziel studiert, bleibt auf "Die Grundprobleme der Phänomenologie" verwiesen.