Die nordwestiranische Sprache Zazaki, die von etwa 2 Millionen Menschen in Südostanatolien gesprochen wird, hat sich in den letzten Jahren als eigenständige Schriftsprache neu etabliert. Diese Entwicklung ist eng mit der zunehmenden Polarisierung innerhalb der kurdischen Gemeinschaft in der Türkei verbunden, die durch den Konflikt zwischen Kurden und der türkischen Regierung verstärkt wurde. Ein Teil der Zaza hat ein wachsendes Bewusstsein für ihre eigene Sprache und Kultur entwickelt, was zu einem kulturellen Aufschwung und einer Wiederbelebung des Zazaki führt.
Ludwig Paul Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
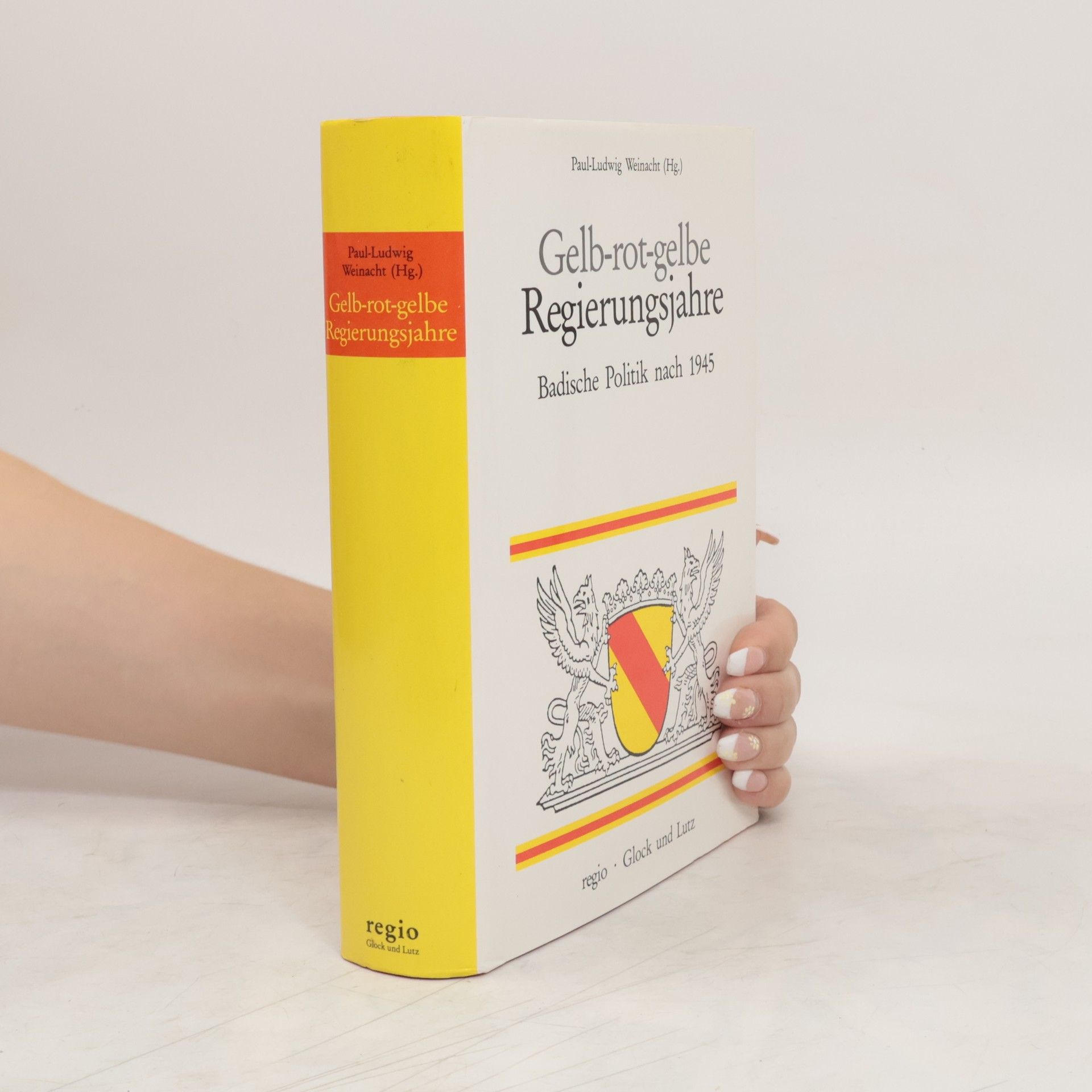



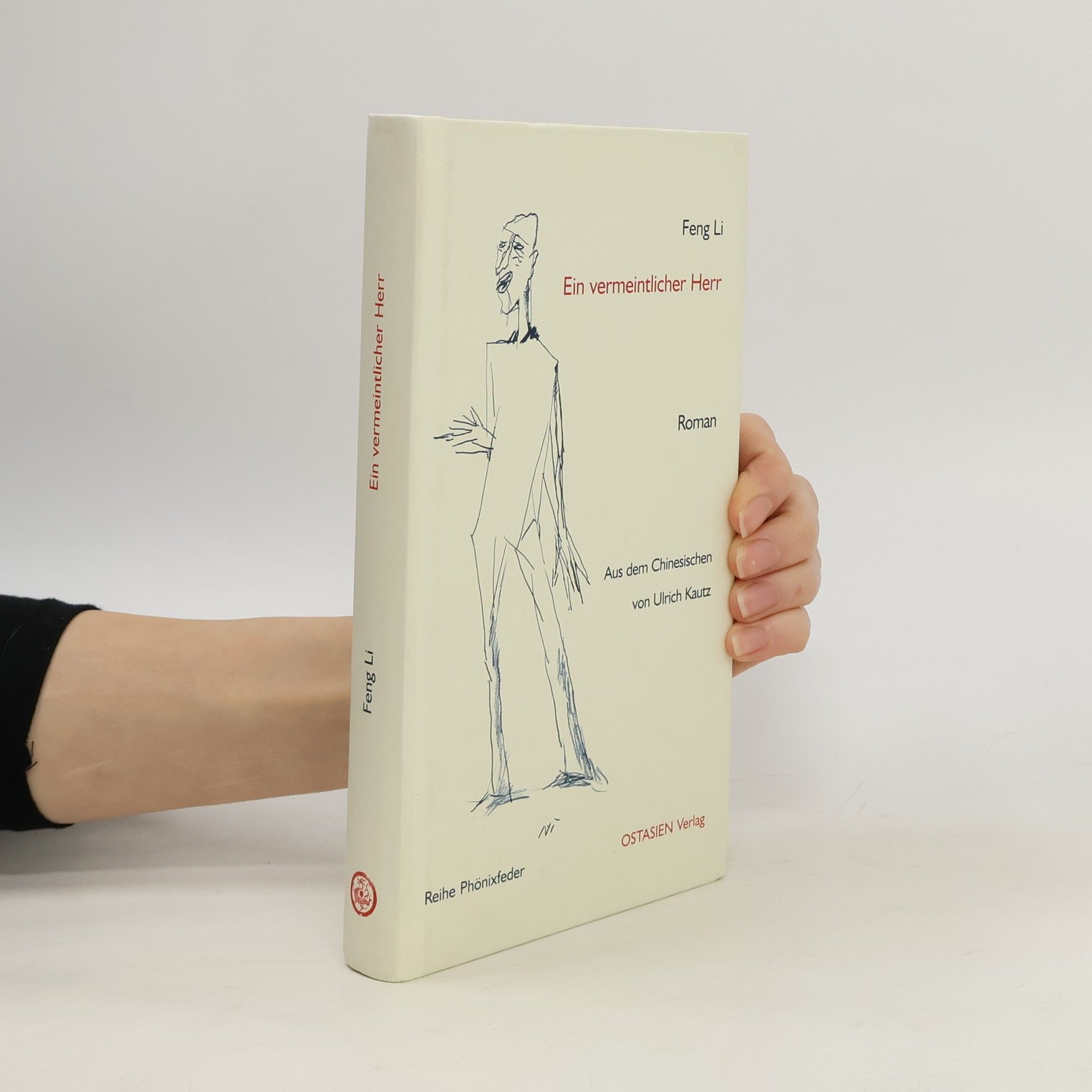
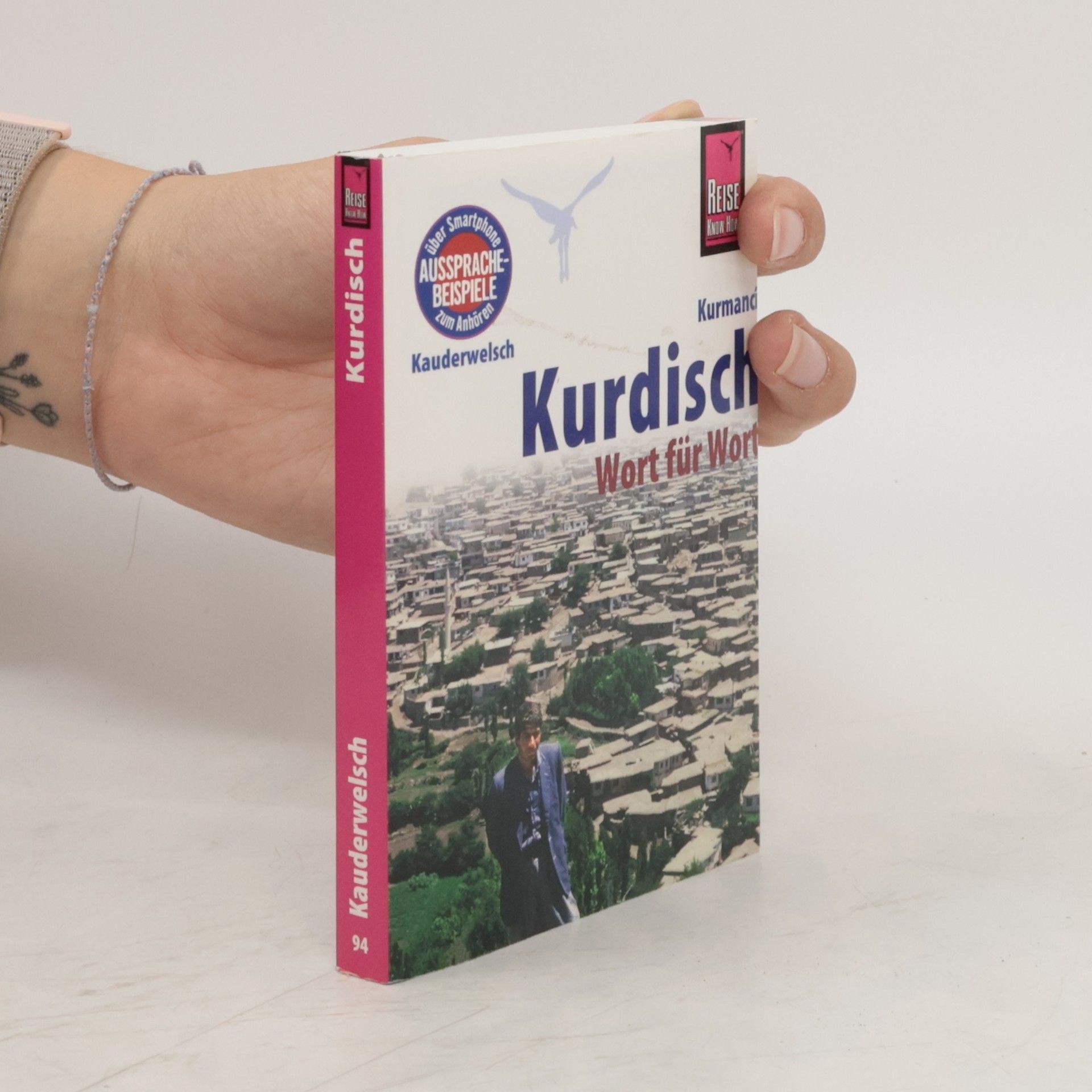
An Analytical Bibliography of New Iranian Languages and Dialects
Based on Persian publications since ca. 1980
- 448 Seiten
- 16 Lesestunden
Focusing on new West Iranian languages and dialects, this bibliography compiles around 3,600 publications from Iran since the 1979 revolution, excluding Persian. It encompasses a variety of works such as grammars, dictionaries, and linguistic articles, marking a significant contribution to Iranian linguistic research. Additionally, it features approximately 900 dialect publications, including folklore elements like poems and children's songs, making it a pioneering resource in dialect folklore studies. Entries are organized by a genetic-geographical system, with English translations or explanations provided for each.
Dieser umfassende Reiseführer enthält aktuelles und unentbehrliches Reise-Know-How für den Iran: - Viele praktische Tipps zu Anreise und Aufenthalt ermöglichen auch dem Individualreisenden eine genaue Planung und Durchführung der Reise. - Fundierte Informationen zu Geschichte, Kultur, Religion und Alltagsleben erleichtern das Verständnis vieler für uns fremder Gewohnheiten. Sie erlauben es, sich angemessen im Land zu bewegen. - Empfehlungen zu Unterkünften und Restaurants für jeden Geldbeutel. - Tipps für den iranischen Alltag: Bazare, Feste und Teehäuser. - Moscheen, heilige Stätten und archäologische Highlights. - Systematische Tourenvorschläge innerhalb der Großstädte. - Vorschläge für Wandertouren im Gebirge (u. a. Besteigung des Damavand). - Exakte Ortsangaben auch für Autofahrer. - Umfangreicher Kartenteil mit Plänen der wichtigsten Städte inklusive Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants und Verkehrsverbindungen. - Sprachhilfe Persisch und Glossar wichtiger Begriffe aus Religion, Architektur und Alltagsleben.
Vom Kolonialinstitut zum Asien-Afrika-Institut
100 Jahre Asien- und Afrikawissenschaften in Hamburg
- 192 Seiten
- 7 Lesestunden
Das Asien-Afrika-Institut (AAI) der Universität Hamburg ist ein in der deutschen Hochschullandschaft einzigartiger Verbund von Fächern. In Forschung und Lehre widmen sich die an ihm tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Sprachen und Kulturen, der Geschichte und der Gegenwart aller Großregionen von Westafrika bis Ostasien. Im Jahre 2008 erinnert das AAI an die Gründung des Kolonialinstituts in Hamburg hundert Jahre zuvor (1908), seinen institutionellen Vorgänger, der zugleich eine wichtige Keimzelle der späteren Universität Hamburg war. Das AAI begeht die 100-jährige Wiederkehr der Gründung des Kolonialinstituts mit einem Festakt. Anlässlich dieses Festakts haben alle Abteilungen und Arbeitsbereiche des Instituts ihre jeweilige Entwicklung von den Anfängen bis zur Gegenwart skizziert und so zu dieser Festschrift beigetragen. Diese soll einer breiteren Öffentlichkeit die Glanzpunkte, aber auch Schattenseiten der Geschichte der Asien- und Afrikawissenschaften in Hamburg vor Augen führen.
Spitfiry a žlutoocasé Mustangy. 52. stíhací skupina za druhé světové války
- 176 Seiten
- 7 Lesestunden
Autoři v knize popisují příběh 52. stíhací skupiny amerického letectva od jejího vzniku v lednu 1941 až po její rozpuštění v listopadu 1945. Její piloti létali hned na dvou typech letounů, které je možné zařadit k nejznámějším stíhacím strojům na světě – britských Spitfirech a amerických stíhačkách Mustang. Text doplnili i stovkou vzácných fotografií včetně řady zcela unikátních snímků letounu Supermarine Spitfire ve službách amerického letectva.
Athen
- 313 Seiten
- 11 Lesestunden
