Was für ein Bild kann man sich von der Vorstellungskraft machen? Diese Frage beschäftigt die Philosophen bis heute. Von Platon und Aristoteles bis Wittgenstein und Sartre hat die Philosophie versucht, sich mit dieser schwer fassbaren Materie auseinander zu setzen. Einen Gegenstand zu sehen ist in verschiedener Hinsicht ähnlich wie ein geistiges Bild vor Augen zu haben – und doch wieder etwas ganz anderes. Mc Ginn zeigt, worin die Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Vorstellungskraft liegen. Dabei diskutiert er auch die Natur von Träumen und geistigen Krankheiten. Außerdem spielt die Einbildungskraft eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der logischen Argumentation. Ohne sie wäre weder Erinnern noch Planen, in die Zukunft denken, möglich. Wir nutzen sie, wenn wir Entscheidungen treffen oder uns fragen, was möglich sein könnte. Colin Mc Ginn versucht dem Phänomen 'Vorstellungskraft' auf die Spur zu kommen, über das wir bei Lichte betrachtet erstaunlich wenig wissen.
Colin McGinn Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
Colin McGinn ist ein britischer Philosoph, der vor allem für seine Arbeiten zur Philosophie des Geistes bekannt ist. Sein Denken zeichnet sich durch die Untersuchung unerklärlicher Aspekte des Bewusstseins aus und legt nahe, dass die menschliche Vorstellungskraft von Natur aus unfähig ist, sich selbst vollständig zu verstehen. Diese Position, bekannt als „Neuer Mysterienismus“, deutet darauf hin, dass einige Rätsel des Bewusstseins für die Menschheit unlösbar bleiben könnten. McGinns Werke berühren oft tiefgreifende Fragen der Existenz und Erkenntnis und machen komplexe philosophische Konzepte einem breiteren Publikum zugänglich.
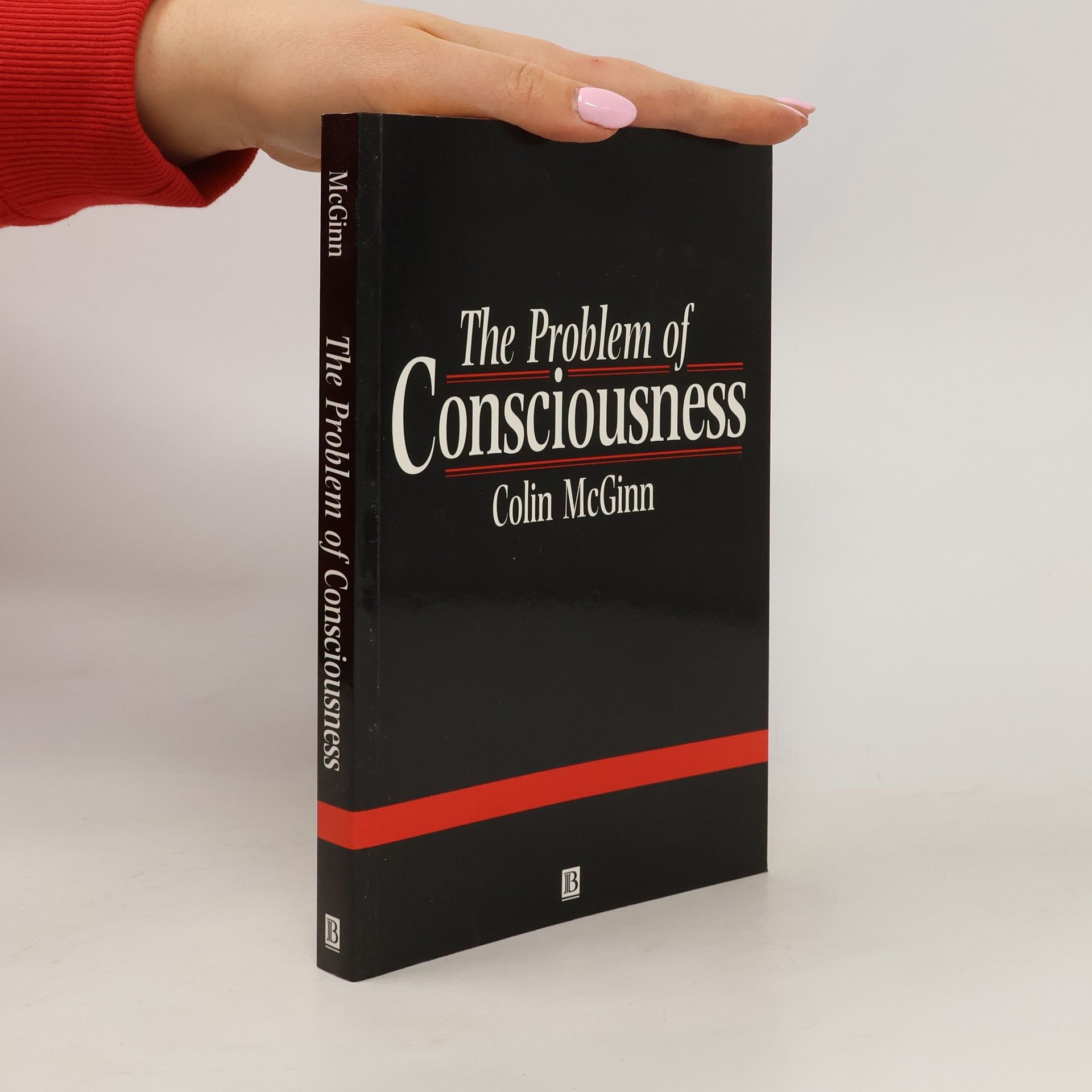
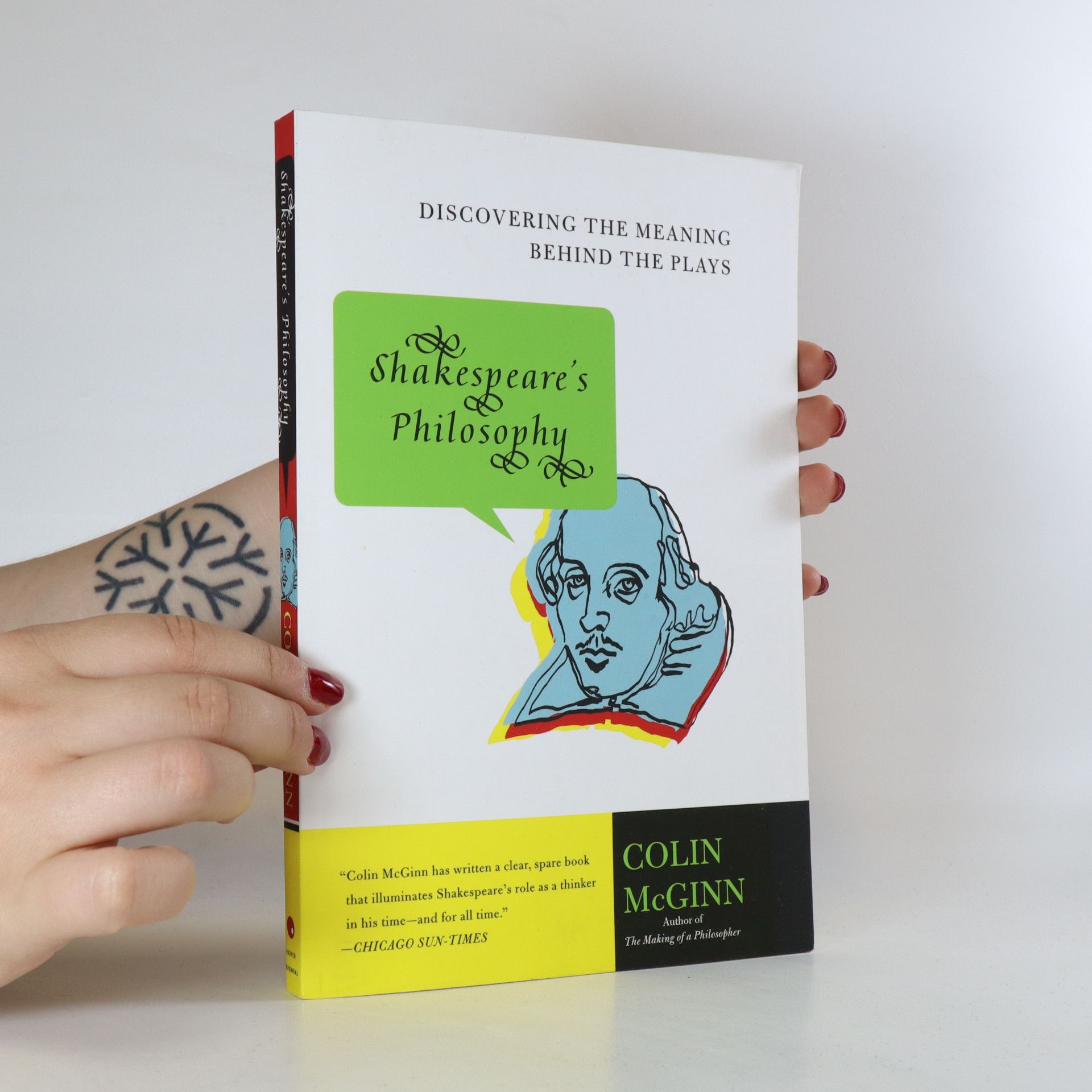
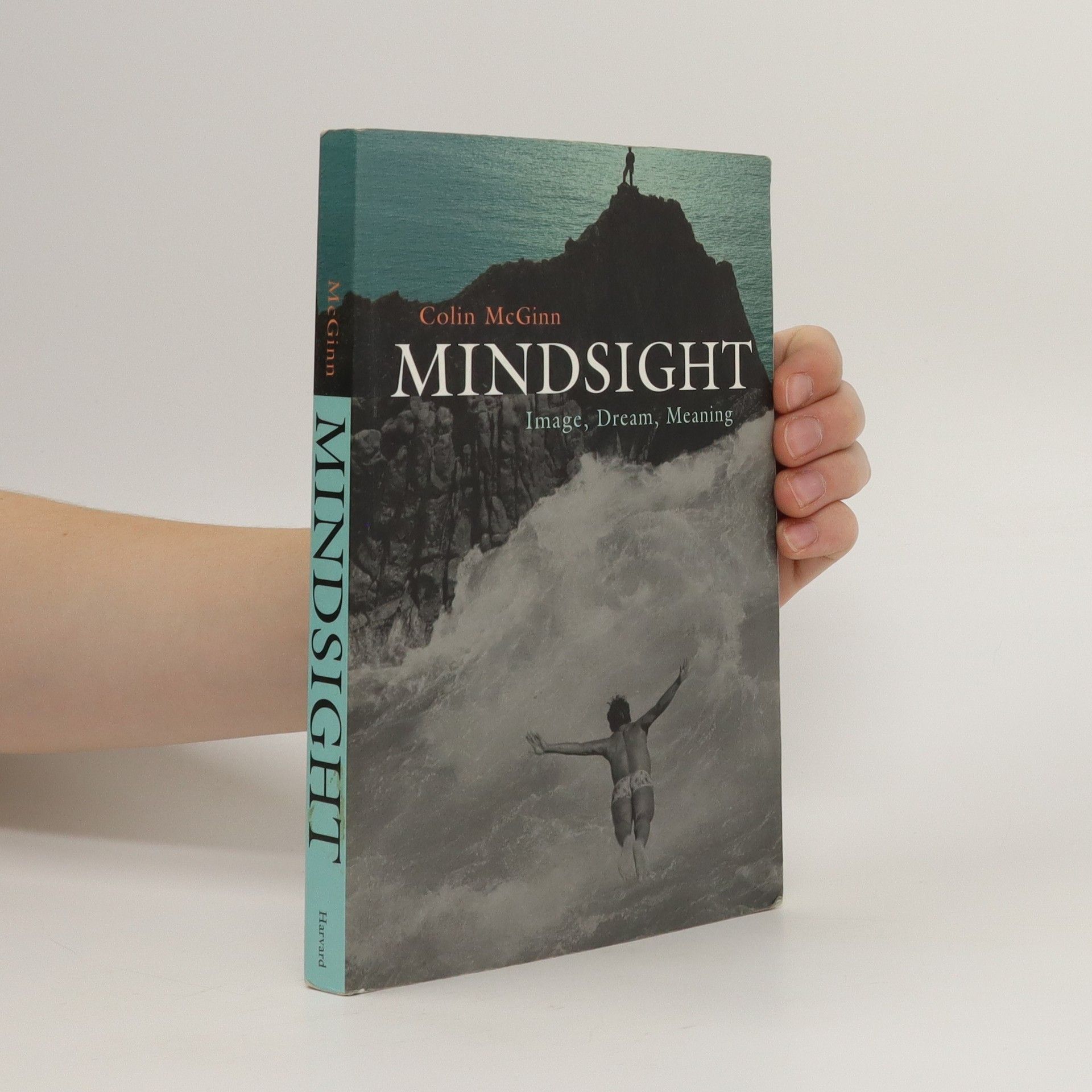



Shakespeare's philosophy. Discovering the meaning behind the plays
- 240 Seiten
- 9 Lesestunden
Shakespeare's plays are usually studied by literary scholars and historians and the books about him from those perspectives are legion. It is most unusual for a trained philosopher to give us his insight, as Colin McGinn does here, into six of Shakespeare's greatest plays––A Midsummer Night's Dream, Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear, and The Tempest. In his brilliant commentary, McGinn explores Shakespeare's philosophy of life and illustrates how he was influenced, for example, by the essays of Montaigne that were translated into English while Shakespeare was writing. In addition to chapters on the great plays, there are also essays on Shakespeare and gender and his plays from the aspects of psychology, ethics, and tragedy. As McGinn says about Shakespeare, "There is not a sentimental bone in his body. He has the curiosity of a scientist, the judgement of a philosopher, and the soul of a poet." McGinn relates the ideas in the plays to the later philosophers such as David Hume and the modern commentaries of critics such as Harold Bloom. The book is an exhilarating reading experience, especially at a time when a new audience has opened up for the greatest writer in English.
Mindsight. Image, Dream, Meaning
- 224 Seiten
- 8 Lesestunden
The guiding thread of this book is the distinction McGinn draws a distinction between perception and imagination, showing what the differences are, arguing that imagination is a sui generis mental faculty. His overall claim is that imagination pervades our mental life, obeys its own distinctive principles, and merits much more attention.
Dieses in den USA heftig diskutierte Buch hat der Frage, wie das Gehirn, also etwas Fleischliches, etwas von ihm gänzlich Verschiedenes, nämlich Geistiges, hervorbringen kann, einen ganz neuen Aspekt gegeben. Wie hat man sich den Zusammenhang von Körper und Geist vorzustellen? Vor allem: Wie überhaupt ist es möglich, daß Materie Geist hervorbringt? Was wäre, wenn das Gehirn einfach prinzipiell nicht in der Lage wäre, über eine bestimmte Grenze hinaus über sich nachzudenken? Kenntnisreich und in verständlicher Sprache erörtert Colin McGinn eine der spannendsten Fragen des Nachdenkens über uns selbst. Seine Antwort wird Sie überraschen.§
The Problem of Consciousness
- 224 Seiten
- 8 Lesestunden
Can consciousness be fitted into a naturalistic worldview or is it inherently mysterious? In virtue of what does a physical organism come to have an inner conscious life? This book argues that we are not equipped to understand the workings of conciousness, despite its objective naturalness.