Ethik als Erste Philosophie
Aus dem Französischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Gerhard Weinberger
Emmanuel Levinas war ein Philosoph, dessen Werk sich auf die ethische Begegnung mit dem Anderen konzentriert. Er entwickelte das Konzept der „Ethik als erste Philosophie“, das besagt, dass unsere Verantwortung für den Anderen jeder Suche nach objektiver Wahrheit vorausgeht. Levinas argumentierte, dass sich der Andere als transzendent und nicht auf eine bloße Objektivierung durch das Selbst reduzierbar offenbart. Seine tiefgründigen Untersuchungen befassen sich mit der Natur der Subjektivität, der Unersetzlichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen und der grundlegenden ethischen Verantwortung, die unserer Existenz innewohnt.

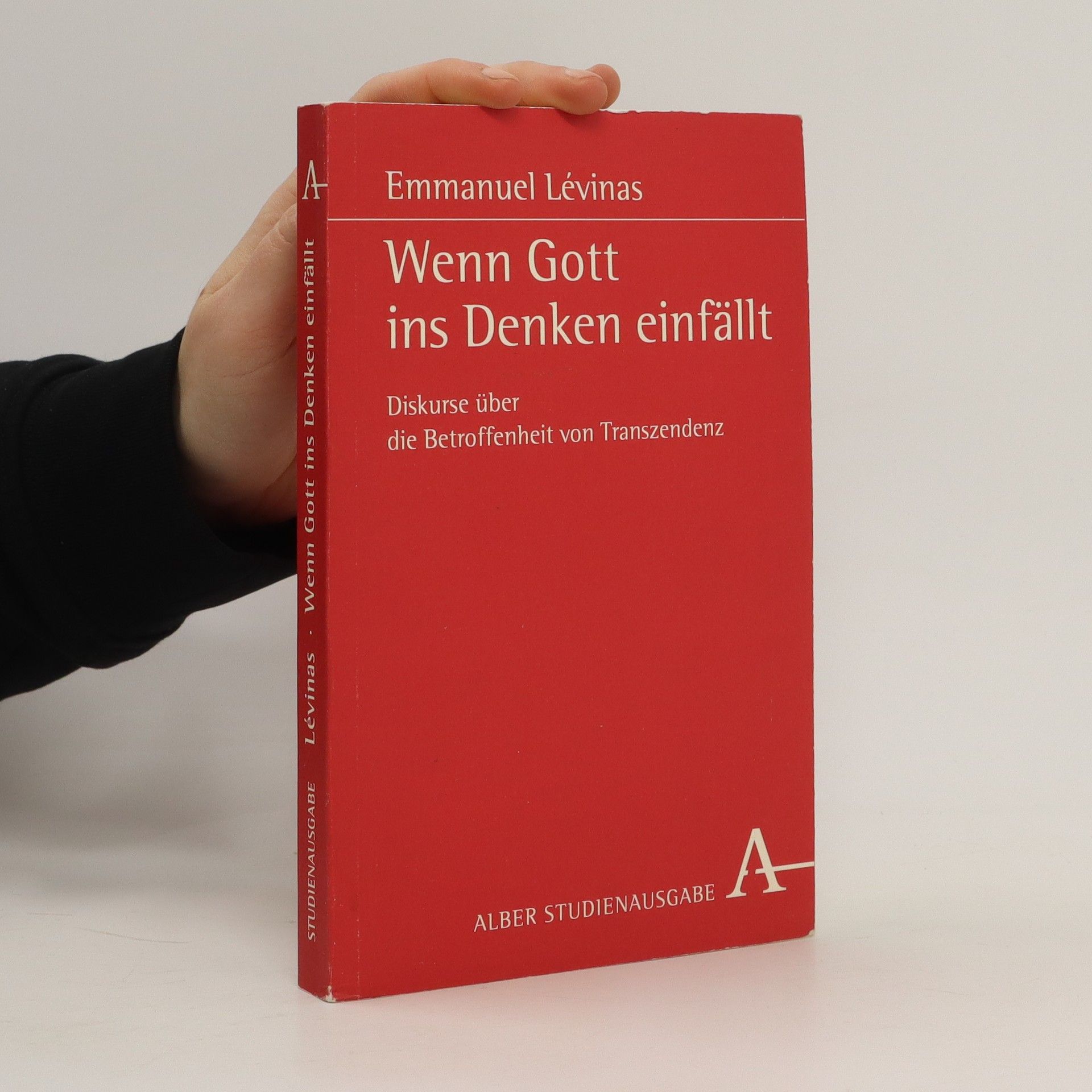
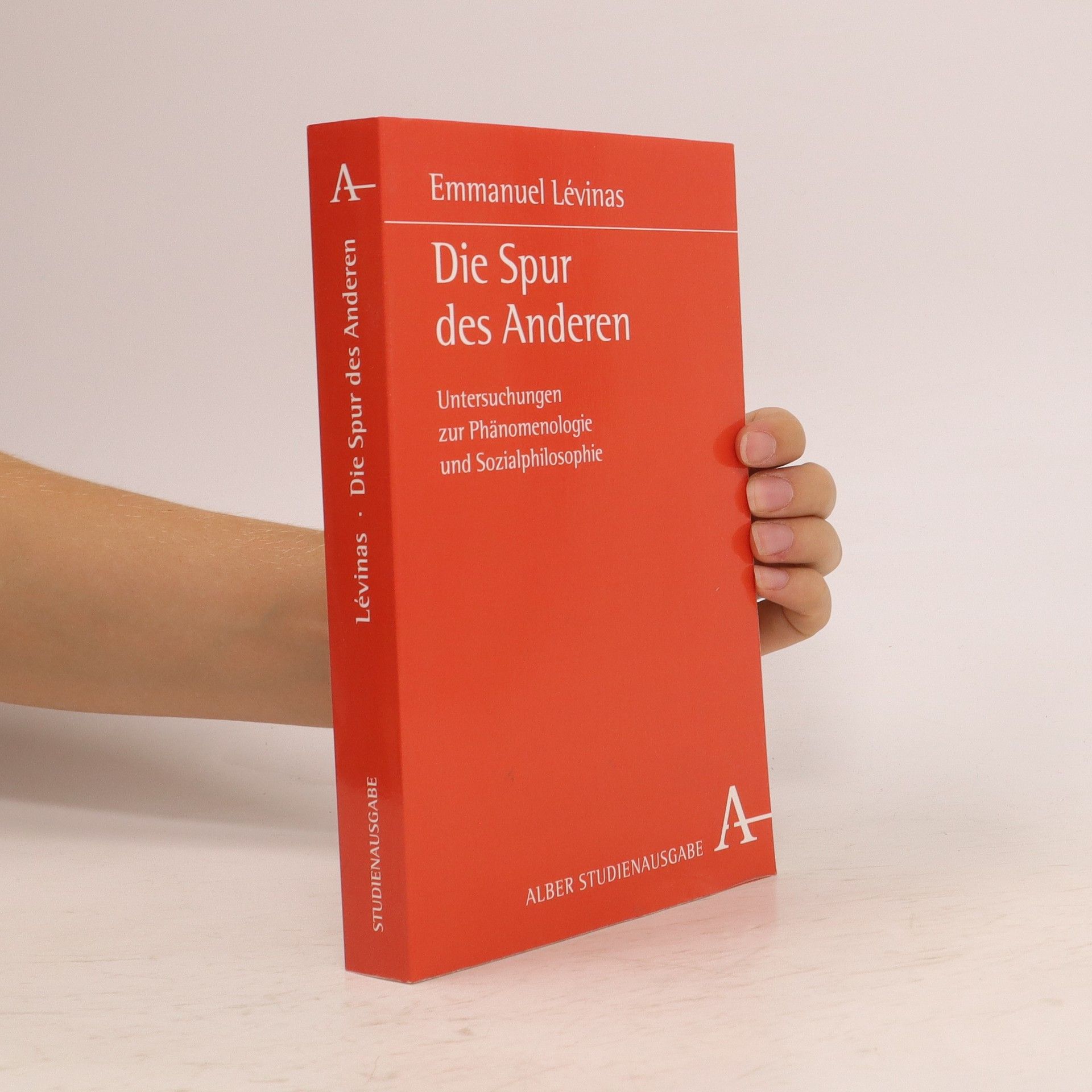
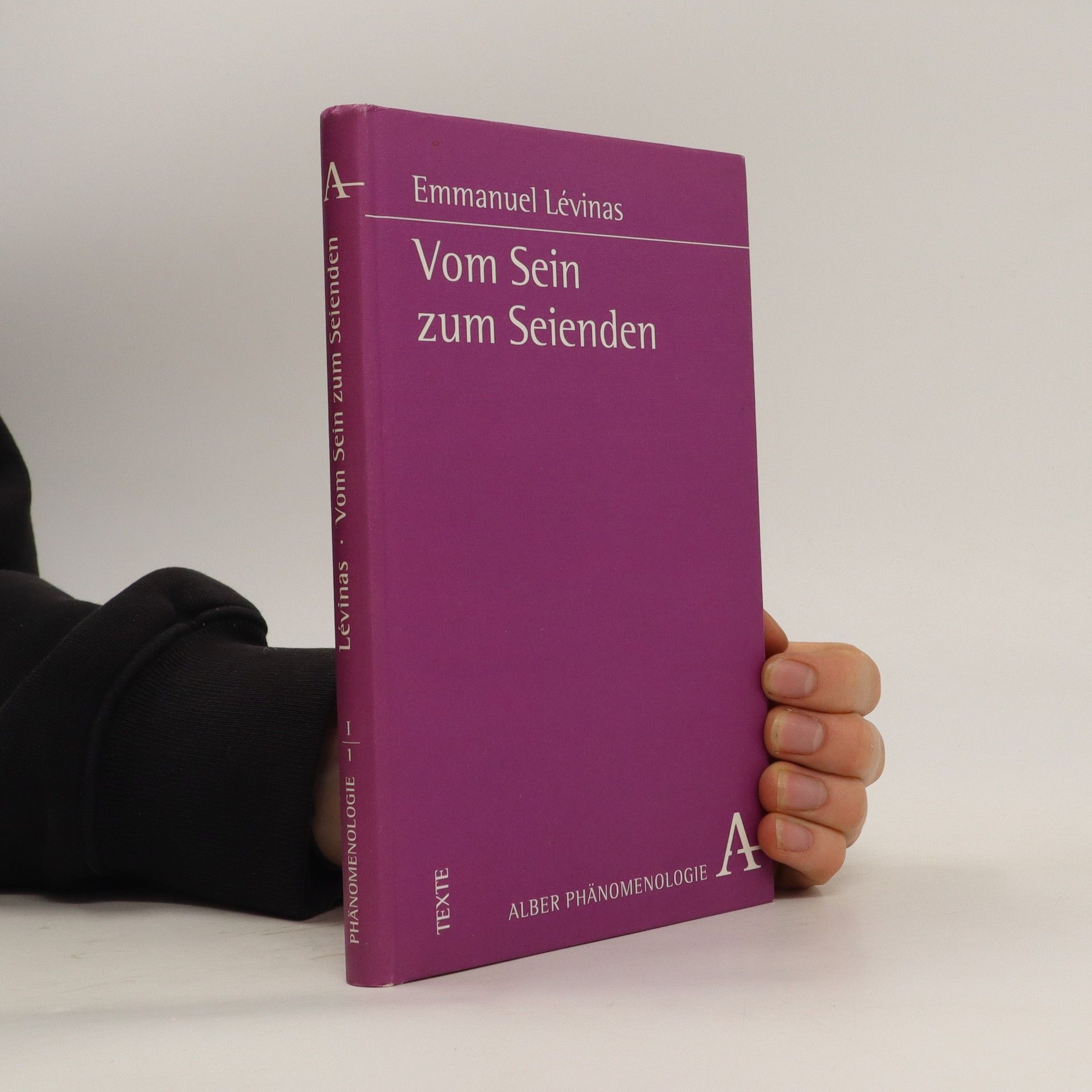

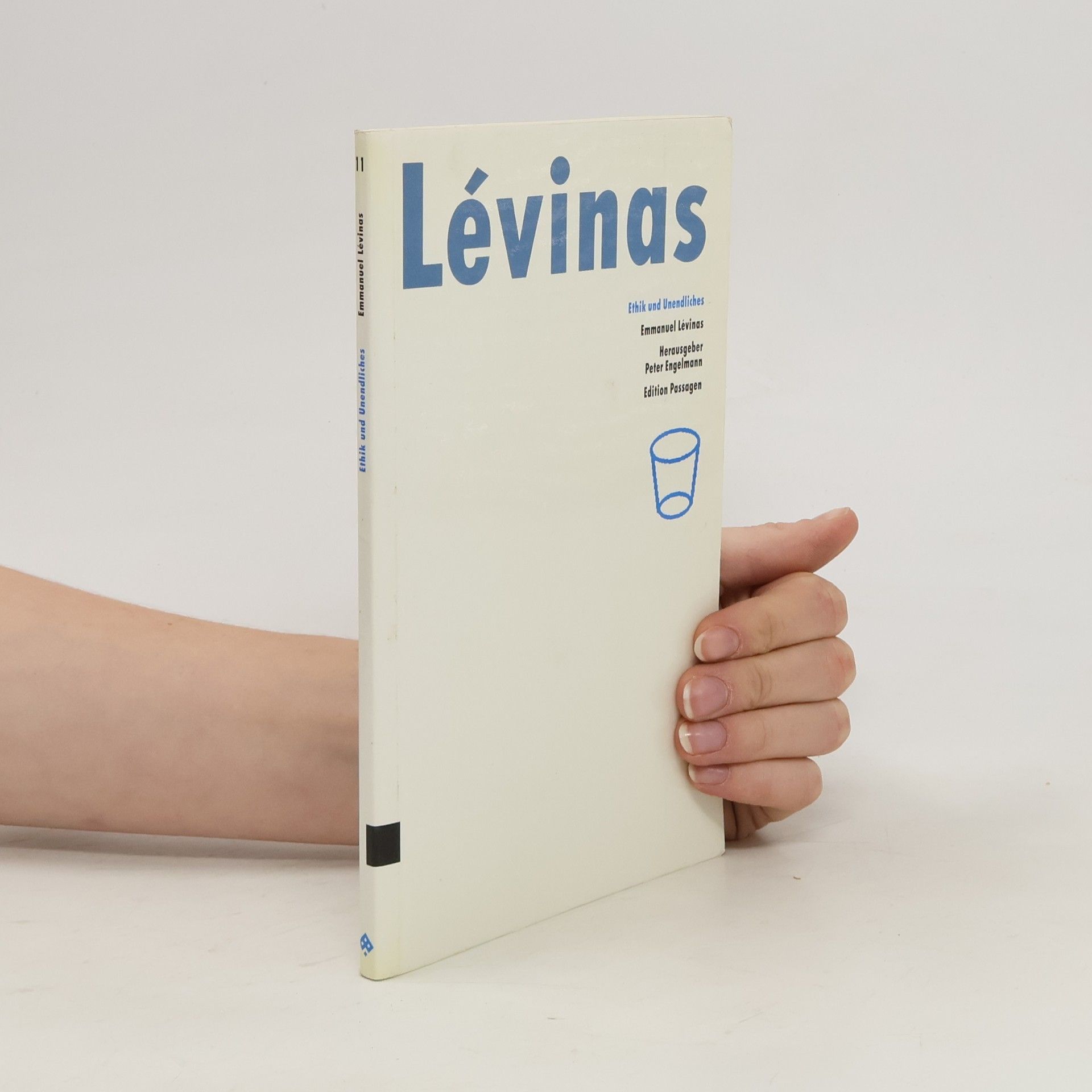

Aus dem Französischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Gerhard Weinberger
Kniha Objevování existence s Husserlem a Heideggerem (1967) obsahuje soubor textů, které Emmanuel Levinas – jedna z klíčových postav filosofie dvacátého století – věnoval myšlení zakladatelů fenomenologie. Tyto studie vznikaly v období pokrývajícím několik desetiletí. Úvodní část knihy obsahuje Levinasovy rané studie o Husserlovi a Heideggerovi, jejichž cílem je představit jejich myšlení francouzskému čtenáři. V dalších částech najdeme texty, ve kterých si Levinas se svými někdejšími učiteli vyrovnává účty, pokud jde o specifičtější otázky – o problematiku řeči, intencionality, počitku atd. Toto zaujetí odstupu mu potom umožňuje vybudovat v průběhu času svou vlastní, původní myšlenkovou pozici, která bude ve své rozvinuté podobě vyjádřena v knihách Totalita a nekonečno(1961) či Jinak než být aneb mimo esenci (1974). Konkrétní podoby rozvíjení této pozice lze sledovat v textech tvořících závěrečné partie přítomného souboru, v nichž jsou některé motivy ze zmíněných knih již zcela jasně naznačeny. Čtenáři se tímto způsobem dostává do rukou určité svědectví o filosofickém vývoji Levinase samotného, jež bezesporu umožňuje lépe uchopit jeho vlastní přínos pro francouzskou fenomenologii i pro filosofii obecně.
Kniha je prvým knižným prekladom Levinasa do slovenčiny. Obsahuje štyri prednášky (Voči blížnemu, Pokušenie pokušenia, Zem zasľúbená alebo zem dovolená, Strý ako svet), prednesené v rokoch 1963-1966 na kolokviu židovských intelektuálov v Paríži. Tieto talmudické komentáre sú, ako hovorí Levinas, pokusom preložiť židovské myslenie do jazyka súčastnosti. To znamená, že na jednej strane objasňujú prostredníctvom židovských textov problémy, ktorým čelíme dnes, na druhej strane vysvetľujú zmysel týchto textov prostredníctvom súčasných problémov.
Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie
Lévinas verabschiedet das durch die Selbstherrlichkeit des Ich geprägte Seins-Denken zugunsten einer Ethik als neuer Erster Philosophie. Alles Denken, so seine Überzeugung, das vom Ich oder Selbst ausgeht, bleibt im Grunde allein und schließt den Anderen aus, ja vernichtet ihn in letzter Konsequenz. Doch der Andere ist immer schon da. er begegnet als „Antlitz': als Verbot „Du sollst mich nicht töten', als Gebot „Du sollst mich in meinem Sterben nicht allein lassen'. Diese Begegnung, als Schock erlebt, reißt das Ich aus dem Schlaf der Selbstgewissheit.
Ce texte reproduit quatre conférences faites en 1946 et 1947, sous ce titre, au Collège de philosophie fondé par Jean Wahl, lieu d'ouverture dans lequel se retrouvait, au lendemain de la Libération, " la multiplicité même des tendances dans la philosophie vivante ". Repris dans la collection Quadrige, il est régulièrement réédité, preuve que " cette façon d'interroger le temps nous semble en être, aujourd'hui encore, le problème vivant " remarque l'auteur dans sa préface.
Dans Altérité et transcendance - le dernier ouvrage de philosophie publié de son vivant -, Emmanuel Levinas définit sa problématique en confrontant des écrits de sa dernière période avec des pages des années 1960-1970, arrachées au silence. Ces textes nous offrent de nouvelles et percutantes analyses sur la proximité et la paix, sur l'interdit de la représentation, sur les droits de l'autre homme, et développent une saisissante réflexion sur la mort. On y retrouve, également, le thème de la " métaphysique du visage " qui, nul ne l'ignore désormais, est au cœur de son paysage conceptuel. Son texte liminaire, " Philosophie et transcendance ", rappelle avec force, dans un monde où sévit si souvent le fanatisme religieux, que la voie par excellence de la transcendance est l'éthique. Dans l'étude suivante sur " Totalité et totalisation ", Levinas se demande " si la notion de l'être ne doit pas être repensée en fonction de l'idée de totalité ". A la lumière de la biographie de l'auteur, qui fut tributaire des vicissitudes d'un siècle inondé de barbarie, cette ultime parole philosophique est d'une actualité prégnante. On célèbre en 2006 le centenaire de la naissance d'Emmanuel Levinas, dont l'œuvre compte désormais parmi les plus emblématiques dans l'histoire de la philosophie du XXe siècle.
Die drei Talmud-Lesungen des Bandes befassen sich mit dem Verhältnis des jüdischen Denkens zum griechisch-abendländischen Denken und Staatsverständnis, mit der Frage der Transzendenz, die für die Inspiration des Denkens durch die Berührung mit dem Anderen steht, sowie mit der Suche nach Identität und der Besinnung auf das Eigene. Der moderne Mensch steht unter dem Einfluss so vielfältiger kausaler Ketten (Psychoanalyse, Soziologie, politische Ökonomie etc.), dass ihm der Sinn für das ihm Eigene verloren zu gehen droht. Levinas untersucht die Frage der Subjektivität, die in Europa eine lange Tradition hat. In der abendländischen Erkenntnistheorie wird sie als eine Frage der Erkenntnis behandelt, die immer vom Anspruch des Einzelnen, die Welt durch Wissen beherrschen zu wollen, ausgeht. Dabei kommt das zu kurz, was das Subjekt dem Anderen verdankt. Auch die Lesung, die sich der Transzendenzfrage widmet, wendet das Thema ins Ethische. Jede Lektüre der Bibel, wie auch jedes Lesen von Literatur, ist ohne die Fähigkeit, sich selbst zu transzendieren, nicht möglich. Sogar im rationalen Denken entdeckten die Talmudisten (Levinas zufolge) das »Prophetische«, also die Dimension einer interpersonellen Kommunikation, die auf ethischer Grundlage steht. Der Schlussband der Talmud-Exegesen von Emmanuel Levinas wird durch ein Nachwort des Übersetzers Frank Miething ergänzt.
Dieses schon vor dem Zweiten Weltkrieg konzipierte und zum Teil in deutscher Gefangenschaft redigierte Buch macht das Bewusstsein der Gefangenschaft des Menschen zum Thema. Die Erfahrung der Gefangenschaft artikuliert sich in der tragischen Verstrickung des Menschen in die Vergangenheit, die Lévinas als die Seinsverstrickung des Menschen vorführt. Die Perspektive einer Befreiung wird dem Menschen jedoch nicht aus eigener Kraft zuteil, sondern aus der Beziehung zum Anderen, zum Weiblichen. Lévinas versteht seine Analyse des Weges vom Sein zum Seienden und vom Seienden zum Anderen zugleich als eine Analyse der Zeit. „Ein trotz des geringen Umfangs großes, weil reiches und konzentriertes Buch.„ Süddeutsche Zeitung „Reich an Einzelstudien, die die phänomenologische Schule verraten, ist das opusculum ein gedanklich dicht gedrängter, origineller Versuch über das Subjekt. Bemerkenswert auch, dass die Apologie des Subjekts auf Zentralbegriffe und -topoi jüdischer und christlicher Tradition zurückgreift und sie reinterpretiert.“ Theologische Revue
Rozhovor Emmanuela Lévinase s Bernhardem Casperem 11. června 1981 v Paříži -- Rozhovor Emmanuela Lévinase s Christophem von Wolzogenem 20. prosince 1958 v Paříži
Jedna z prvních prací francouzského filozofa novodobého humanismu. Ontologie lidské jinakosti v čase. Vychází synopticky česky a francouzsky.