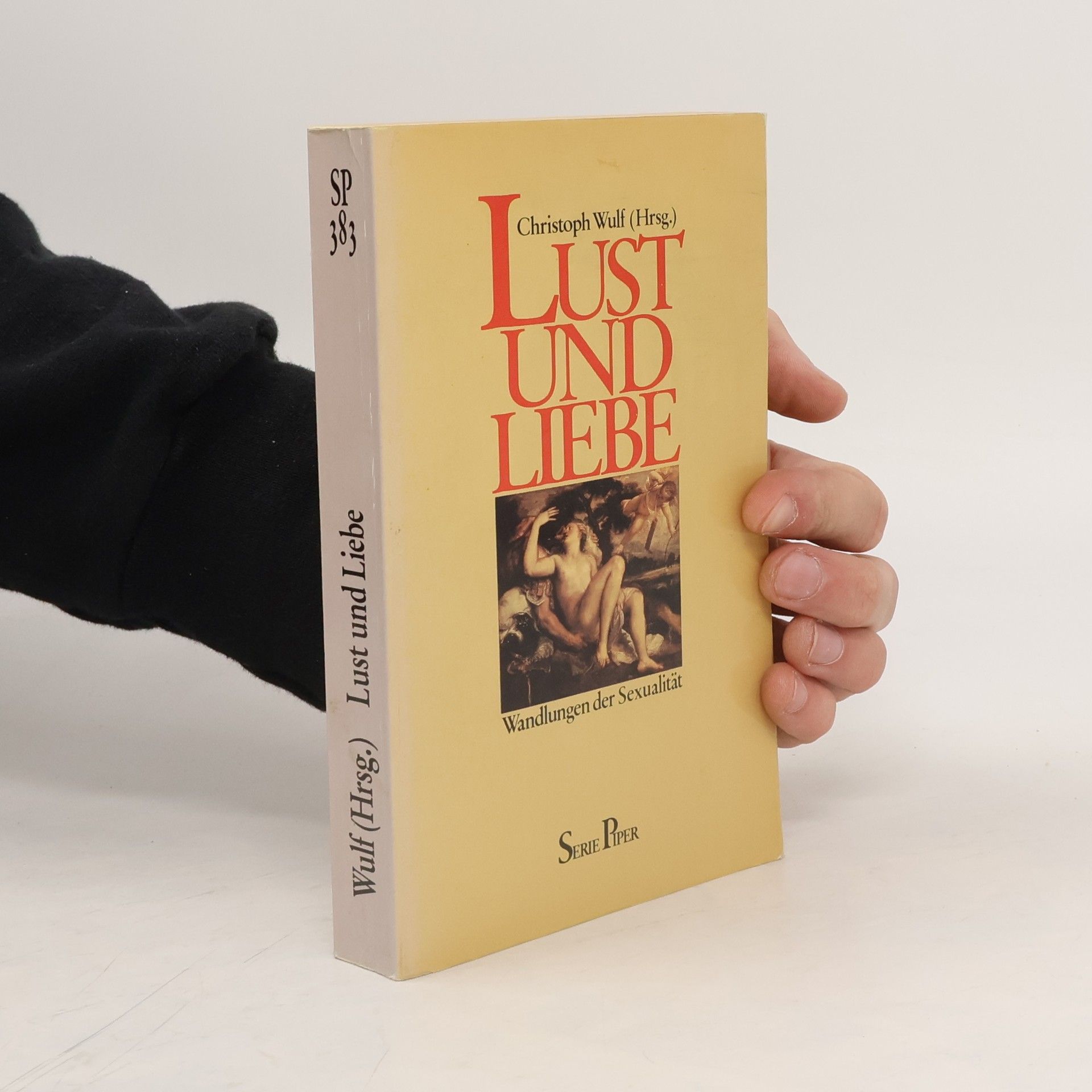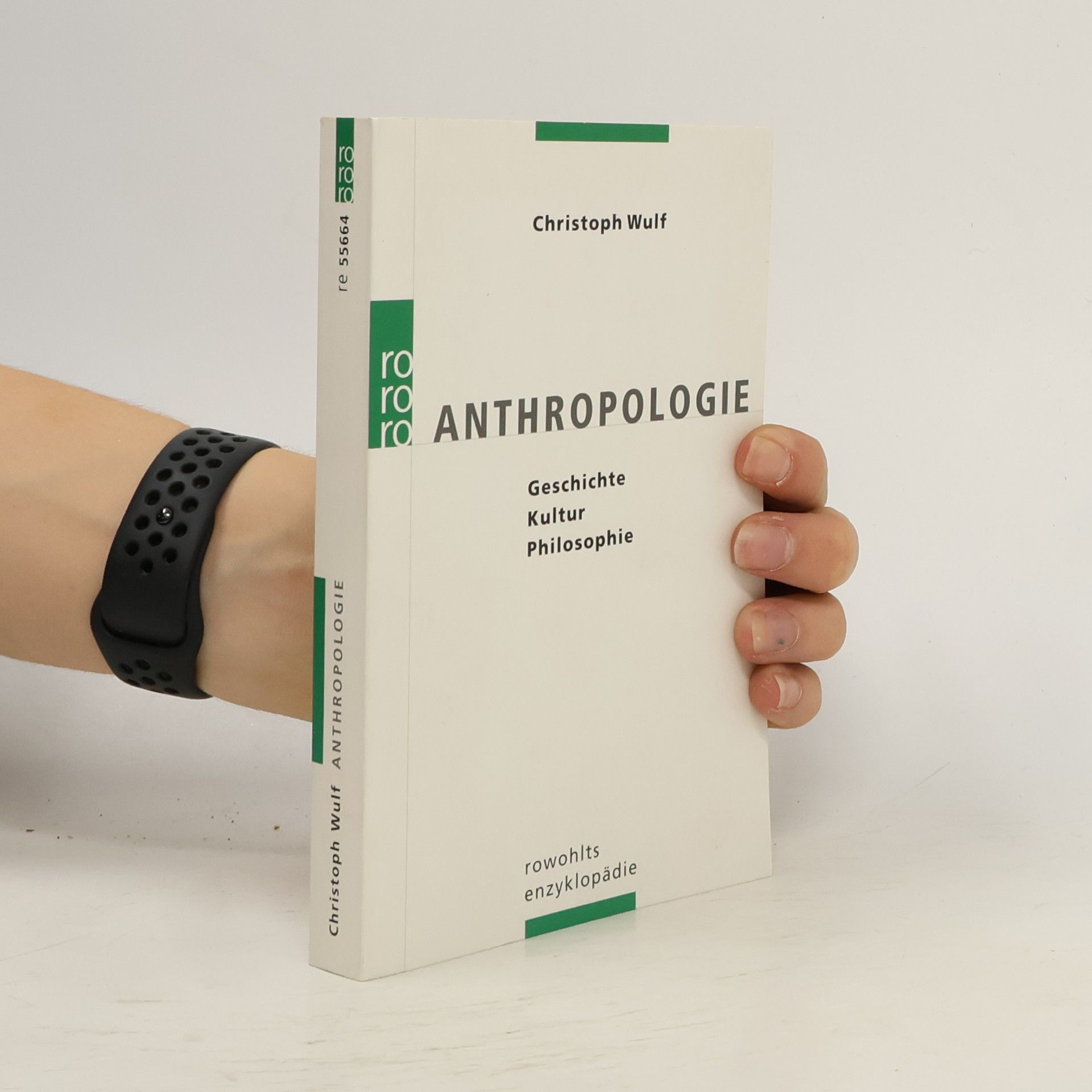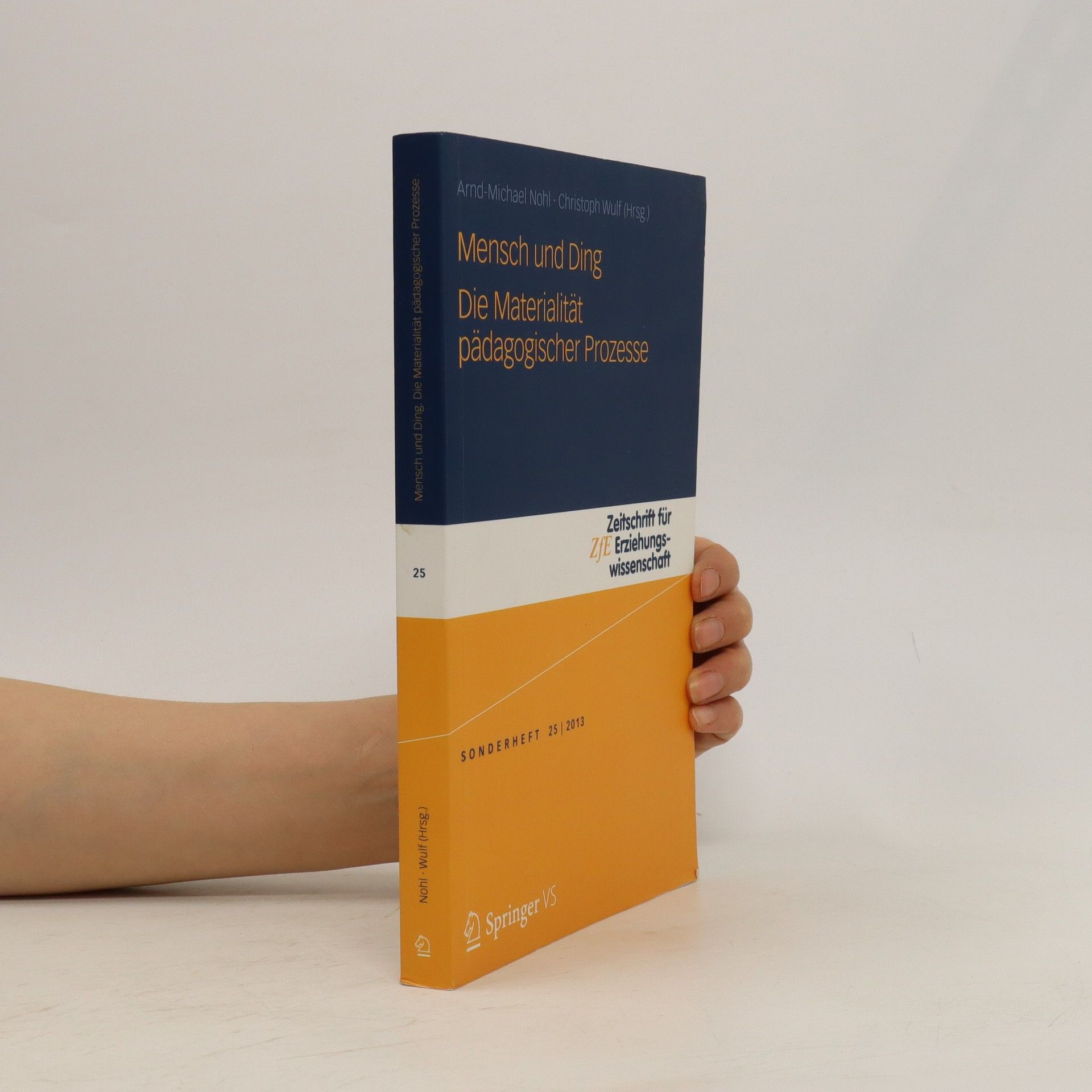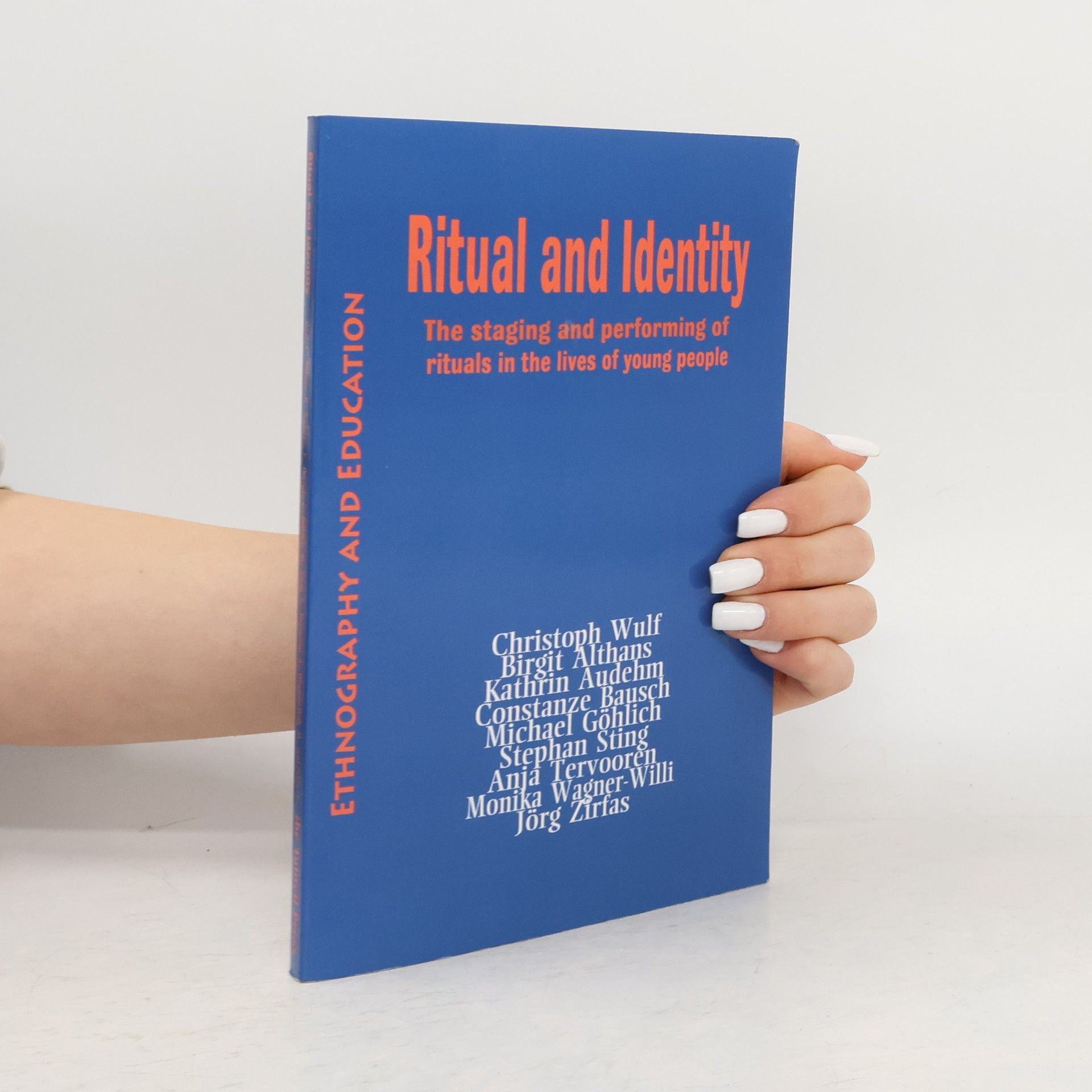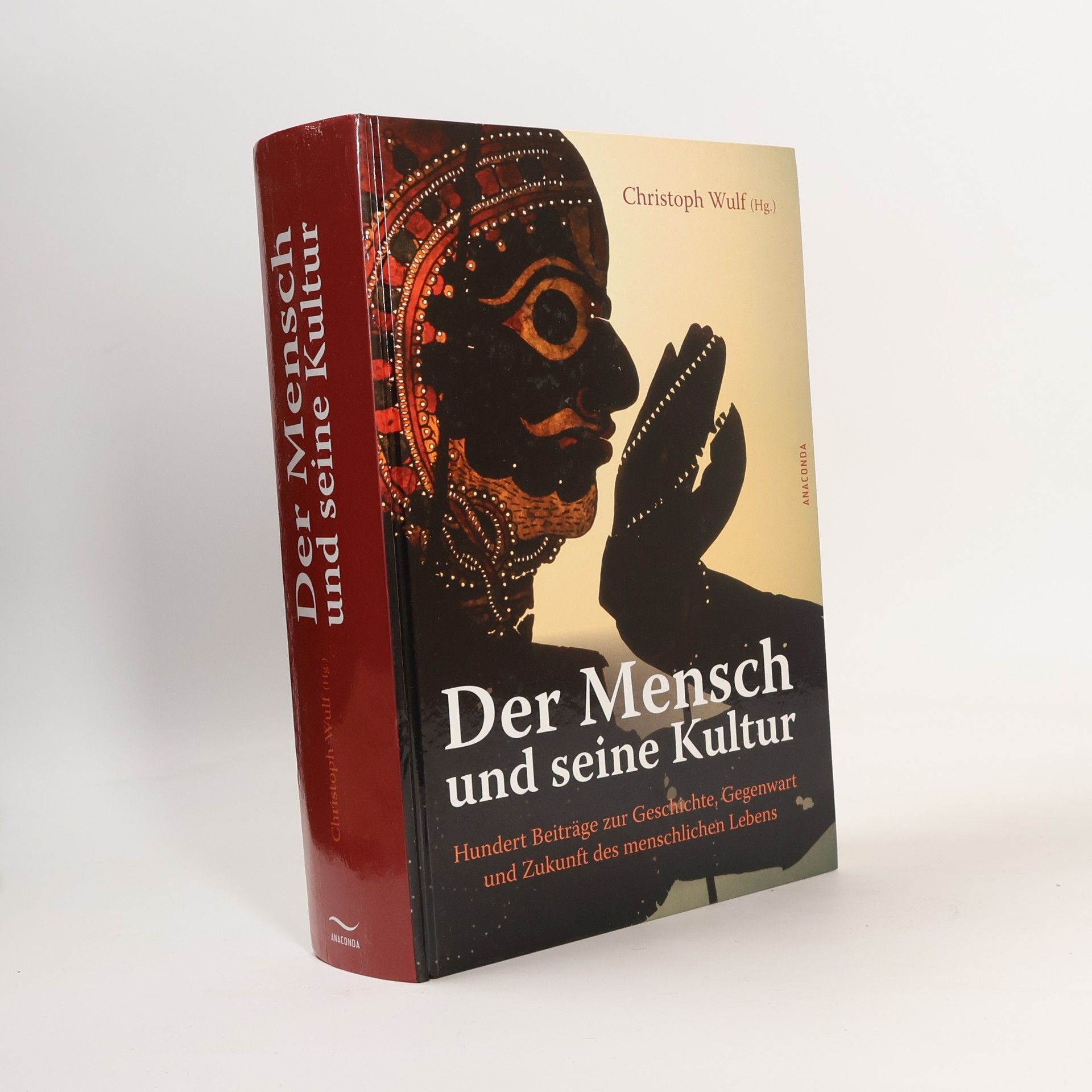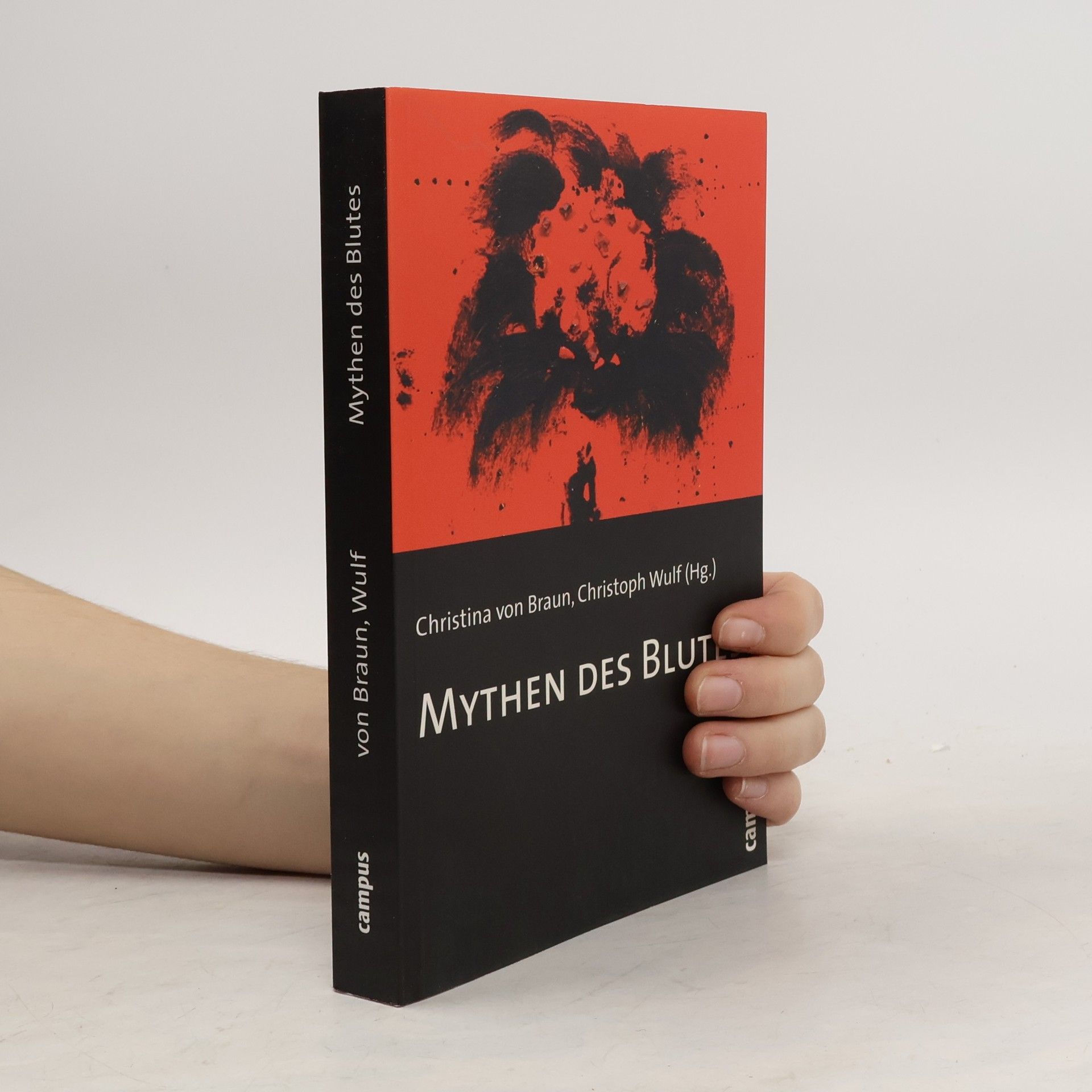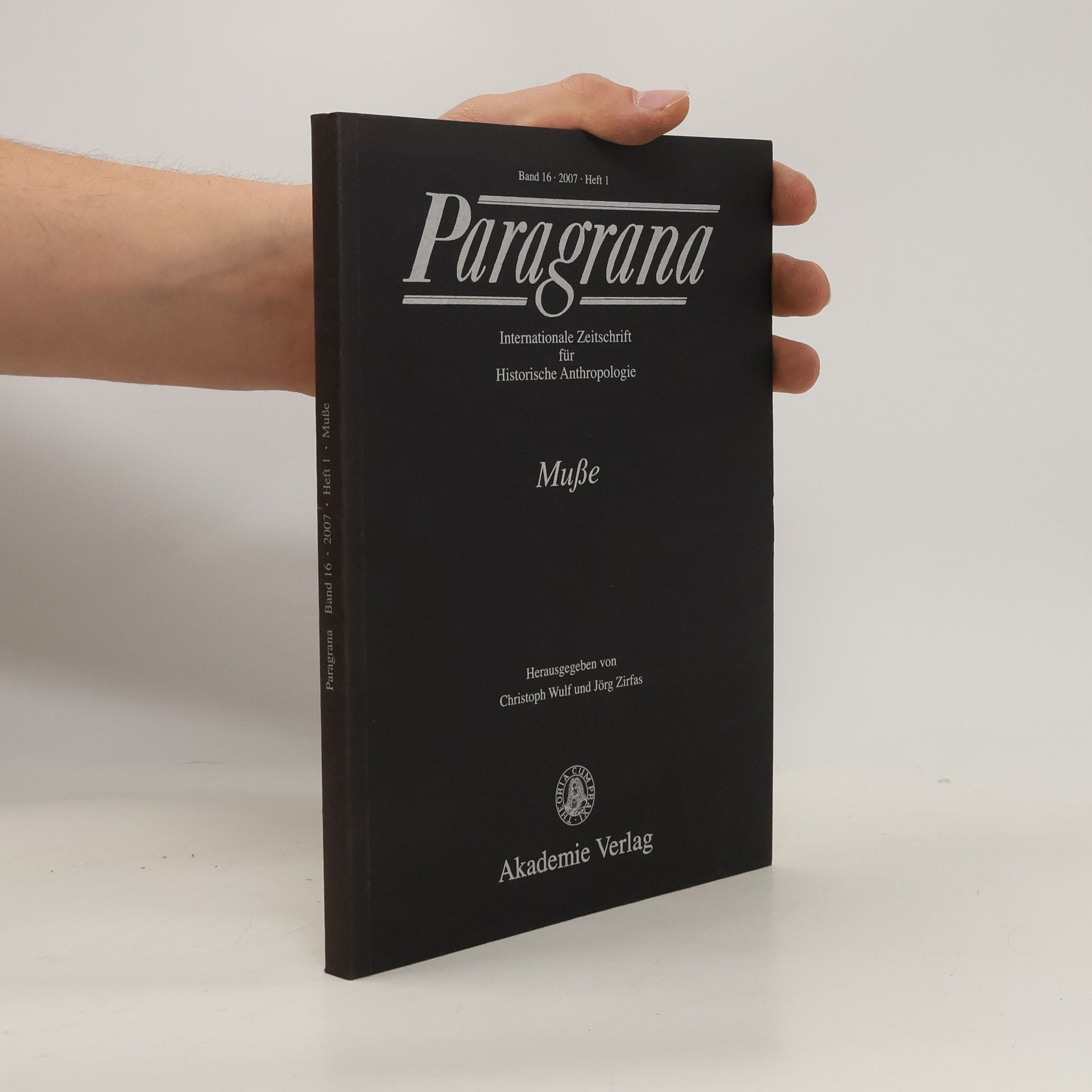Soziale, informelle und transformative Bildung
Beiträge zur sozialpädagogischen und anthropologischen Bildungsforschung
- 264 Seiten
- 10 Lesestunden
Bildung wird in diesem Band als sozial gefasst betrachtet, indem sie eine Beziehung zwischen Subjekt und Welt herstellt. Die Autor*innen beleuchten sozialpädagogische und anthropologische Diskurse zu Bildung in drei Hauptbereichen: theoretische Beiträge zur Sozialen Bildung, Bildung und Soziale Arbeit sowie Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe. Der erste Abschnitt widmet sich theoretischen Aspekten der Sozialen Bildung, einschließlich lebenslangem Lernen, der Rolle von Geselligkeit in Organisationen und der Bedeutung von Berufsvorstellungen in der Bildung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Sozialität der Leiblichkeit und der poetologischen Perspektive auf Bildungsprozesse. Auch die Herausforderungen der gespaltenen Migration und die Bildungsaufgaben im Anthropozän werden thematisiert. Im Bereich Bildung und Soziale Arbeit wird die historische Entwicklung der Sozialpädagogik in Österreich betrachtet, sowie präventive Ansätze gegen Gewalt gegen Frauen und die Forschung zu sozialen Mentoringprogrammen. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Erkundung von Geschwisterbildern und der Relevanz von Freundschaftsbeziehungen für Care Leaver*innen. Die Perspektiven von Herkunftsfamilien auf die Fremdunterbringung ihrer Kinder runden die Diskussion ab.