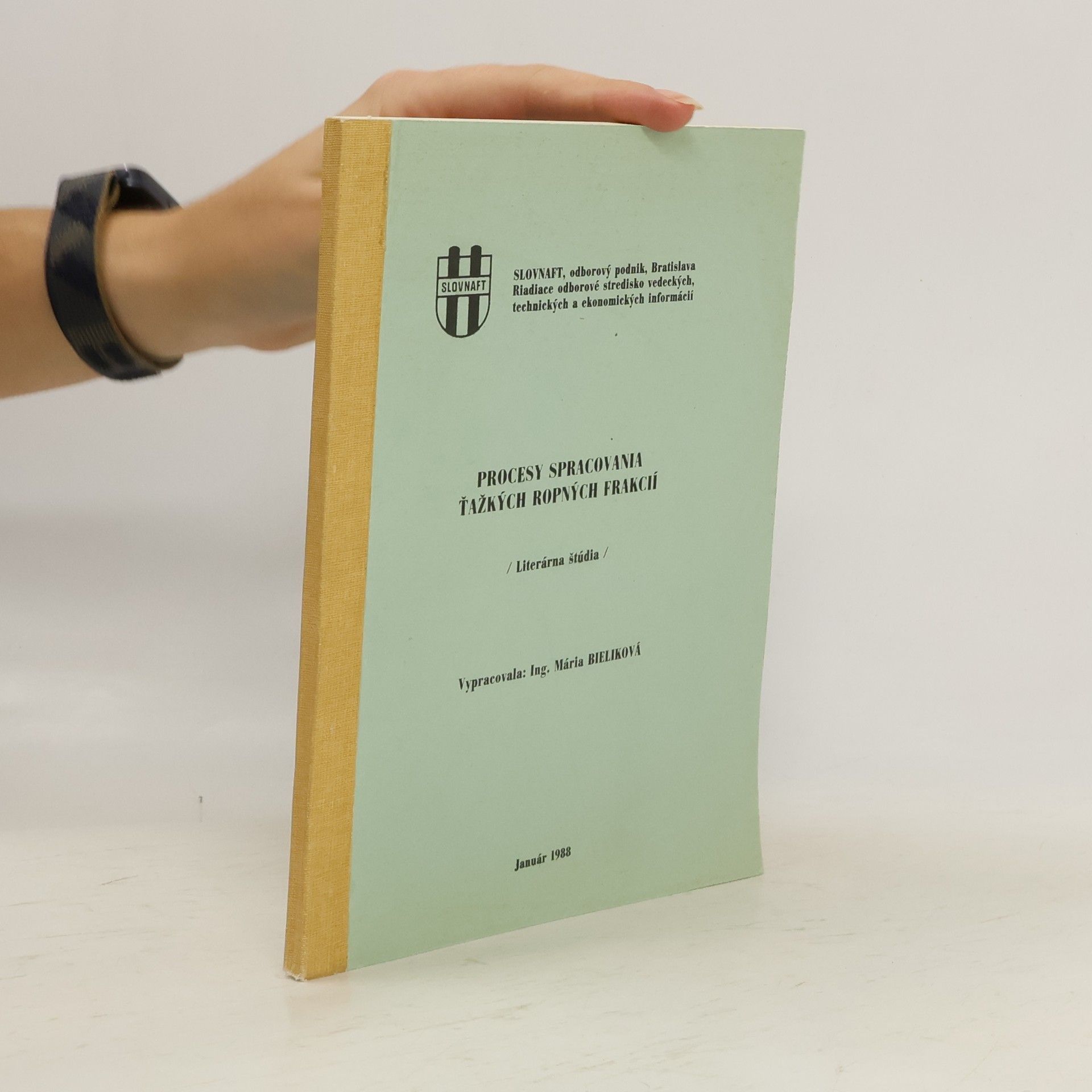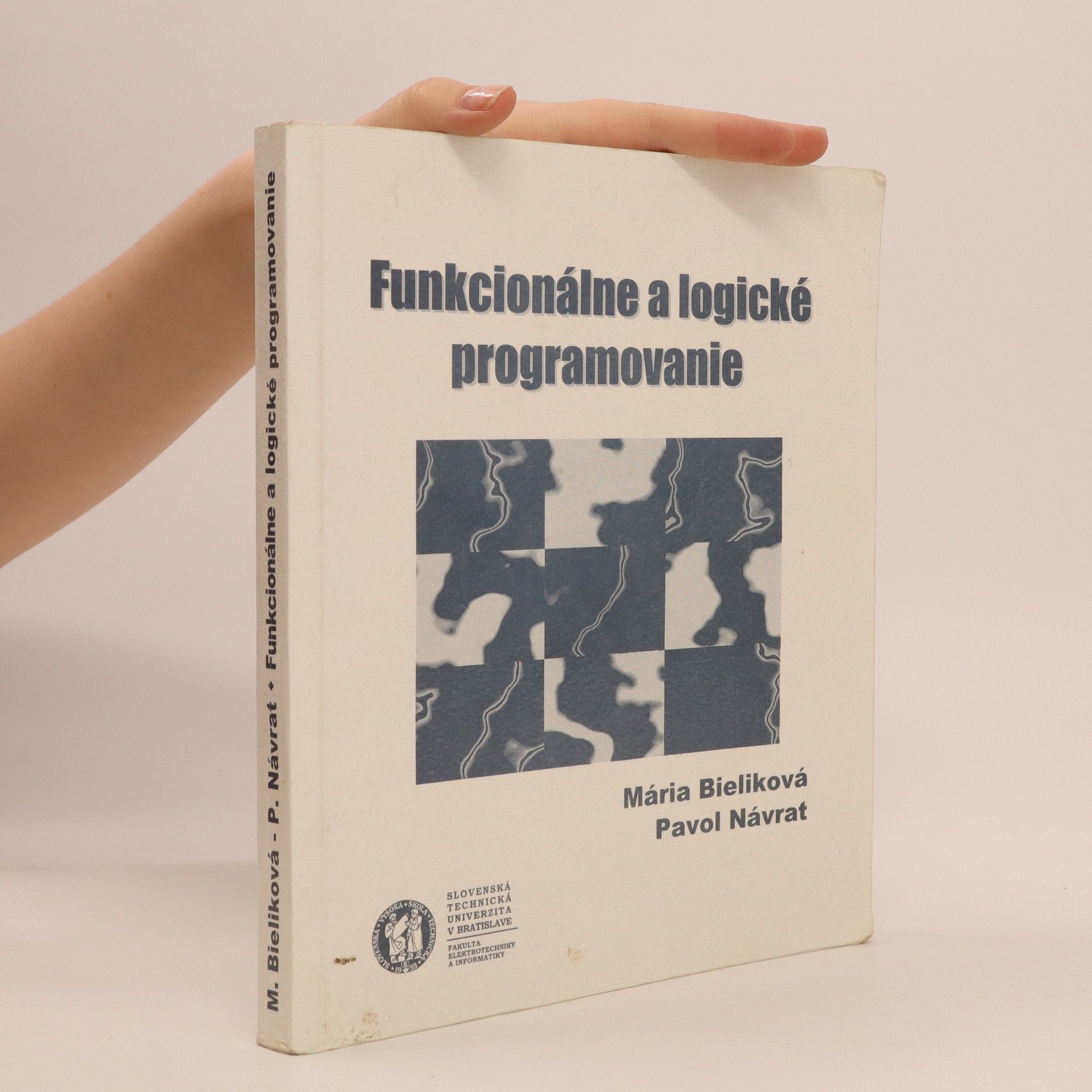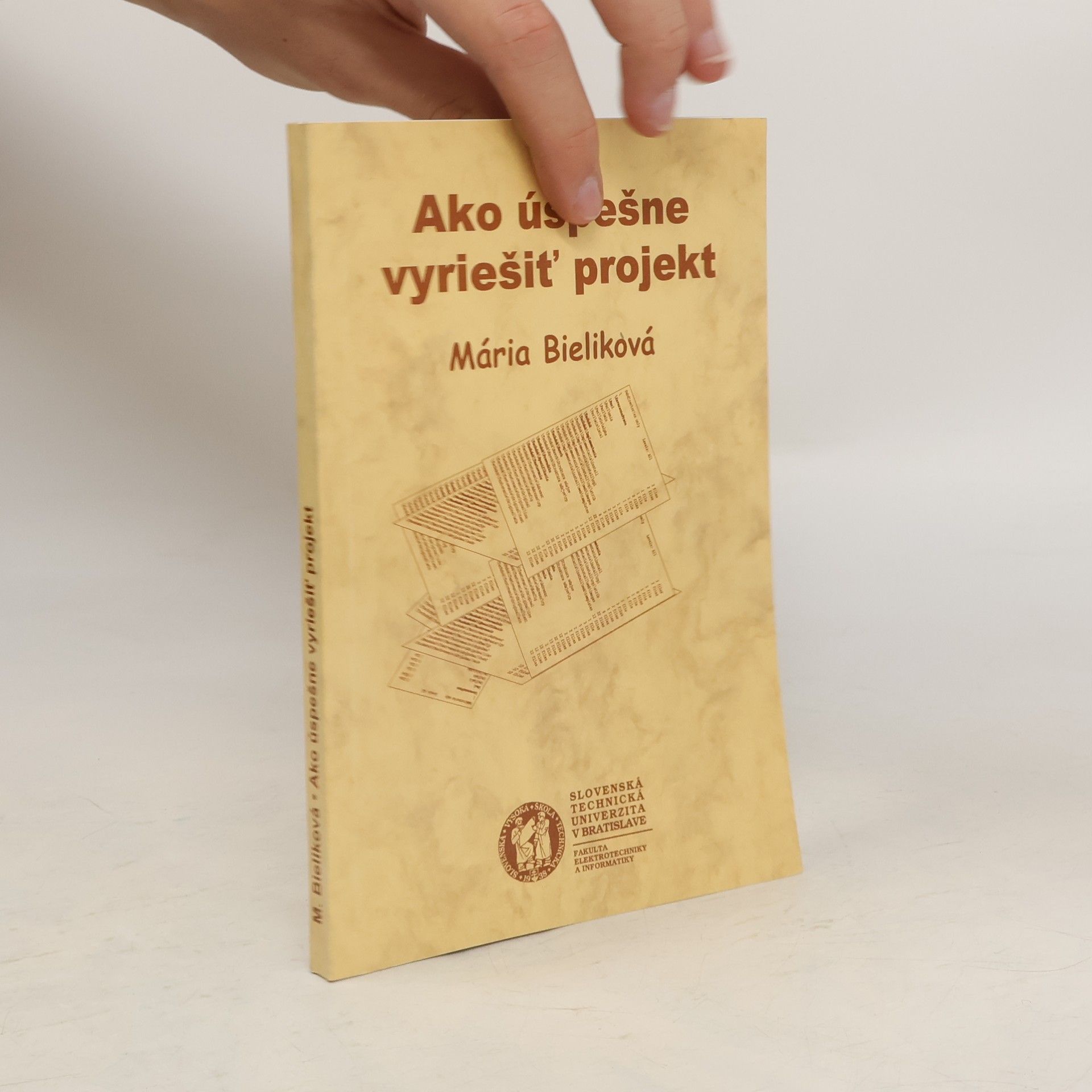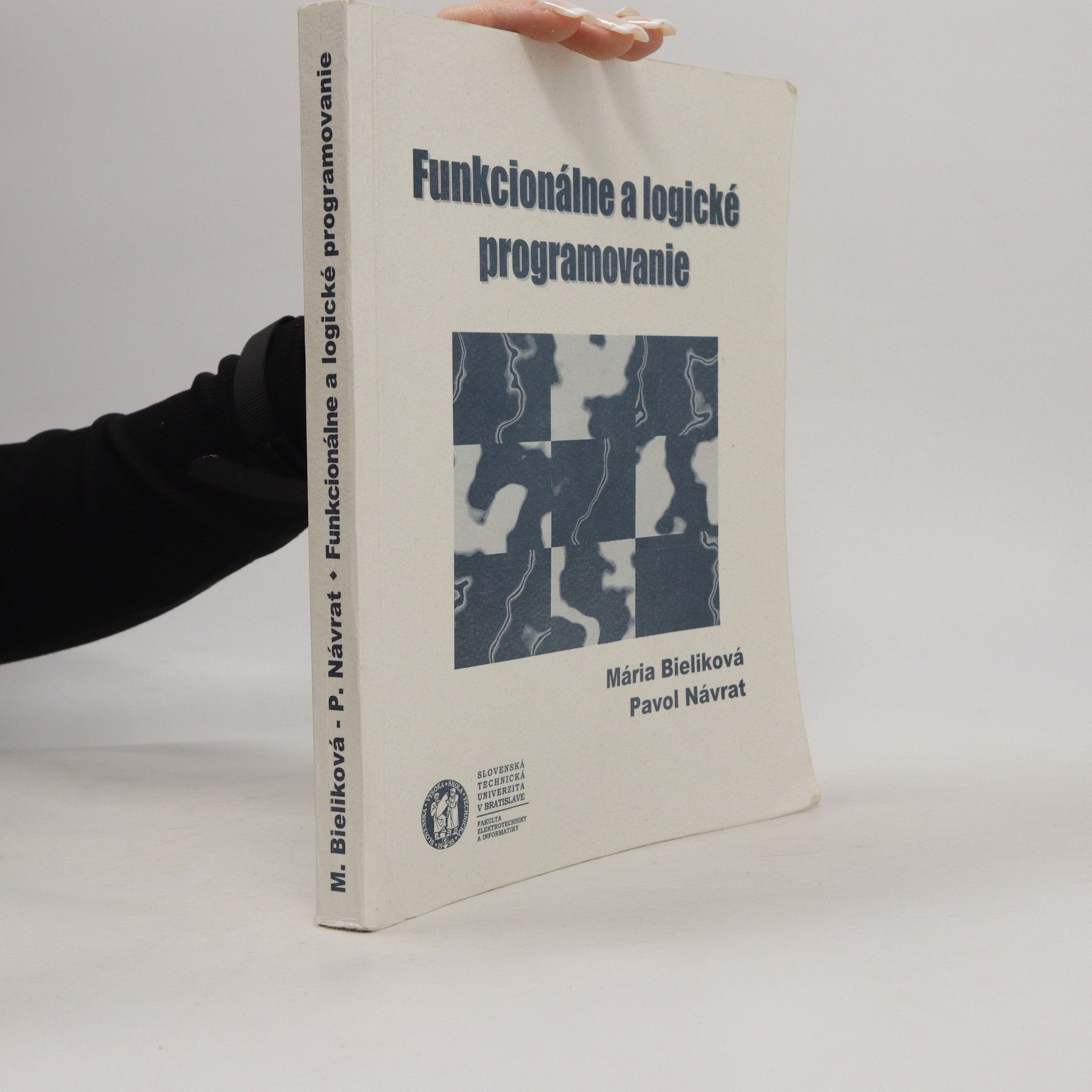Funkcionálne a logické programovanie
- 281 Seiten
- 10 Lesestunden
Učebnice, jak již název vypovídá, se zabývá oblastí funkcionálního a logického programování. Oběma tématům jě venován prakticky stejný prostor, kdy na vhodně zvolených reprezentantech programovacích jazyků je čtenář seznámen prakticky se všemi klíčovými momenty obou paradigmat. Dílo působí čtivým dojmem, i když se jedná o učebnici. (D. Kolář, ČVUT Brno o prvom vydaní, 2000) Autori patričně zohľaďnujú potreby konkrétnych kurzov pre poslucháčov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale som si istý, že učebnica svojím obsahom a spôsobom podania zaujme aj ovela širší okruh záujemcov z radov iných vysokých škôl, pravdepodobne aj českých, a aj širšiu verejnosť. (J. Kelemen, Ekonomická univerzita Bratislava o prvom vydaní, 2000) (Z obalu knihy)