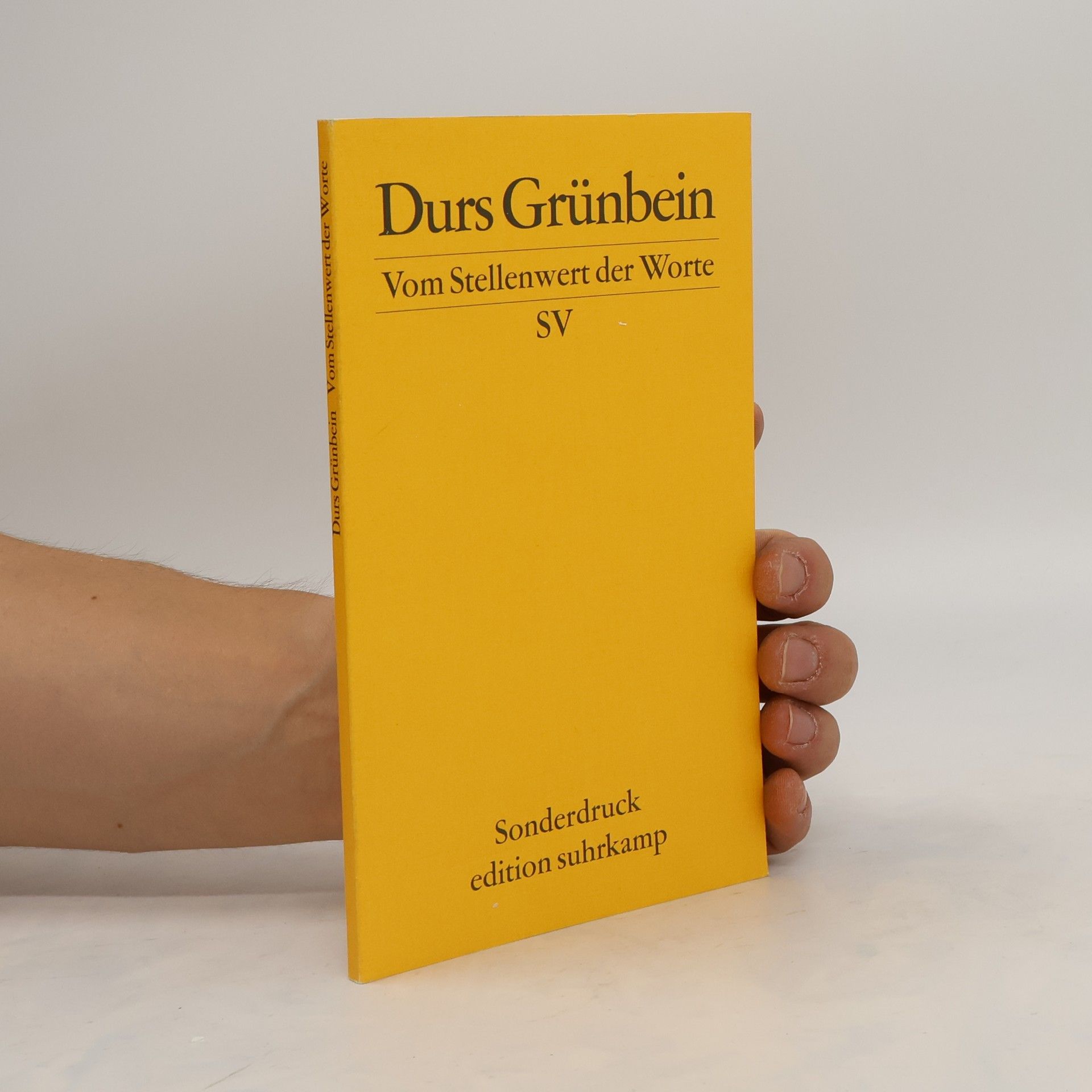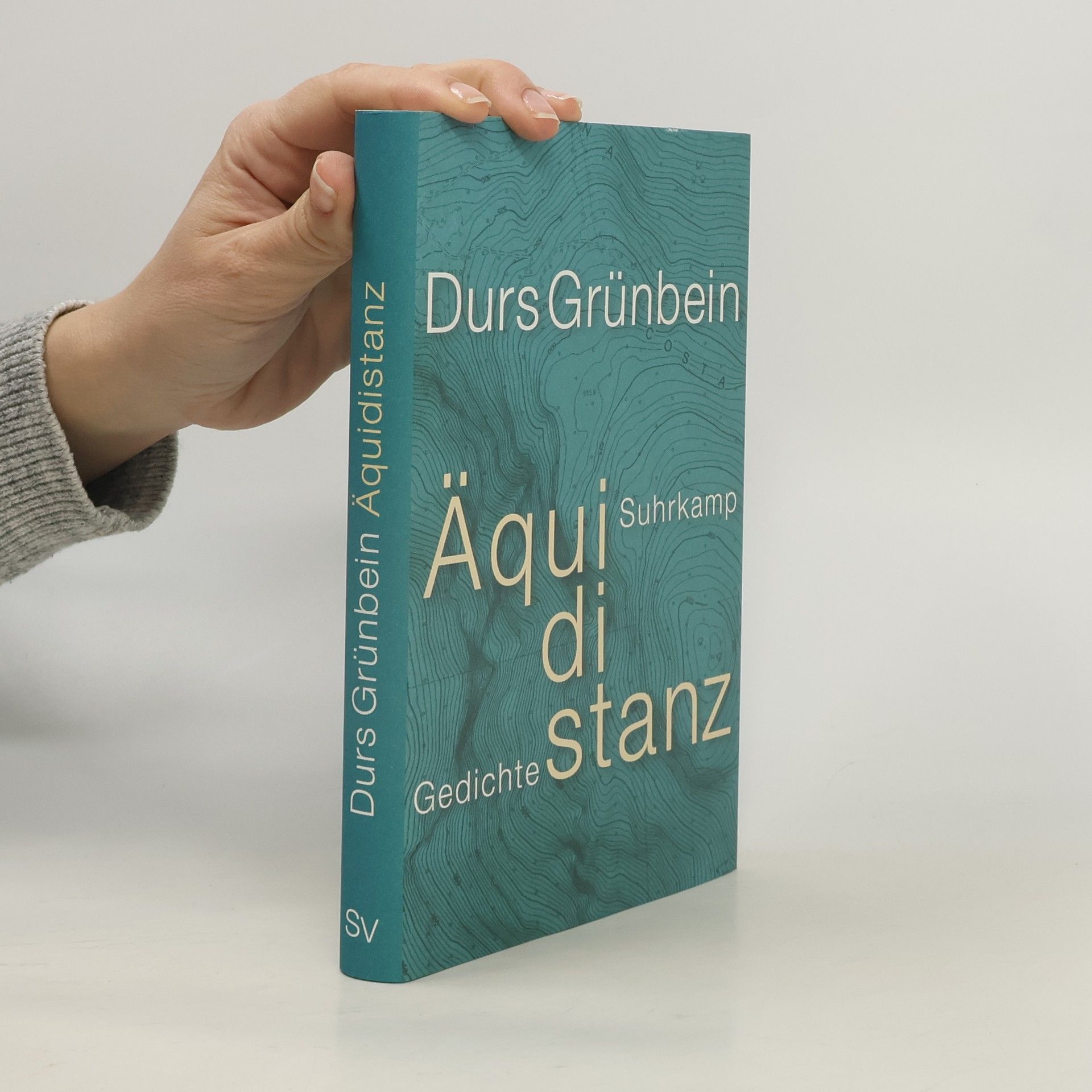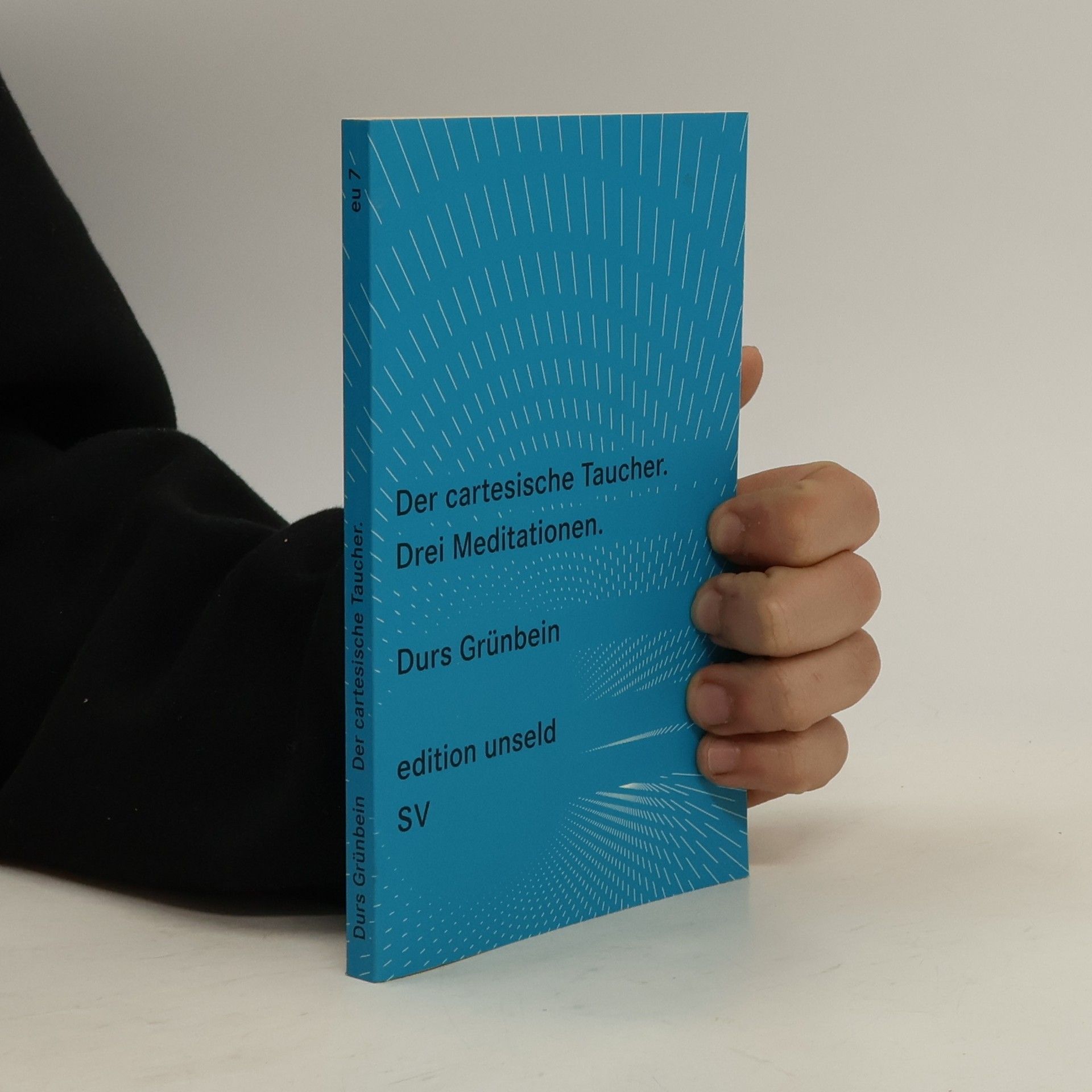"In welchem schneebedeckten Jahrhundert, mit Fingern / Steif / auf bereifte Scheiben gemalt, erschien dieser Plan / Zur Berechnung der Seelen?", schrieb Durs Grünbein vor Jahren in einem Gedicht mit dem Titel Meditation nach Descartes. Der Held und das Leitmotiv des Gedichts sind nun zurückgekehrt in Form einer langen Eloge auf den Philosophen. Mehrere Winter lang hat der Autor an einem Poem gearbeitet, das nun vollständig vorliegt mit 42 Cantos, die den Kapiteln eines Romans entsprechen. Vom Schnee umkreist jenen Moment im Leben des René Descartes, da dieser im Winter des Jahres 1619 in einem süddeutschen Städtchen, einer Vision gehorchend, zu philosophieren beginnt. Das Erzählgedicht endet in einem anderen Winter, 30 Jahre später, mit dem plötzlichen Tod des Philosophen. In fortlaufenden Szenen werden Jugend und Reife des großen Denkers an der Schwelle der Neuzeit ineinandergespiegelt nach der Regie eines Traums.Vom Schnee oder Descartes in Deutschland ist vieles. Ein Bilderrätsel; eine Unterhaltung in Versen, eine Hommage an die kälteste Jahreszeit und die Lehre von der Brechung des Lichts. Ein Bericht von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges und von der Geburt des Rationalismus aus dem Geist des Schnees.
Durs Grünbein Bücher
Durs Grünbein ist eine herausragende Stimme in der deutschen Lyrik und Essayistik, gefeiert für seine intellektuelle Tiefe und sprachliche Verspieltheit. Sein Werk thematisiert häufig Erinnerung, Geschichte und die Wandlungen der modernen Welt, wobei es eine einzigartige Mischung aus Gelehrsamkeit und Vorstellungskraft widerspiegelt. Über seine originären Beiträge hinaus bereichert Grünbein die literarische Landschaft durch seine aufschlussreichen Essays und Übersetzungen klassischer Werke und festigt damit seinen bedeutenden Einfluss auf die zeitgenössische Literatur.


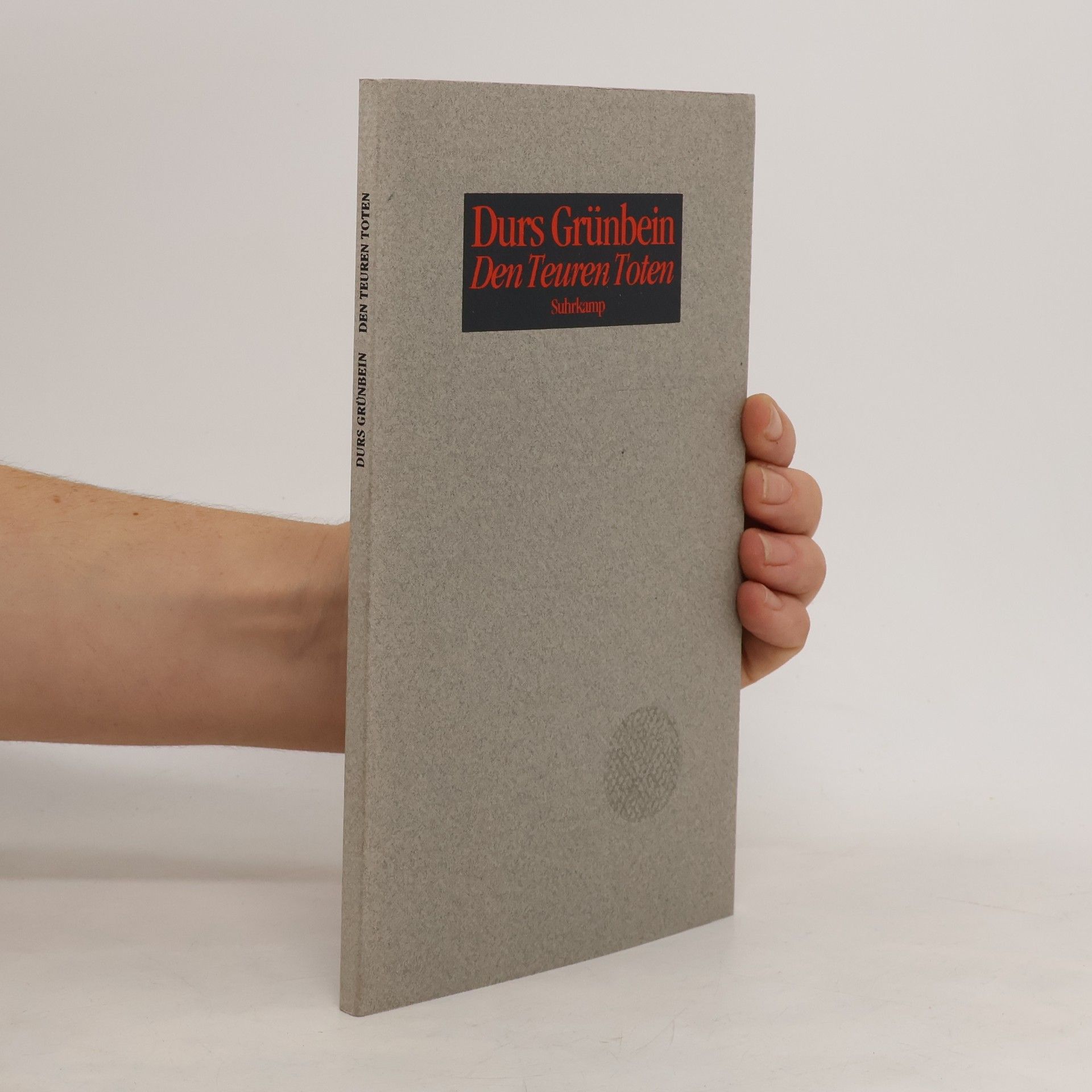
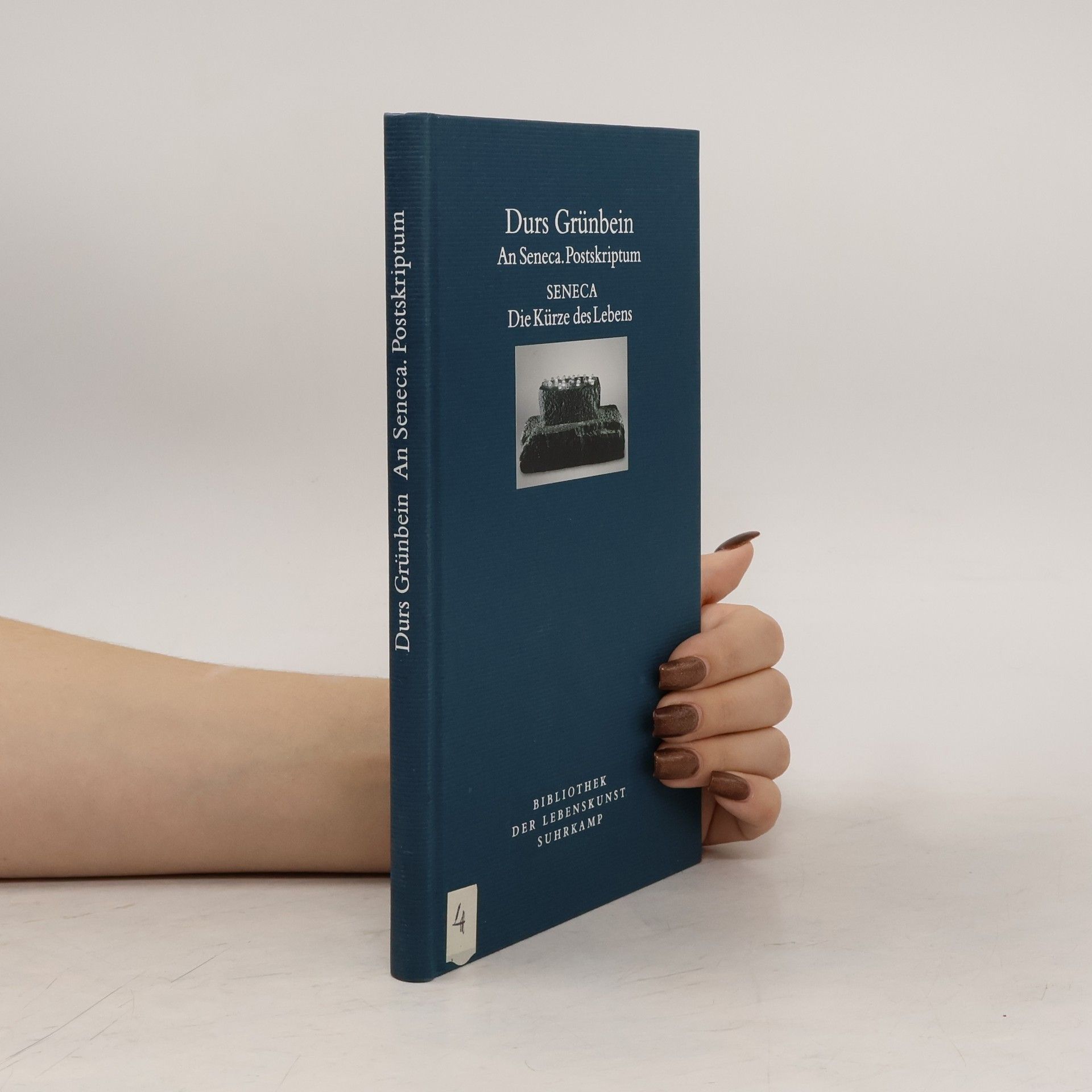


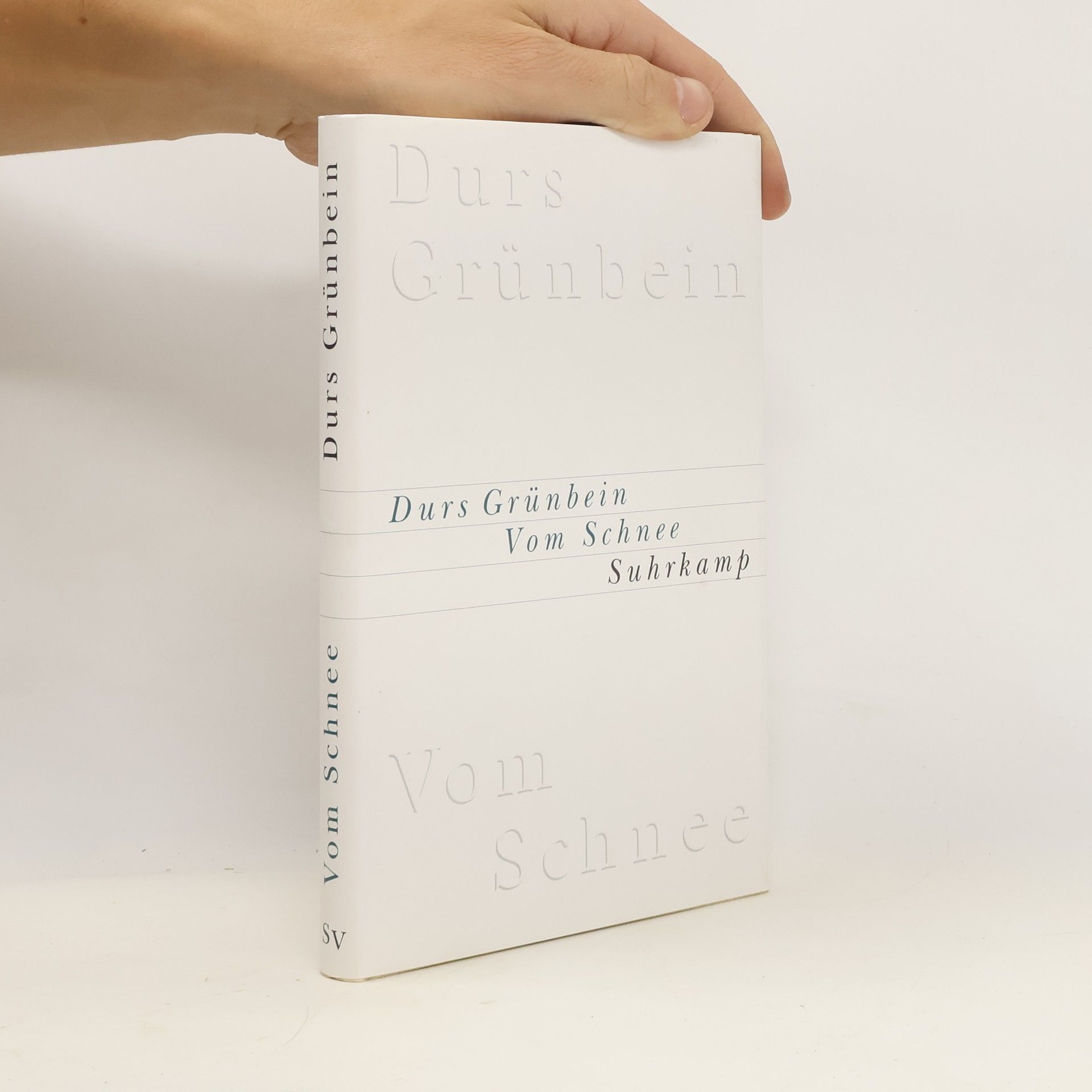
Der Begriff Metapher leitet sich ab vom griechischen metà phérein (anderswo hintragen), was in der Antike meist 'per Schiff' bedeutete, so daß die Seefahrt bald selbst zur Metapher für die Dichtkunst wurde. Das Schiff als Symbol für den Aufbruch, das Wagnis des Lebens, gehört seither zu den beflügelndsten Bildern der Literatur, Meeres- und Tiefseephantasien finden wir nicht nur bei Homer und Melville, sondern auch bei Jules Verne, Baudelaire, T. S. Eliot, ja sogar bei Dante. In 14 Essays spürt Durs Grünbein der Faszination des Meeres nach, nicht nur in Büchern, sondern auch im Museo Archeologico von Paestum und auf dem Grund des Tyrrhenischen Meers.
In seinen vier Vorlesungen, die er als Lord Weidenfeld Lectures im Jahr 2019 in Oxford gehalten hat, setzt sich der Dichter Durs Grünbein mit einem Thema auseinander, das ihn seit jenem Augenblick beschäftigt hat, als er die eigene Position in der Geschichte seiner Nation, seiner Sprachgemeinschaft und seiner Familie als historisch wahrzunehmen begann: Wie kann es sein, dass DIE GESCHICHTE, seit Hegel und Marx ein Fetisch der Geisteswissenschaften, die individuelle Vorstellungskraft bis in die privaten Nischen, bis in den Spieltrieb der Dichtung hinein bestimmt? Will nicht anstelle dessen Poesie die Welt mit eigenen, souveränen Augen betrachten?In Form einer Collage oder »Photosynthese«, in Text und Bild, lässt Grünbein den fundamentalen Gegensatz zwischen dichterischer Freiheit und nahezu übermächtiger Geschichtsgebundenheit exemplarisch aufscheinen: Von der scheinbaren Kleinigkeit einer Briefmarke mit dem Porträt Adolf Hitlers bewegt er sich über das Phänomen der »Straßen des Führers«, also der Autobahnen, hinein in die Hölle des Luftkriegs. Am Schluss aber steht eine erste Erfahrung von Ohnmacht im Schreiben und die daraus erwachsende, bis heute gültige Erkenntnis: »Es gibt etwas jenseits der Literatur, das alles Schreiben in Frage stellt. Und es gibt die Literatur, die Geschichte in Fiktionen durchkreuzt.«
»So ist's: Wir erhalten kein kurzes Leben, sondern haben es dazu gemacht, und es mangelt uns nicht an Zeit, sondern wir verschwenden sie.« Seneca, als Stoiker, widmet sich der Lebenspraxis und dem Streben nach einem gut geführten Leben, das von Vernunft geleitet ist und Affekten widersteht. Sein Ziel ist es, Seelenruhe zu erlangen. Auf die Frage, wie man leben sollte, antwortet er mit Aufforderungen wie »lebe jetzt«, »verschaff dir Muße« und »widme dich der Philosophie« – und nicht der Karriere oder Ablenkung. Sein eigenes Leben war jedoch von Ruhm, Verbannung und Rückzug geprägt. Durs Grünbein bringt den berühmten Text in einen neuen Kontext und beleuchtet die Widersprüche zwischen Senecas Philosophie und seinem Leben. Er fragt, warum ein erwachsener Römer seine Freizeit opfert, um über die Kürze des Lebens zu schreiben. In einem bewegten Brief an Seneca reflektiert Grünbein: »Du hattest recht. Das kurze Leben raunt uns zu: halt an, / Eh die Affekte dich versklaven.« Doch er stellt auch die Frage, was passiert, wenn wir unbelehrbar sind und in uns bei jedem Ja ein Nein regt. Lucius Annaeus Seneca, geboren um 4 v. Chr. in Córdoba, war ein bedeutender philosophischer Schriftsteller und Dichter, der 65 n. Chr. in Rom starb.
Bleib stehen, Wanderer, und lies!, riefen vor zweitausend Jahren die Grabsteine. Inschriften berichteten von den Vergnügungen der Verstorbenen, ihrem Beruf, Charakter und ihrer Familie. Die Persönlichkeit lebte in gebundener Rede weiter. Heute jedoch bleiben die Eiligen oft bei ein paar Ziffern und einem namenlosen, beziehungslosen Grabstein. Es gibt kein Zwiegespräch mehr zwischen Diesseits und Jenseits, keine Totengeister, die beruhigt werden müssen. Das, was geblieben ist, präsentiert sich in vergesslichen Formeln. In diesen Breiten haben die Toten lange nicht mehr gesprochen. Die Kulturgeschichte kennt Zeiten des Gedenkens und Zeiten der Sprachlosigkeit. In Kulturen, in denen der Tod zum Tabu geworden ist, wird nur indirekt über das Ende gesprochen. Wie der Witz nach Freud seine Beziehung zum Unbewussten hat, offenbart das Geschwätz um den Tod eine anthropologische Enttäuschung. Alles im Griff zu haben, nur das nicht, ist kränkend für das einzige Lebewesen, das sich mit seiner Sterblichkeit nicht abfinden kann. Durs Grünbein, bekannt durch seine Gedichtbände, zieht sich in den Halbdunkel ungewisser Autorschaft zurück. Von dort tritt er als Philologe, Herausgeber und Kompilator seiner Notizbücher hervor. Die 33 Epitaphe singen das Lob der Entfremdung und zeigen, wie lächerlich das Leben in seiner vergeblichen Wiederkehr erscheint. Wo gestorben wird, ohne den Toten Gehör zu schenken, hat schwarzer Humor seinen Augenblick.
Nach den Satiren
Gedichte
Durs Grünbein präsentiert nach fünf Jahren einen neuen Gedichtband, der eine Bilanz seiner Arbeit vor dem Jahr 2000 zieht. Seine Texte zeigen enzyklopädische Neugier und erkunden poetisches Terrain von der Antike bis zur Gegenwart, von Dresden bis zu den Planeten. Seine präzise Wahrnehmung wird oft als "Kälte" missverstanden.
Von der Feststellung ausgehend, daß eine normenbildende, maßstabsetzende Poetik nicht mehr existiere, zeichnet Grünbein seinen dichterischen Werdegang als »Skizze zu einer persönlichen Psychopoetik«. Es geht dabei um die Idee vom genauen Wort, das seine maximale Aufladung erst als Resultante der Lebenssituation, seiner Stellung im kompositorischen Ganzen des Gedichts sowie im Gesamtsystem aller Arbeiten eines Autors erfährt. Unter dem Leitwort »Poesie ist Subjektmagie als Sprachereignis« bietet der Dichter am Ende seiner Vorlesung zehn Thesen auf dem gegenwärtigen Stand einer voraussichtlich unabschließbaren Sinnfindung: nicht als Poetik und nicht als Manifest, nicht als Theorie oder Methode, sondern als eigensinnigen Modus operandi des Dichtens in nachmagischer Zeit.
Durch Geschichte und Gegenwart verfolgt Durs Grünbein in diesem neuen, seinem zwölften Gedichtband seinen Kurs des Poetisch-historischen Gedichts. Als Spurensicherung, Ortsbestimmung versteht der Dichter seine Streifzüge durch Zeiten und Räume, in denen er nicht nur Deutschland, sondern auch dem Gegenpol vieler Deutscher, Italien, und in beiden Ländern sich selbst begegnet. Immer, hier wie dort, kreuzt Vergangenheit den Weg des Wanderers. Durch Mörderreviere führen seine Verse ebenso wie über Lichtungen, zu Tauchgängen im Mittelmeer wie auf gesamtdeutsche Sandpfade und betonierte Magistralen, zwischen Kiesgruben und Flakbunkern, entlang der Ost-West-Achse des unruhigen, wieder mit Kriegen konfrontierten Kontinents. Dass bei solchen Eindrücken der europäische Gedanke ins Spiel kommt – als Realität und Utopie –, wird niemanden wundern, der Grünbein auf seinen Wegen gefolgt ist. »Für alle Fälle kann Dichtung auch das sein: ein Gerät zum Einfangen der Zukunft.« In seinen Versen verbindet sich die genaue Betrachtung kleiner Dinge mit der feinen Ironie eines Beobachters, dem gerade das unter den großen Themen oft Verschüttete am Herzen liegt. Mit wenigen Strichen ein Gedicht zu zeichnen, ist seine mit den Jahren gereifte Kunst.
Cyrano oder die Rückkehr vom Mond
- 150 Seiten
- 6 Lesestunden
Was ist da los? Die Amerikaner verlassen den Mond, überlassen Nachzüglern den scheintoten Begleiter der Erde. Zeit zum Rekapitulieren: An einem Sonntagnachmittag in Berlin, auf dem Flugfeld des stillgelegten Aeroports Tempelhof, macht der Dichter Durs Grünbein eine folgenreiche Beobachtung. Was, wenn die Menschheit immer nur zurückkehren wollte von ihren Abenteuern der Raumerkundung? Gestern der Mond, morgen der Mars und übermorgen…? Da begegnet ihm Cyrano de Bergerac, der spöttische Reisende durch die Planetenreiche der Imagination, ein Zeitgenosse des René Descartes. Er ruft ihm über die Jahrhunderte hinweg zu: Es gibt nur eine Sensation – die der Heimkehr, alles andere sind Phantastereien! Und plötzlich öffnen sich alle Schleusen in Raum und Zeit, die Feier des Hierseins beginnt. Dort draußen die Unwirtlichkeit und die Krater (benannt nach den Helden der Wissenschaftsgeschichte, den Pionieren der Raumfahrt) – und hier unten die fragilen Elegien einer Spezies, die allmählich begreift, dass sie mutterseelenallein ist im All. Durs Grünbein hat einen neuen Gedichtzyklus geschrieben, der von der Sehnsucht ausgeht, von den verlorenen Erkenntnismühen einer im Kern romantisch gebliebenen Aufklärungskultur, die nichts anderes will, als zurückfinden zu sich, den Mond betrachten, als sei er immer noch da.
Der cartesische Taucher
- 143 Seiten
- 6 Lesestunden
Hinter dem großangelegten Werk „Le Monde“ verbirgt sich das ehrgeizigste Projekt des Philosophen René Descartes, das sämtliche Wissensfäden zusammenführen und ein dichtes Gewebe schaffen sollte, um alles unter der Sonne zu erklären. Der Dichter Durs Grünbein wird von der Traumhaftigkeit dieses Projekts angezogen, nicht von der nüchternen Rationalität. Er fasziniert das Phantastische hinter den abstrakten Begriffen und der spekulative Höhenflug, den Descartes über seine naturwissenschaftlichen Hypothesen wagt. Die Spur des Experimentators durch die Mysterien und das Bildermachen jenseits aller Methode sind zentrale Themen. Grünbein fragt, wie viel Mensch in Descartes' reinem Erkenntnis-Ich steckt und wie viel Anschauung in strenger Vivisektion verloren geht. Ist der Geist nicht dennoch das bewegende Prinzip des Universums? Wenn Dante der Descartes der Metapher war, könnte man dann nicht sagen, dass Descartes der Dante der neuzeitlichen Wissenschaft ist? Mit seinem Vers-Roman über Descartes hat Grünbein bereits eine poetische Version des Themas geschaffen. Nun präsentiert er einen erzählerisch angelegten Essay in drei Meditationen als Verteidigungsschrift für einen der meistgehassten Philosophen, der gleichzeitig den Ursprung des modernen poetischen Ichs am Gegenpol des heliozentrischen Weltbildes findet.