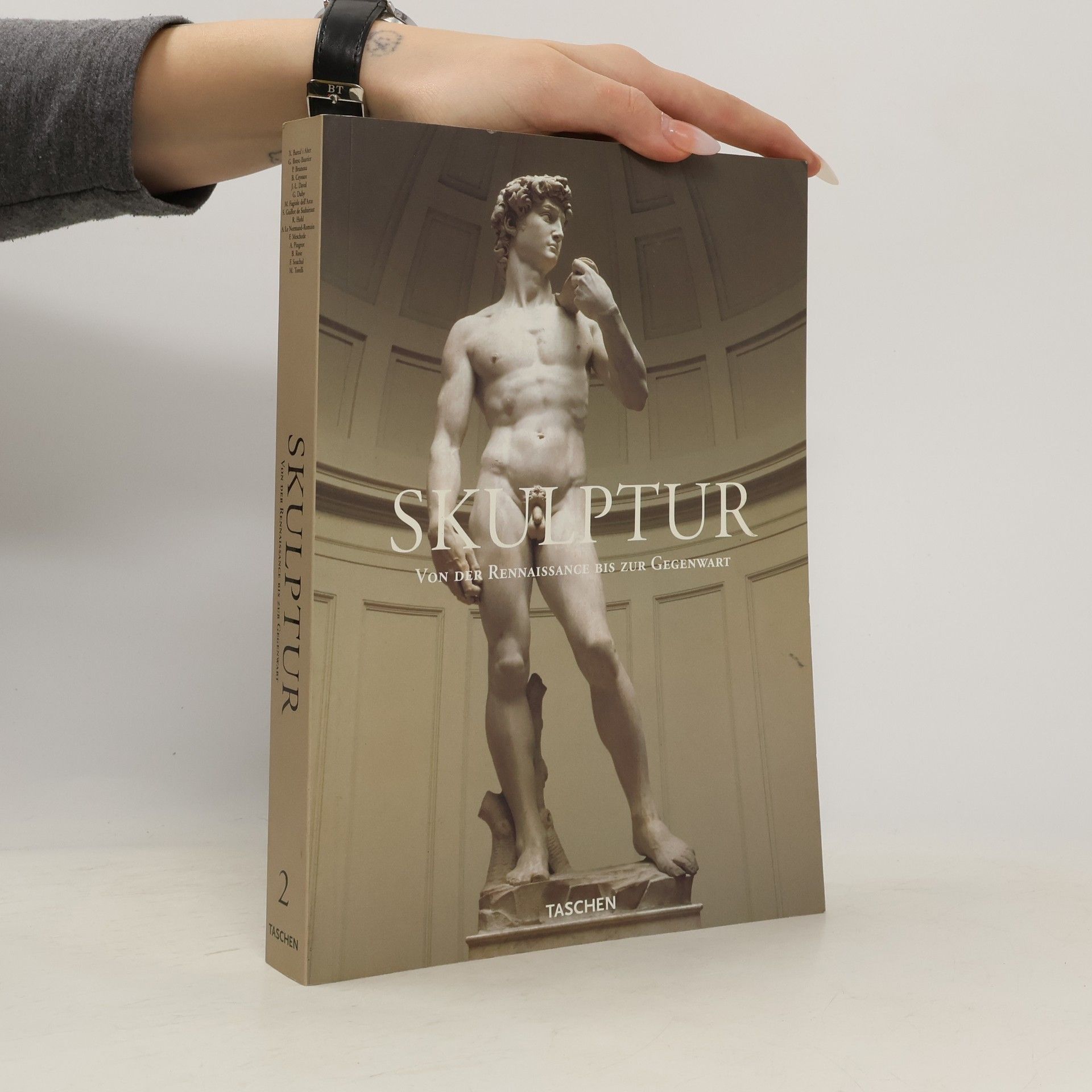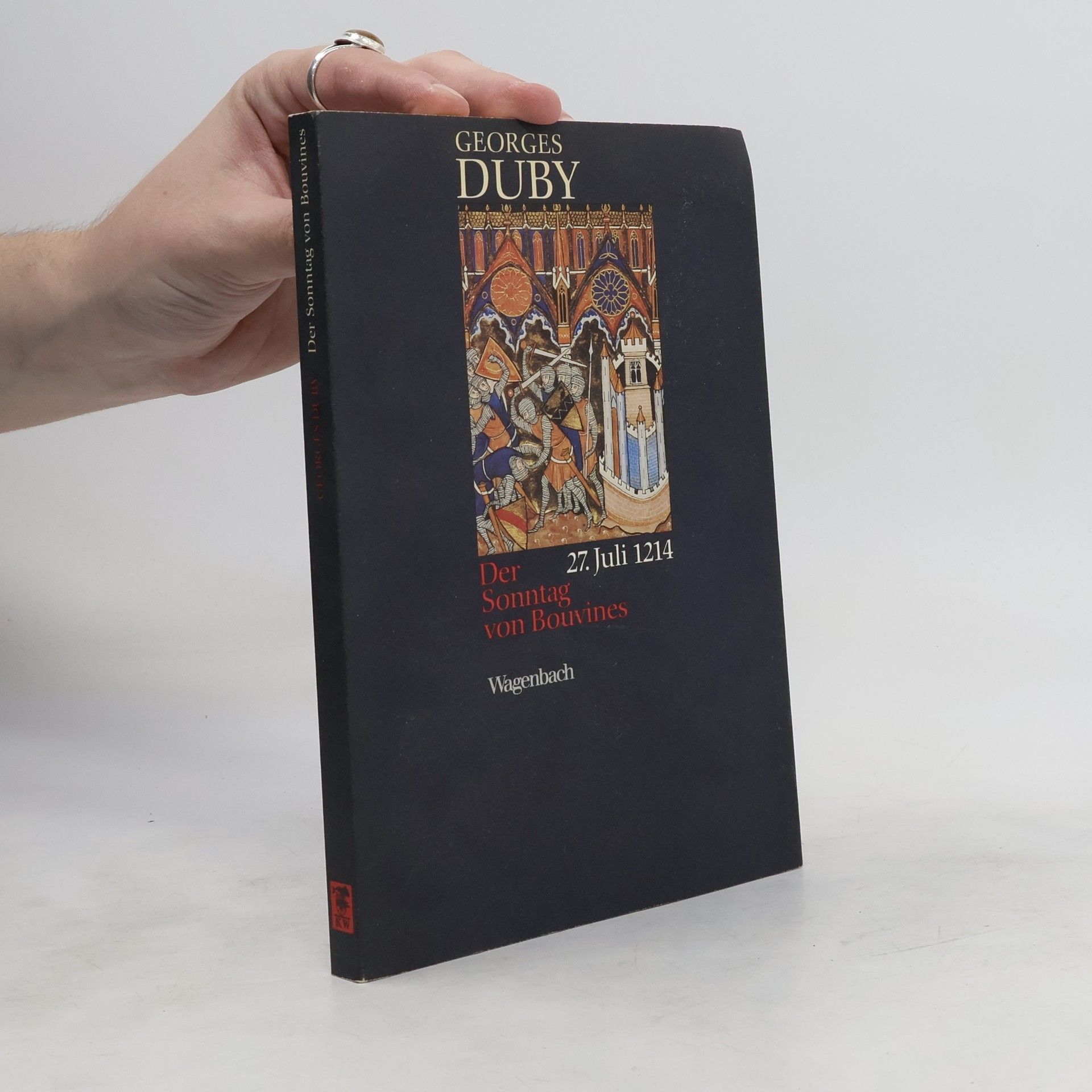Frankfurt 1988, kartonierter Originaleinband, 351 Seiten, Kl.-8°, gutes Exemplar mit leicht gebräuntem Schnitt,
Georges Duby Bücher

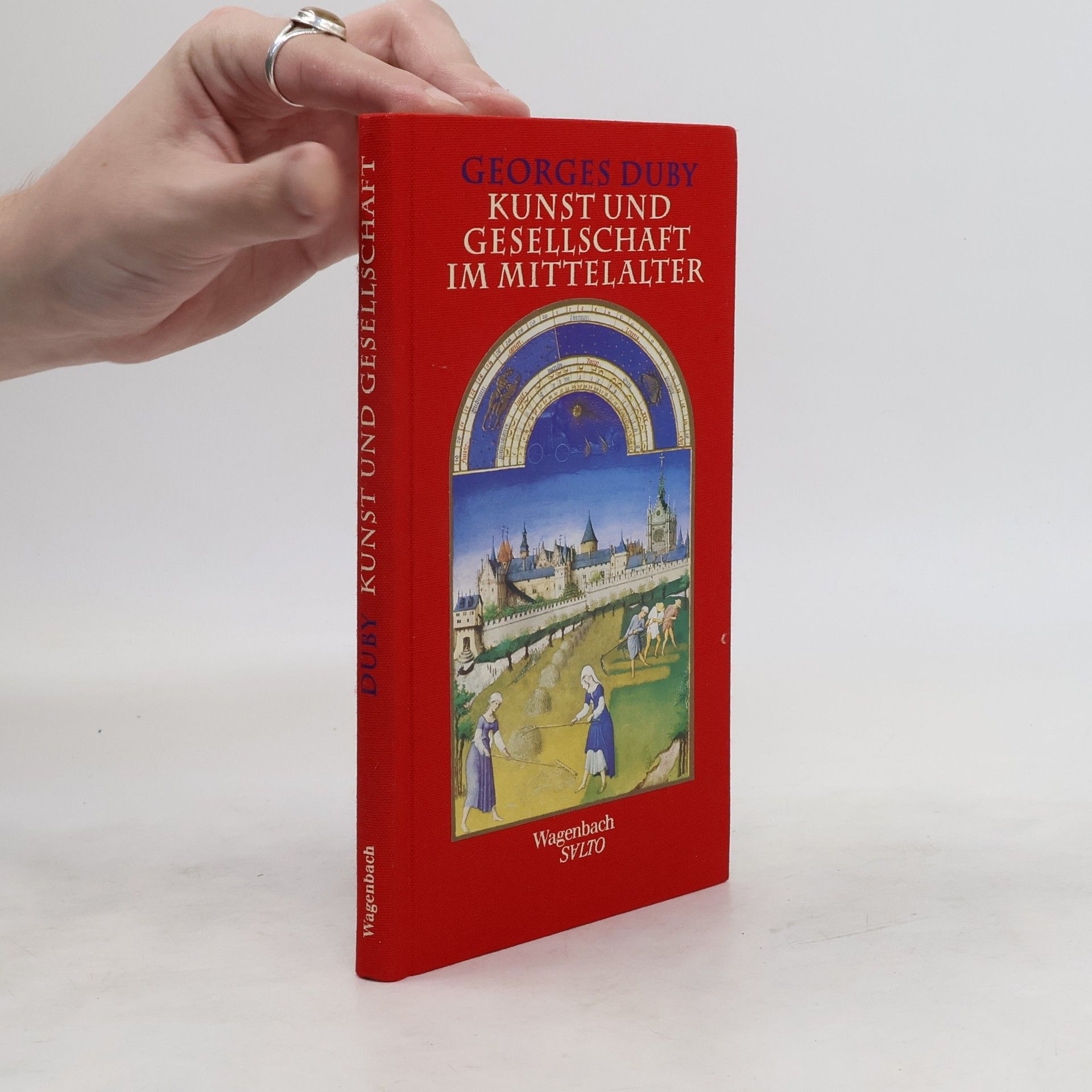
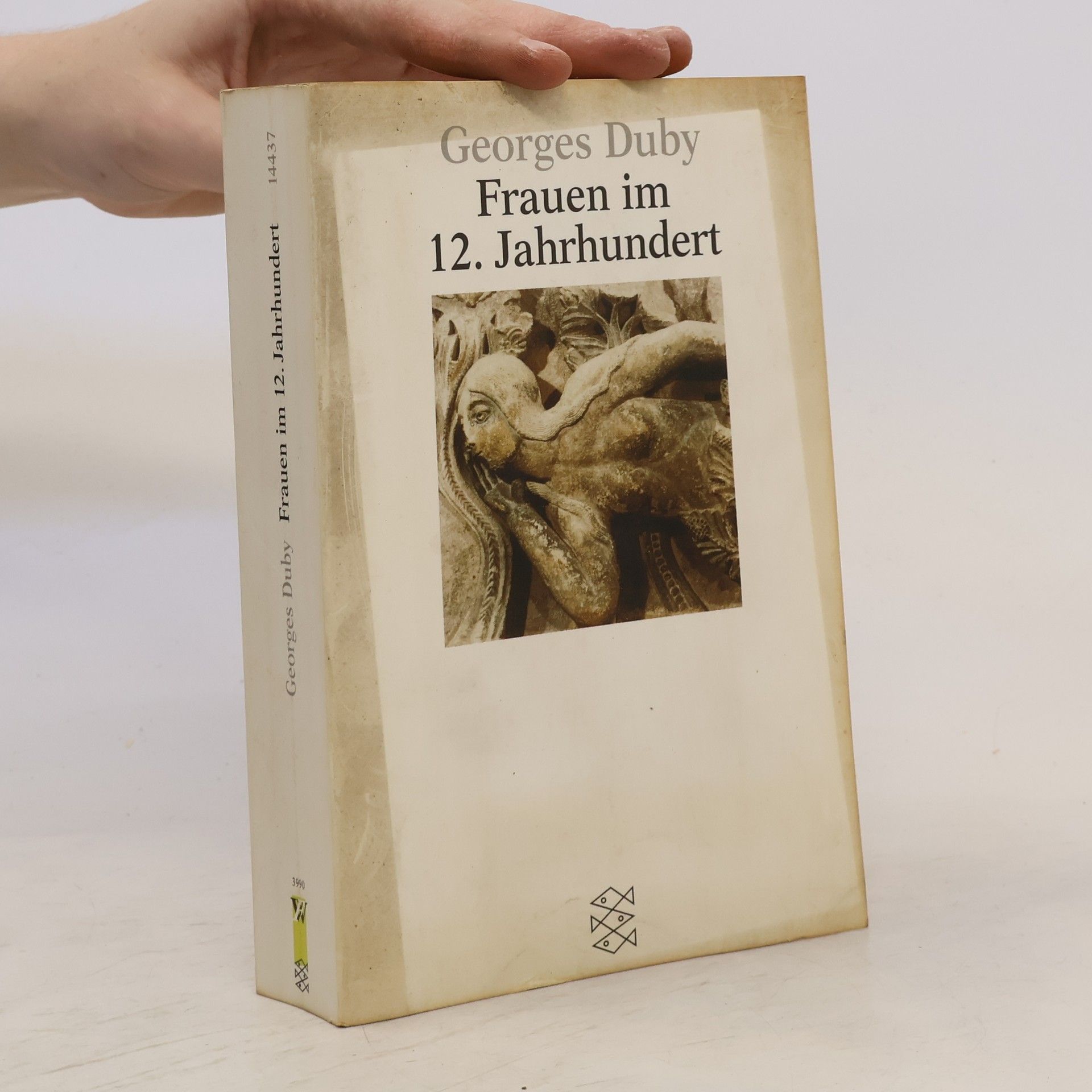

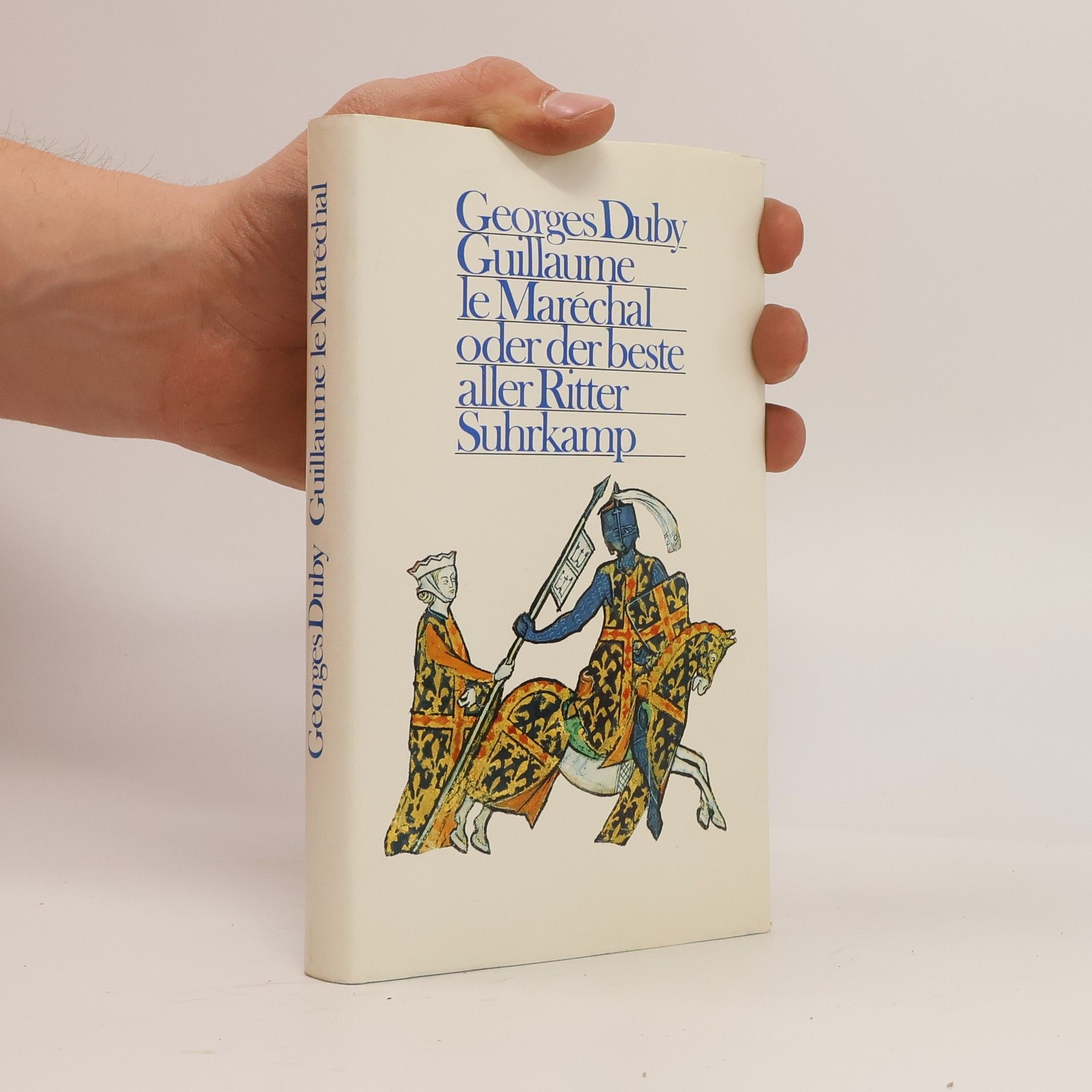
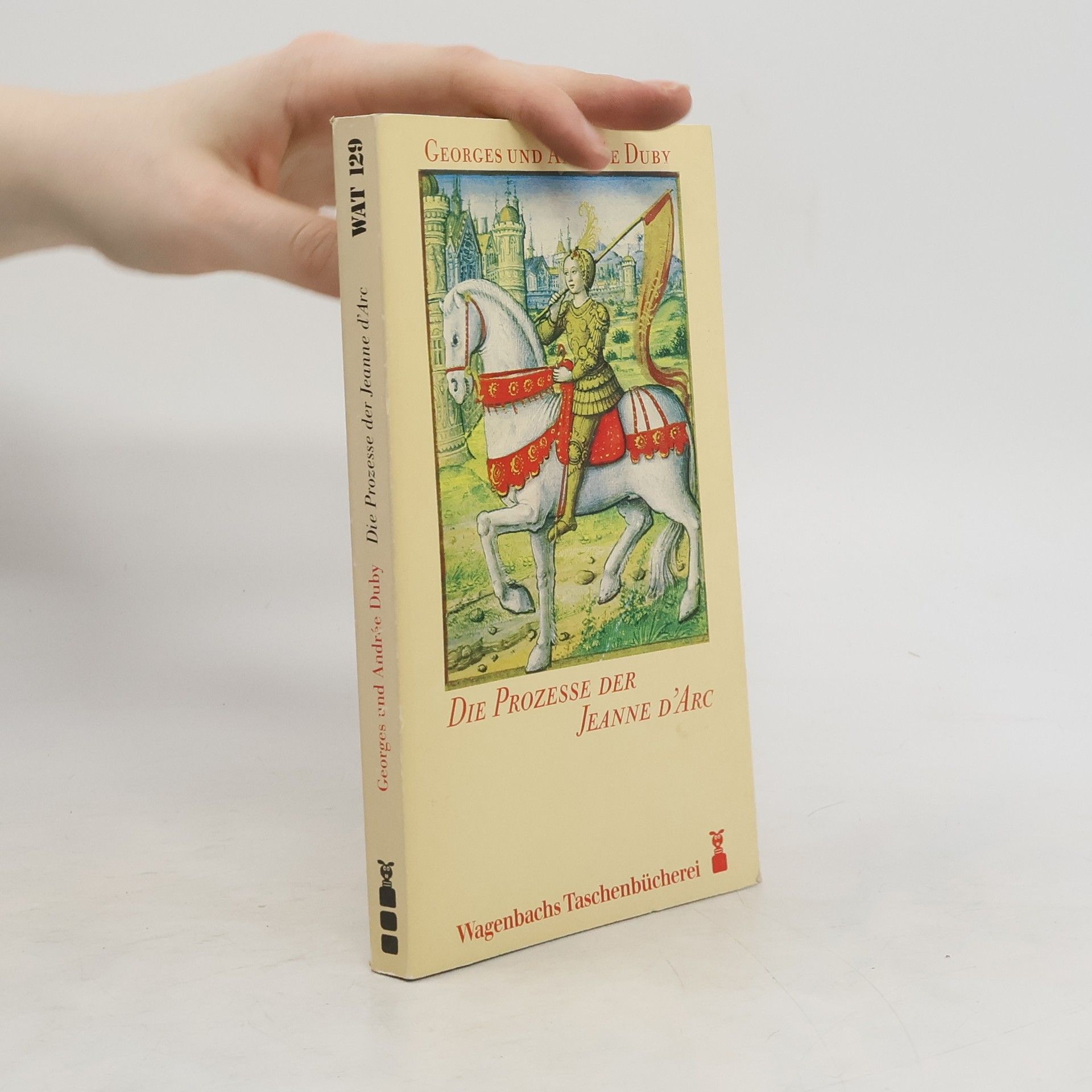

Die Provokation der etablierten Mächte durch eine junge Frau, Johanna von Orléans: Zwei große französische Historiker untersuchen anhand der Akten die nationale Legende Frankreichs
Er nannte sich Guillaume le Maréchal, nicht William Marshal. Dennoch war er Engländer normannischer Abstammung und galt als »der beste aller Ritter«. Seine Karriere führte ihn vom mittellosen Sohn eines armen Ritters zum mächtigen Regent von England und zu einem der reichsten Barone der Feudalzeit, begütert in England, Frankreich und Irland. Im Jahr 1219 starb der Graf einen prunkvollen Tod und bot der Welt das Schauspiel eines Fürstentodes, einen formvollendeten Abschied. Bisher war Guillaume höchstens Fachhistorikern bekannt, doch jetzt hat er das Potenzial, zum Publikumsliebling zu avancieren. Das Besondere an diesem »Musterbeispiel erzählender Geschichtsschreibung« ist, dass sich Duby auf ein dichterisches Werk stützen kann: ein umfangreiches altfranzösisches Versgedicht, das Guillaumes ältester Sohn in Auftrag gab, um seinen bedeutenden Vater zu ehren. Dieses Gedicht liefert ein wichtiges Zeugnis über die Verhältnisse und das Denken im Mittelalter. »Dieses Buch zu lesen ist ein Vergnügen von der ersten bis zur letzten Seite. Der Leser erlebt, wie die Szene aus dem Rahmen tritt und lebendig wird. Besonders eindrucksvoll ist die Beschreibung des zeremoniellen, wochenlangen Sterbens dieses ›besten aller Ritter‹, die einen nicht mehr loslässt.«
Über die Frauen im 12. Jahrhundert verraten die überlieferten Zeugnisse nur wenig. Dem berühmten französischen Mediävisten Georges Duby gelingt es, das Dunkel der Geschichte, das sie umgibt, zu lichten und in der Form großer erzählender Geschichtsschreibung ein anschauliches Bild ihrer Stellung in der Wert- und Weltordnung des Hochmittelalters zu geben.
Kunst und Gesellschaft im Mittelalter
- 133 Seiten
- 5 Lesestunden
Ein reichbebildeter Überblick über das Jahrtausend zwischen dem Untergang Roms und der Renaissance. Dieses letzte Werk des berühmten französischen Mediävisten beschreibt, wie in dem Jahrtausend zwischen dem Untergang des Römischen Reichs und dem Beginn der Renaissance sich eine Gesellschaft bildet, die sich mehr und mehr als eine europäische versteht. Und er beschreibt, wie in dieser Gesellschaft eine neue Kunst entsteht – von der Buchmalerei über die ersten Reliquiare und Glasfenster, Skulpturen und Pilgerhallen bis zu den großen Klosterbauten und schließlich den Kathedralen. Lesen Sie weiter … Der Sonntag von Bouvines Der Tag, an dem Frankreich entstand Der Sonntag von Bouvines
Die Spanne dieses Buchs reicht von der antiken bis zur zeitgenössischen Skulptur; es ist damit die erste Studie über die Geschichte der Skulptur, die einen derart umfassenden Überblick gewährt. Die Skulpturen werden aus dem musealen Kontext gelöst (und damit sprichwörtlich vom Sockel geholt), und Sculpture eröffnet einen völlig neuen Blick, der Vergleiche zwischen Äras und Genres möglich macht. Dieses beachtliche Werk ist ein Muss für Kunstliebhaber aller Stilrichtungen und Disziplinen.
Die exemplarische Untersuchung einer historischen Schlacht: von der Wahrnehmung der Zeitgenossen bis zum heutigen deutsch-französischen Verhältnis. Die Schlacht bei Bouvines am 27. Juli 1214 zwischen dem Heer von König Philipp II. und den unter dem exkommunizierten Gegenkönig Otto IV. von Braunschweig versammelten Truppen wurde zum nationalen französischen Mythos. Der Sieg der Franzosen beendete einen europäischen Krieg und festigte die von Frankreich errungene Position. Zugleich wurde der deutsche Thronstreit zugunsten Friedrichs II. entschieden. Dubys Interesse gilt nicht dem historischen Ereignis als einer machtpolitischen Entscheidung, sondern dem Fortleben von Geschichte im Bewusstsein der Menschen und ihrem Einfluss auch auf die aktuelle politische Wahrnehmung, in diesem Fall: auf das Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen.
»Privates Leben ist keine Naturtatsache; es ist geschichtliche Wirklichkeit, die von den einzelnen Gesellschaften in unterschiedlicher Weise konstruiert wird. Es gibt nicht das private Leben mit ein für allemal festgelegten Schranken nach außen; was es gibt, ist die - selber veränderliche - Zuschreibung menschlichen Handelns zur privaten oder zur öffentlichen Sphäre. ... Die Geschichte des privaten Lebens beginnt mit der Geschichte seiner Markierungen.« Antoine Prost »Diese große, eindrucksvolle Unternehmung wird man einmal zu den fortdauernden Werken der Historiographie in unserer Zeit zählen.« "Times Literary Supplement"