This publication focuses on making historical works accessible through large print, catering specifically to individuals with impaired vision. Megali, the publishing house behind this initiative, prioritizes the reproduction of original texts, ensuring that important historical literature remains available to a wider audience.
George Berkeley Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)




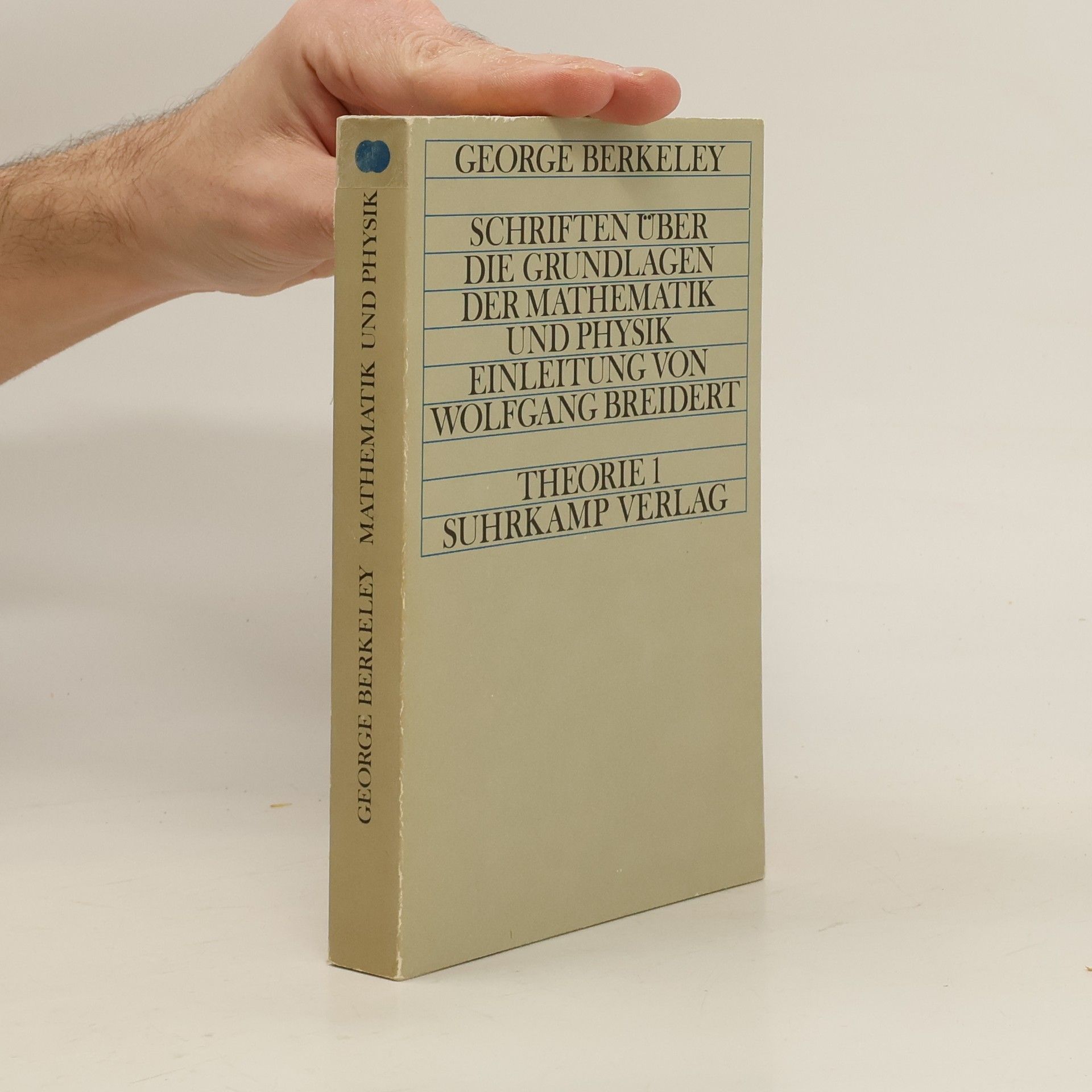
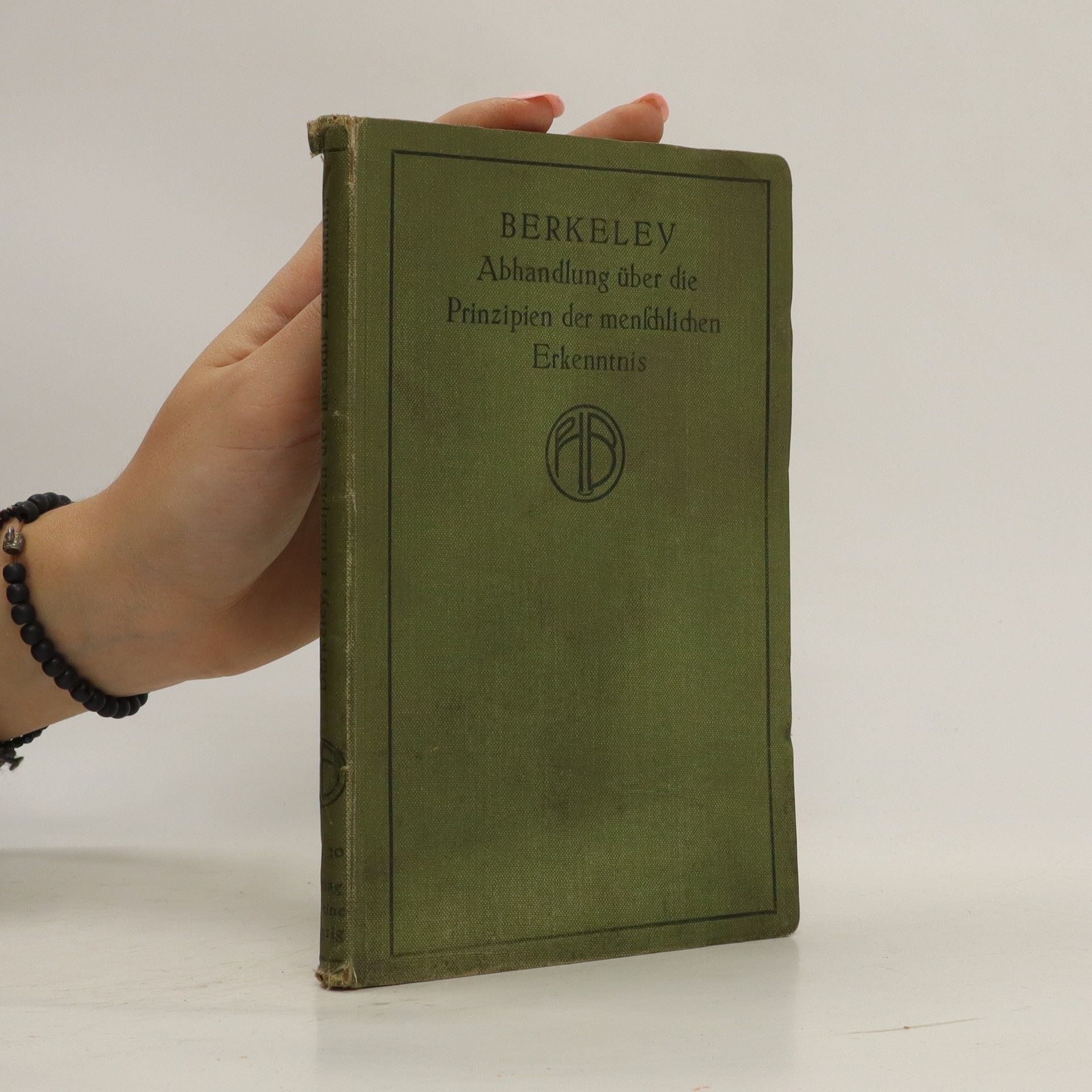

The Querist; Containing Several Queries Proposed to the Consideration of the Public
in large print
- 144 Seiten
- 6 Lesestunden
The book is a reproduction of a historical work, presented in large print to enhance accessibility for readers with impaired vision. Published by Megali, a company dedicated to making historical texts more readable, it aims to preserve important literature while ensuring it is accessible to a wider audience.
Three Dialogues Between Hylas and Philonous in Opposition to Sceptics and Atheists
in large print
- 168 Seiten
- 6 Lesestunden
Focusing on accessibility, this publication by Megali aims to provide historical works in large print format, catering specifically to individuals with impaired vision. By reproducing original texts, it enhances readability and ensures that important historical content is available to a broader audience.
The Works of George Berkeley Bishop of Cloyne; 8
- 328 Seiten
- 12 Lesestunden
The Works of George Berkeley Bishop of Cloyne; 7
- 408 Seiten
- 15 Lesestunden
Selected for its cultural significance, this work contributes to the foundational knowledge of civilization. It is recognized by scholars for its importance in understanding historical and societal contexts, making it a valuable resource for those interested in the evolution of human thought and culture.
Philosophical Commentaries by George Berkeley
Transcribed From the Manuscript and Edited with an Introduction by George H. Thomas, Explanatory Notes by A.A. Luce
- 398 Seiten
- 14 Lesestunden
The edition of Berkeley's Philosophical Commentaries features an accurate transcription of his manuscript, accompanied by an insightful introduction that contextualizes the work. Extensive notes are included to assist readers in interpreting the text, along with a comprehensive index for easy navigation. This edition aims to enhance the understanding of Berkeley's philosophical insights.
George Berkeleys "Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis" ist eine lesefreundliche Ausgabe in Großdruck. Sie enthält die erste deutsche Übersetzung von Friedrich Ueberweg und eine Biographie des Autors. Der Text basiert auf der Ausgabe von 1869 und ist sorgfältig bearbeitet.
Principles of Human Knowledge and Three Dialogues Between Hylas and Philonous
- 150 Seiten
- 6 Lesestunden
Subjective idealism is the central theme explored in this influential work by George Berkeley, an Irish philosopher. In "Principles of Human Knowledge," he argues that reality is shaped by human perception, dismissing any external reality beyond our senses. The book faced criticism from contemporaries like John Locke, prompting Berkeley to respond with "Three Dialogues Between Hylas and Philonous," which presents a dialogue addressing these objections. Together, these works delve into complex philosophical ideas such as conceptual relativity and phenomenalism, making them essential reading for philosophy students.
Choć najważniejsze dzieła Berkeleya koncentrują się na problematyce filozoficznej, ich zawartość wskazuje na apologetyczny cel. Eseje i kazania zawarte w tym tomie dotyczą bezpośrednio problemów religijnych i teologicznych, mając na celu umocnienie wiary słuchaczy. Zawierają również cenne interpretacje systemu filozoficznego Berkeleya. Ostry podział na dzieła filozoficzne i niefilozoficzne byłby jednak błędny. Przykładem jest "Bierne posłuszeństwo" (1712), wczesna praca Berkeleya, która zawiera istotne treści jego filozofii moralnej i jest poprawioną wersją trzech kazań wygłoszonych w kaplicy Trinity College w Dublinie. Z kolei projekt założenia kolegium na Bermudach, przedstawiony w Jubileuszowym kazaniu, należy do pism o charakterze społecznym, ale także odnosi się do moralistyki ukazanej w "Alkifronie" i zapowiada nową wizję natury w "Siris". Te prace pokazują, że religijne i filozoficzne aspekty myśli Berkeleya są ze sobą ściśle powiązane, co czyni je istotnymi dla zrozumienia jego całokształtu myślenia.
Dialogy mezi Hyladem a Filonoem podávají přístupnější formou Berkeleyho imaterialismus, poprvé vyložený o tři roky dříve v Pojednání o principech lidského poznání. Důraz je kladen na vztah imaterialismu a tzv. common sense, tj. názoru obyčejných lidí, protože právě tato oblast byla kritiky nejvíce nepochopena. Přílohu tvoří krátký spis O pohybu, který se danému materialistickému a mechanickému tématu věnuje ze zcela imaterialistických pozic. V knize uvedené ISBN 978-80-7298-176-5 je chybné, ISBN 978-80-7298-176-2 je správné.
