Deutsche in Venedig
Geschichte einer Begegnung



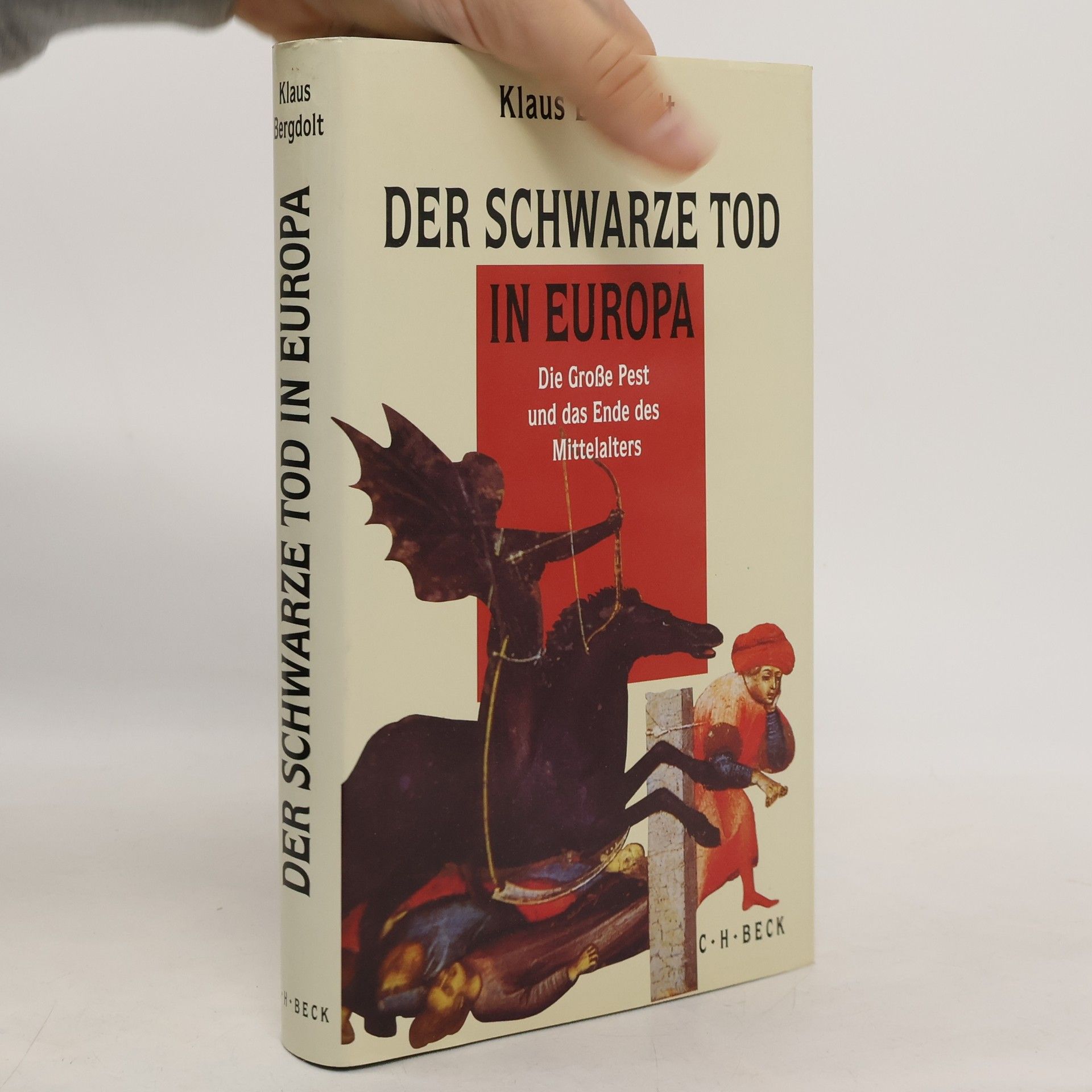

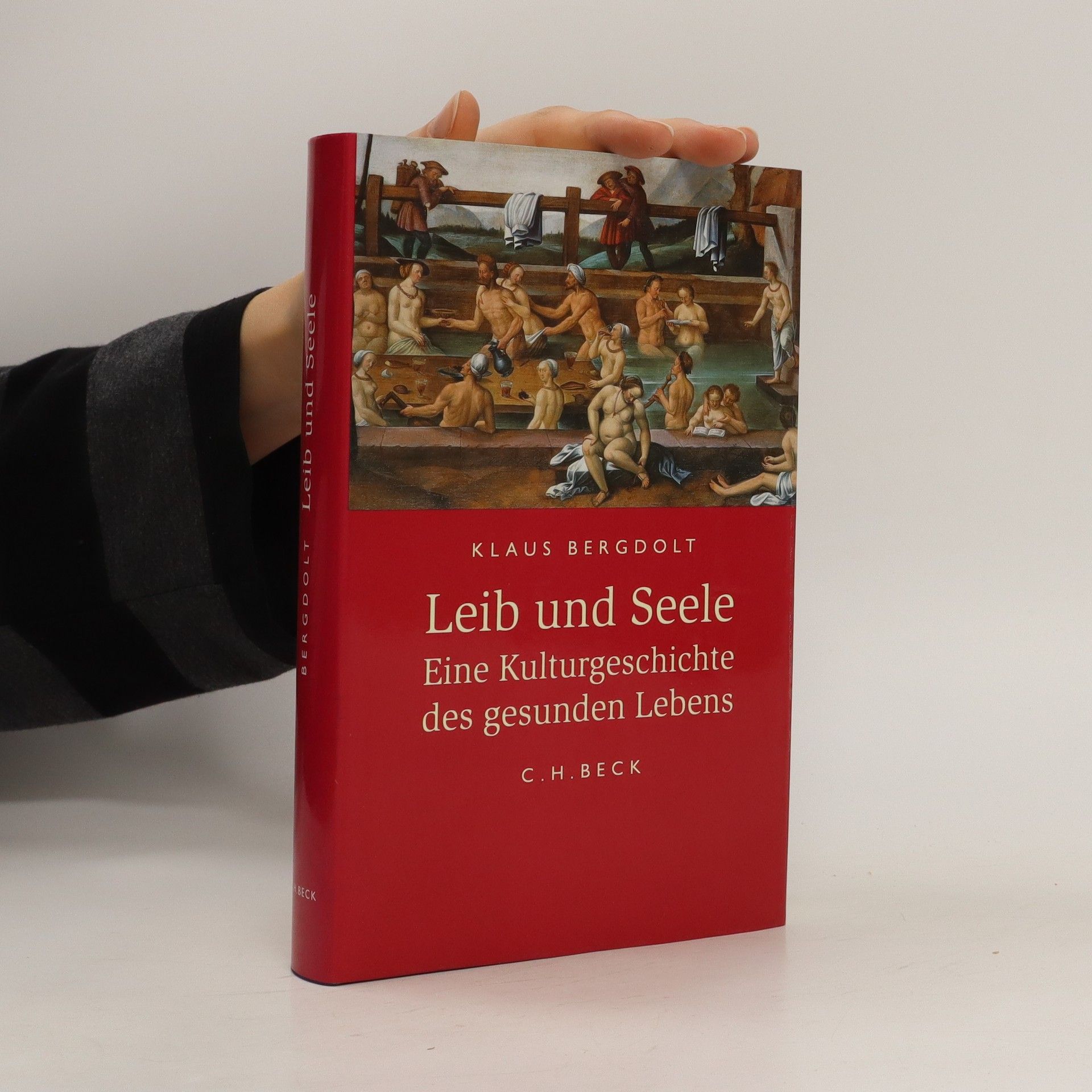

Geschichte einer Begegnung
Krippenausstellungen, Krippenvereine, Krippensammlungen in Museen bezeugen das Interesse an diesem besonderen Zugang zum Weihnachtsfest, wenn auch häusliche Weihnachtskrippen - die Gründe sind vielfältig - immer seltener zu finden sind. Klaus Bergdolt erkundet die kulturhistorischen Zusammenhänge der Weihnachtskrippe von den Anfängen bis ins 19. und 20. Jahrhundert. Historische, philosophische, theologische und ästhetische Faktoren wirkten auf ihre Entwicklung ein. Zahlreiche Motive und Details sind heute erklärungsbedürftig, nicht nur die Geburt Jesu in einem Stall, sondern auch der Stern von Bethlehem, das Auftauchen der Magier, Ochs und Esel … Interessant sind die Entwicklungen und Varianten der europäischen Krippengeschichte, deren Blütezeit zwischen 1650 und 1850 lag. Italien und der südliche deutsche Sprachraum bilden einen besonderen Schwerpunkt
Geschichte des Schwarzen Todes
Die Pest war über Jahrhunderte eine der schlimmsten Seuchen der Menschheit. Die großen Pandemien dieser Krankheit haben den Lauf der Geschichte beeinflusst. Klaus Bergdolt stellt ihren weltweiten Siegeszug mit den gravierenden sozialen, politischen und mentalitätsgeschichtlichen Folgen dar. Erst spät wurde der Erreger entdeckt, doch auch heute ist die Krankheit noch nicht ganz besiegt.
Komprimierte, umfassende Darstellung der Geschichte der Pest mit ihren gravierenden sozialen, politischen und mentalgeschichtlichen Folgen.
Historická studie zabývající se dějinami moru a jeho dopadem na kulturu a společnost. Mor, který Evropu postihl v letech 1346 až 1350, byl jednou z největších katastrof v dějinách Západu. Padla mu za oběť zhruba třetina obyvatelstva. Klaus Bergdolt se zabývá nejprve epidemiemi antiky a raného středověku a lékařskou problematikou moru, a posléze na základě poutavých svědectví soudobých kronikářů líčí každodenní život za moru, zabývá se průvodními jevy černé smrti, jako byly průvody flagelantů a pogromy, a vlivem moru na hospodářskou a společenskou strukturu evropských zemí. V závěru se zaměřuje na vliv moru na umění a literaturu pozdního středověku.
Der Medizinhistoriker Bergdolt (vgl. "Der schwarze Tod": ID 28/94) leistet hier auf Grund stupenden Quellen- und Literaturstudiums (28 Seiten Bibliografie!) eine Tour durch die Gesundheitslehren von den alten Hochkulturen bis ins 19. Jahrhundert. Bei allem, was im Laufe der europäischen Kulturgeschichte über Gesundheit und Krankheit gedacht, geschrieben und praktiziert wurde, fällt die enge Verflechtung zwischen Religion und Medizin auf: Der Anspruch der Religion einerseits, Gesundheit als gottgegeben zu bestimmen, der medizinische Ansatz zum andern, Gesundheit als individuell beeinflussbar zu fassen. Das Pendel zwischen "Aberglauben" und "Wissenschaft" schlug im Laufe der Jahrhunderte immer wieder nach der einen oder anderen Seite aus. Letztlich durchgesetzt hat sich aber die Kunst der Diätetik, die Lehre vom gesunden Leben und der Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit. Die äußerst ertragreiche Darstellung über die Entwicklungen und Veränderungen des Gesundheitsbegriffs bricht mit dem 19. Jahrhundert unvermittelt ab. - Im Kontext der Arbeiten von H. Schipperges (BA 2/95; 7/90; ID 22/92). (3) (Uwe-F. Obsen)