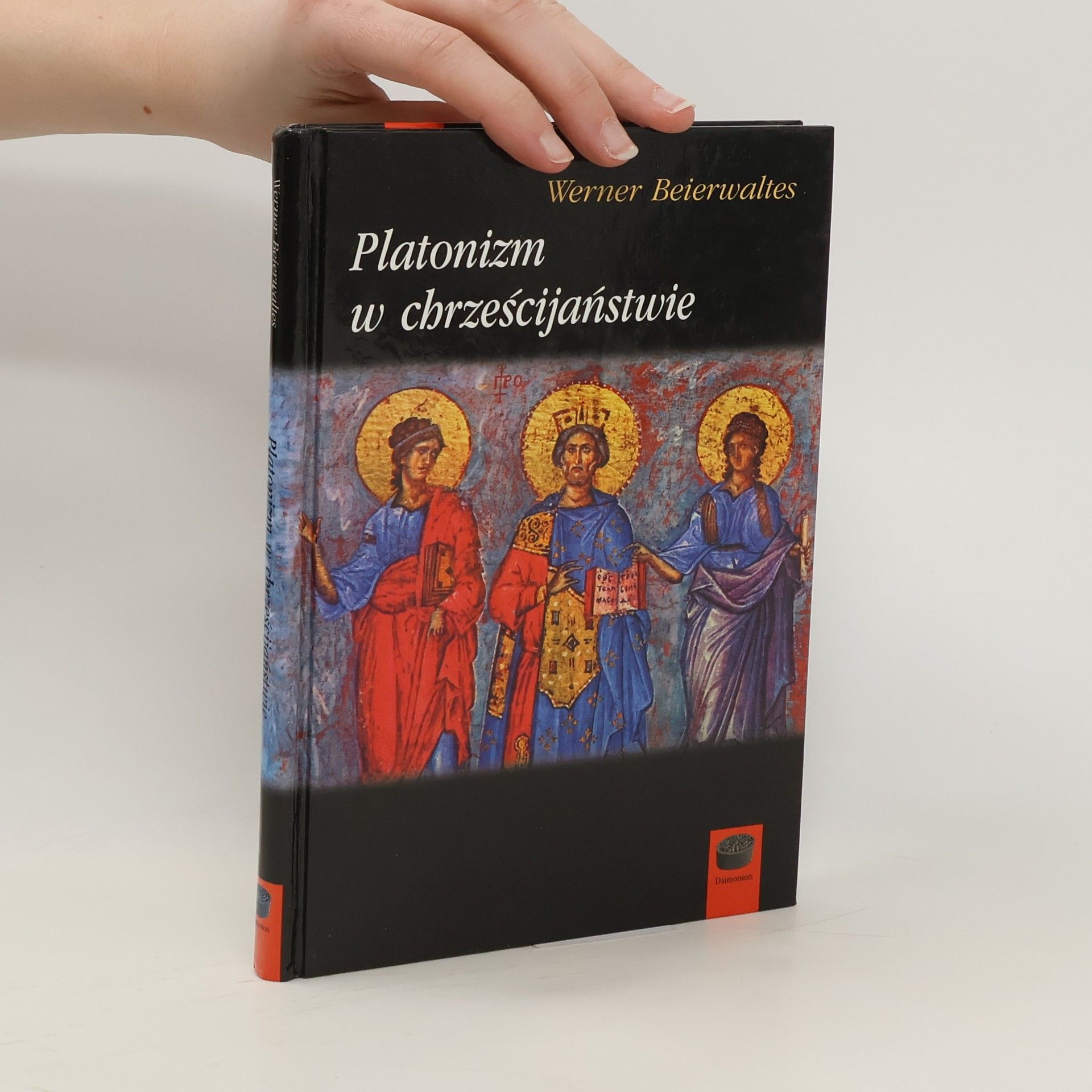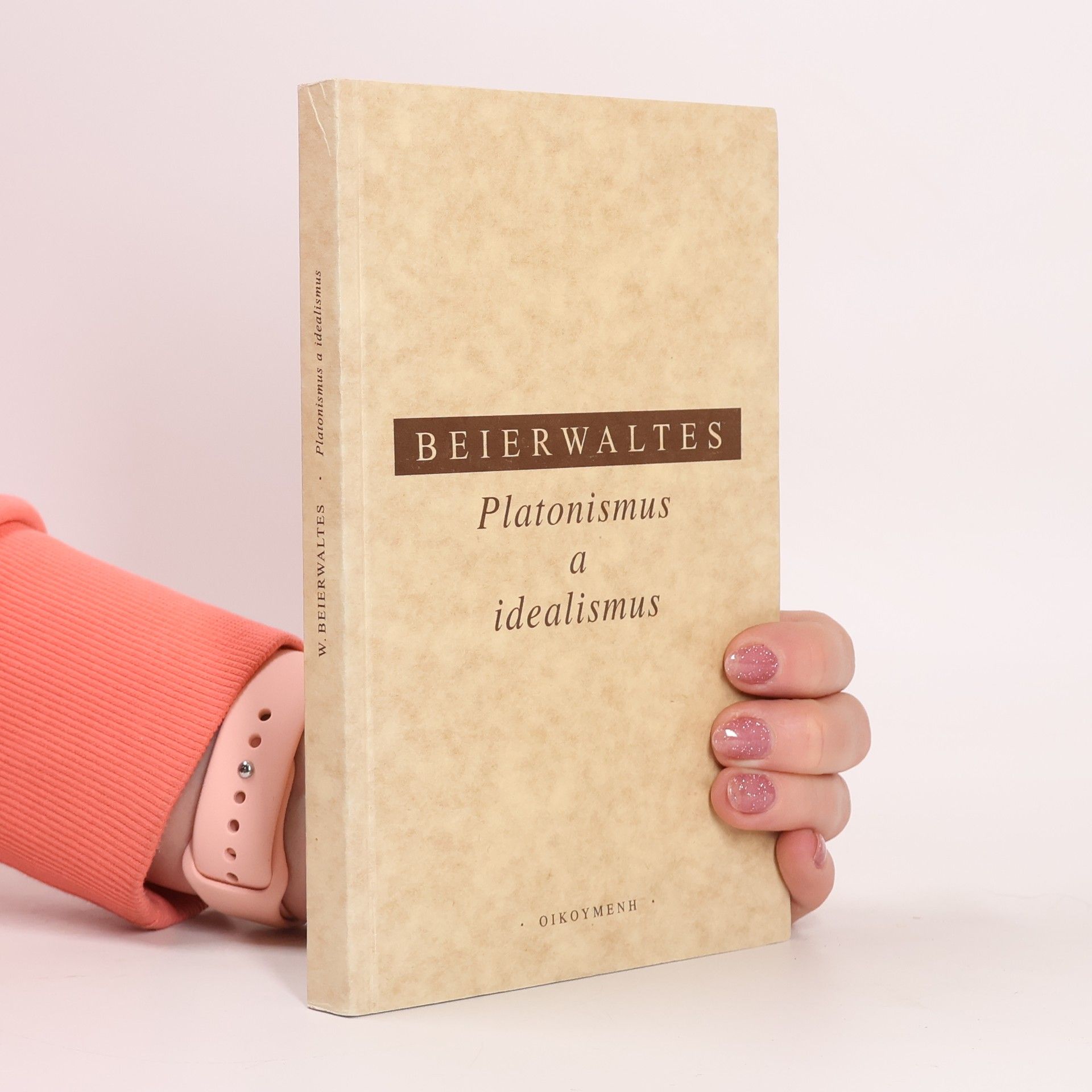Werner Beierwaltes Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



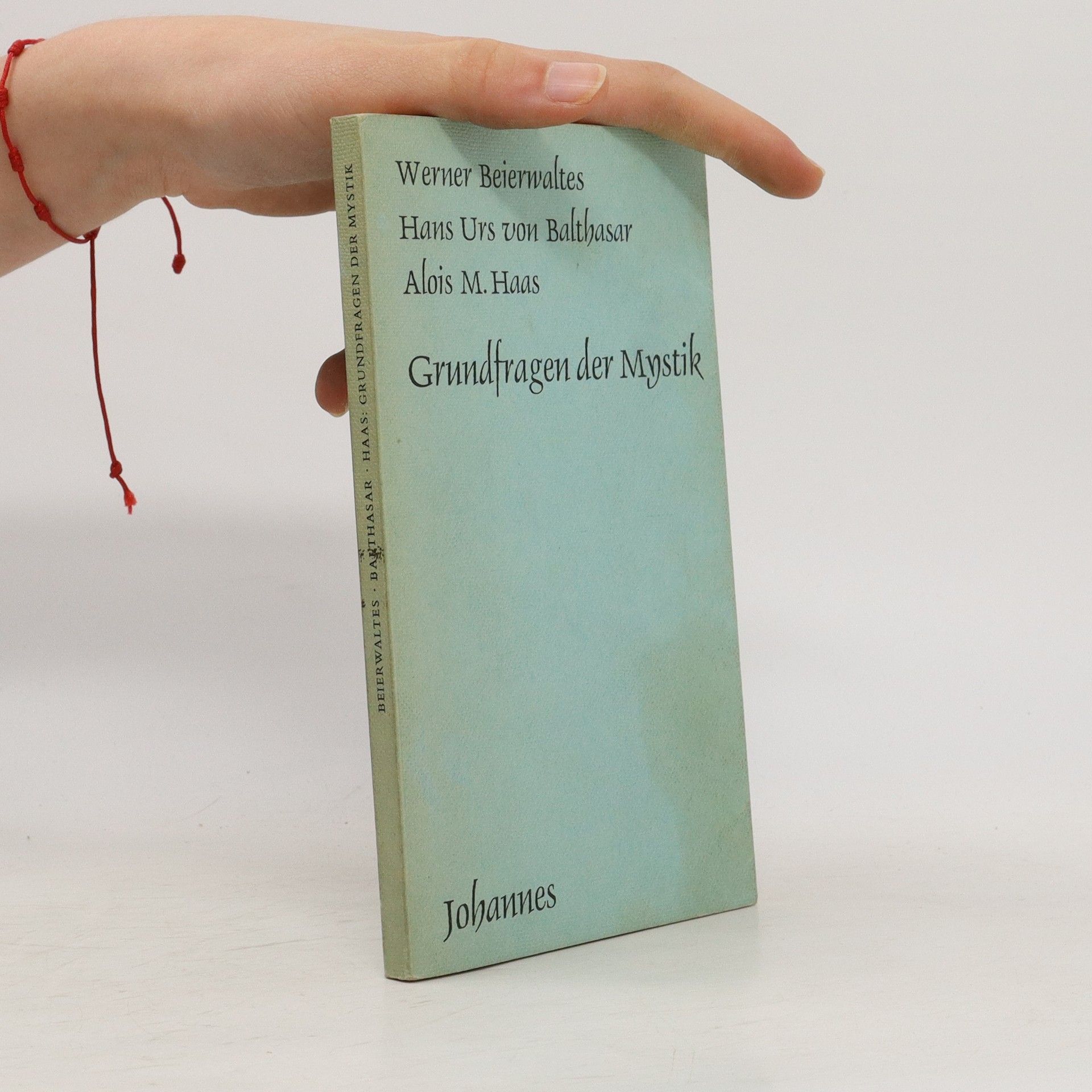
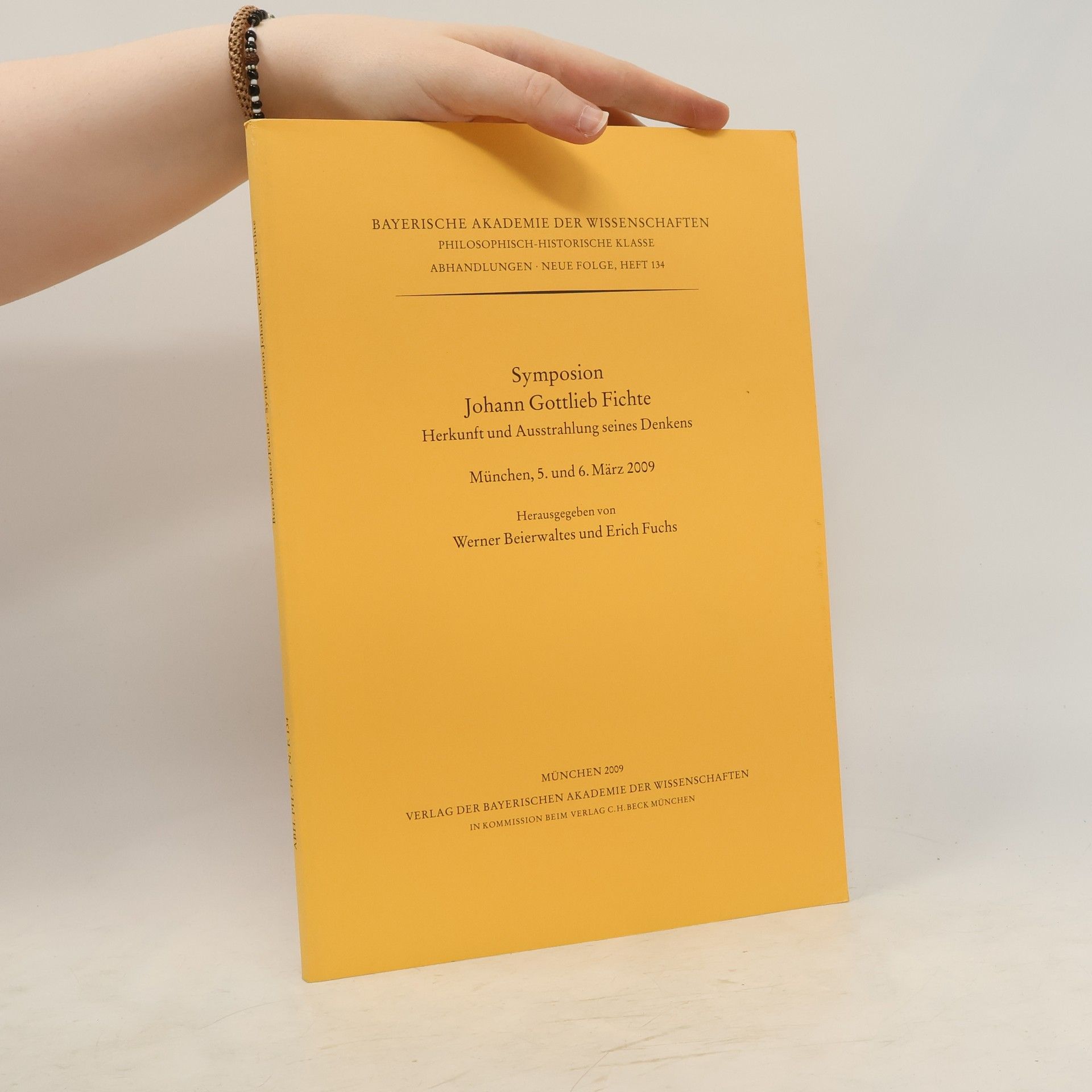


Der Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead behauptete, die Geschichte der Philosophie Europas sei als eine „series of footnotes to Plato“ verstehbar. Wahr an diesem viel zitierten Dictum ist durchaus, dass neben Aristoteles und der Stoa vor allem Grundgedanken der Philosophie Platons in verwandelter Form das philosophische Denken der Spätantike, des christlichen Mittelalters, der Renaissance und der Metaphysik der Neuzeit wesentlich geprägt haben. Die in diesem Band versammelten „Fußnoten zu Plato“ reflektieren eine Reihe von zentralen platonischen Fragen, wie sie etwa von Plotin, Proklos, Augustinus, Johannes Scotus Eriugena, Nicolaus Cusanus, Marsilio Ficino, Johannes Reuchlin, Schelling und Hegel aufgenommen und weitergedacht worden sind. Martin Heideggers ambivalente Platon-Rezeption wird im Zusammenhang seines „Rückgangs zu den Griechen“ überhaupt thematisiert. In diesen unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte des Denkens erschließt sich zugleich deren systematischer Sinn und ihre lebensformende Kraft.
Symposion Johann Gottlieb Fichte
- 98 Seiten
- 4 Lesestunden
Proklos (412-485), der letzte Diadochos Platons in der Akademie zu Athen, hat die metaphysische Theorie des Neuplatonismus im fünften Jahrhundert n. Chr. vollendet. Sein Denken reflektiert die Dialoge Platons und konzentriert sich auf das absolute Eine als Grund einer differenzierten Vielheit sowie auf Geist und Seele als Struktur des gesamten Wirklichen, sowohl des geistigen als auch des sinnlichen Kosmos. Proklos sieht die Möglichkeit und Aufgabe des Menschen darin, sein eigenes Sein in seinem Ursprung denkend zurückzuführen und sich so selbst zu begreifen. Die Überlegungen des Buches thematisieren die Einheit von Philosophie als Lebensform und systematischem Denken, das durch radikale negative Dialektik im Hinblick auf das Absolute an seine Grenzen gelangt. Dies wird exemplarisch durch die Erörterung des Begriffs des mit dem Einen identischen Guten und des Geistes als dynamischer Einheit verdeutlicht. Die Philosophie des Proklos hat eine weitreichende Wirkungsgeschichte bis zum Deutschen Idealismus entfaltet. Das Buch verfolgt Spuren dieses Prozesses im Mittelalter und in der Renaissance, etwa in Meister Eckharts Konzept von Gott und Gelassenheit, in Nicolaus Cusanus' Denken des Einen und als „Zentrum des Lebens“ sowie in Marsilio Ficinos neuplatonischer Deutung des platonischen „Parmenides“. Die Produktivität und Überzeugungskraft metaphysischen Denkens wird in verschiedenen historischen Kontexten spürbar.
Nicolai de Cusa, Opera omnia
- 190 Seiten
- 7 Lesestunden
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften hat am 11. und 12. Februar 2005 ein Symposium über Nikolaus von Kues veranstaltet. Anlaß hierzu war der Abschluß der von ihr über viele Jahre hin betreuten ersten historisch-kritischen Ausgabe der Werke des Cusanus. Die im vorliegenden Bande veröffentlichten Vorträge sind zum einen dem Rückblick auf den Anfang und den Fortgang der Ausgabe gewidmet, zum andern eröffnen sie Einblicke in das cusanische Denken, die dessen philosophisch-theologische Weite und Eindringlichkeit verdeutlichen und zudem seinen kulturellen Kontext bewußt machen.
Christliche Theologie ist seit ihrer Entstehung untrennbar mit Philosophie verbunden, wobei begriffliches Denken zur reflektierenden Selbstdurchdringung des Glaubens führt. Die griechische Metaphysik, insbesondere Platonismus und Aristotelismus, hat die Entwicklung der Theologie als „Wissenschaft“ maßgeblich beeinflusst. Diese Übernahme philosophischer Theorien, Denkformen und Terminologien ist nicht nur formal, sondern prägt auch die Inhalte der Theologie. Historisch betrachtet gab es immer wieder Ängste vor einer „Hellenisierung“ oder „Verweltlichung“ des Christentums. Das Buch untersucht, inwieweit Philosophie im neuen Kontext ihre ursprüngliche Intention bewahrt. Beeinflusst das Christentum die Philosophie, oder wird es durch sie irritiert, verdeckt oder gar zerstört? Ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung zwischen dem „Alten“ und dem „Neuen“ eine produktive Synthese oder Symbiose, die interessanter ist als eine gewaltsame Trennung? Diese Fragen werden anhand von Paradigmen aus der Spätantike (Marius Victorinus, Dionysius Areopagita), dem Mittelalter (Bonaventura, Meister Eckhart) und der Renaissance (Nicolaus Cusanus, Marsilio Ficino) aus der Perspektive des spätantiken Neuplatonismus (Plotin, Porphyrios, Proklos) erörtert. Dabei werden grundlegende Begriffe des metaphysischen Denkens behandelt, die auch für die jeweiligen Lebensformen prägend sind.
Platónská tradice v antické filosofii a její recepce ve filosofii německého idealismu.
Heideggers Rückgang zu den Griechen
Vorgetragen in der Gesamtsitzung am 18. Februar 1994
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften mit Sitz in der Münchner Residenz ist eine der ältesten und größten deutschen Wissenschaftsakademien. Als Gelehrtengesellschaft und Forschungseinrichtung widmet sie sich vorwiegend der Grundlagenforschung sowohl im geistes- als auch im naturwissenschaftlichen Fächerspektrum mit einem Schwerpunkt auf langfristigen größeren Forschungsunternehmungen. Die Gemeinschaft der Gelehrten ist in zwei Klassen organisiert, einer philosophisch-historischen und einer mathematisch-naturwissenschaftlichen, die sich regelmäßig treffen. Bei diesen Klassensitzungen stellen einzelne Mitglieder Ergebnisse aus ihren Forschungen vor, die in den Sitzungsberichten veröffentlicht werden.
Johannes Scottus Eriugena repräsentiert eine herausragende Figur des spekulativen Denkens im frühen Mittelalter, die Philosophie und Theologie als eine argumentativ gesicherte Einheit verwirklicht hat. Seine theologischen Reflexionen sind von zentralen Fragen des neuplatonischen Philosophierens geprägt, insbesondere hinsichtlich Einheit, Sein und Denken. Eriugena gelingt es, originäre Einsichten über den göttlichen Ursprung und dessen kreative Entfaltung in der Welt zu entwickeln. Werner Beierwaltes untersucht in diesem Werk zentrale Aspekte von Eriugenas Denken, insbesondere dessen Überlegungen zur Funktion der Sprache und zur Insuffizienz der Sprache im Vergleich zum Absoluten, die er durch „negative Theologie“ auszugleichen versucht. Eng verbunden mit dem Sprachproblem ist die Frage nach menschlicher Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein, die das „absolute, göttliche Selbstbewusstsein“ widerspiegelt. Diese Fragestellungen werden ontologisch durch die Analyse der trinitarischen Einheit und deren kreativer Selbst-Entfaltung beleuchtet. Die Welt wird als differenzierte Harmonie und als „Metapher“ verstanden, die einen Rückgang und einen Aufstieg in der Kunst ermöglicht – vom Bild zum Ur-Bild. Eriugenas Quellen haben auch Auswirkungen auf seine Wirkungsgeschichte, die sich in Denkern wie Nicolaus Cusanus und im Deutschen Idealismus zeigt, sowie in der Gegenwart bei E. Pound und J. L. Borges.